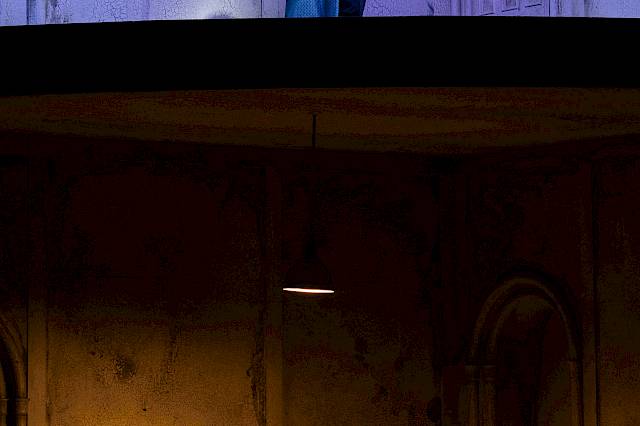Parsifal
Bühnenweihfestspiel in drei Aufzügen von Richard Wagner (1813-1883)
Libretto vom Komponisten
In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 5 Std. 25 Min. inkl. Pausen nach dem 1. Aufzug nach ca. 1 Std. 45 Min. und nach dem 2. Aufzug nach ca. 3 Std. 30 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Gut zu wissen
Meine Rolle

Wenn ich auf der Bühne stehe und die Kundry singe, dann bin ich in diesem Moment Kundry, ohne viel nachzudenken. Abstrakt über die Figur zu sprechen, ist nicht leicht. Denn was sie ausmacht, ist ja gerade das Geheimnis, das sie umgibt. Man darf sie nicht zu sehr festlegen, sie muss rätselhaft bleiben. Sie kommt aus dem Nichts und verschwindet ins Nirgendwo. Niemand weiss, woher sie kommt, wohin sie geht. Und sie ist auch für sich selbst ein Geheimnis – denn sie ist eine Suchende. Einer ihrer ersten Sätze im ersten Akt lautet: «Ich helfe nie.» Auch das ist rätselhaft – was meint sie damit? Warum hilft sie nicht? Hat sie nicht gerade eben einen Balsam gebracht – «von weiter her, als du denken kannst» –, der Amfortas heilen soll, dessen Wunde sich nicht schliessen will?
Als «wildes Weib» bezeichnet Wagner Kundry im ersten Akt. Für mich ist sie eine Art UrFrau. Kundry hat ein geheimes Wissen, sie versteht viel – und vor allem hat sie eine extrem starke Intuition. Und manchmal kommen Worte aus ihr heraus, die sie nicht kontrollieren kann. Sie ist zudem die einzige Frau in dieser Männergesellschaft um den Gral. Aber wenn ich auf der Bühne stehe, denke ich auch nicht darüber nach, ob ich eine Frau spiele oder einen Mann. Ich denke an uns alle als Menschen, als Existenzen, nicht als Frauen und Männer.
Kundry lebt durch alle Zeiten. Dass sie mit einer schweren Schuld zu kämpfen hat, ist vielleicht das Menschlichste an ihr. Sie sah Jesus am Kreuz – und verlachte ihn. Seither ist sie verflucht, ewig weiterzuleben, sich «endlos durch das Dasein zu quälen». Nun soll sie – im zweiten Akt – auf Geheiss Klingsors Parsifal verführen, so wie sie schon Amfortas und viele andere zuvor verführt hatte; doch diesmal scheitert sie, Parsifal kann sich von ihr losreissen; es ist ausgerechnet ihr Kuss, der Parsifal «welthellsichtig» macht. Am Schluss des Stückes stirbt Kundry; und ich persönlich empfinde das als Erlösung für sie. Aber auf der Bühne sollte man das nie so konkret darstellen, das Publikum muss zu einer eigenen Interpretation finden können darüber, was der Tod bedeutet. In jedem Fall geht es hier um einen transzendenten Tod, um einen Übergang in einen anderen Zustand.
Musikalisch oder stimmlich ist für mich die grösste Herausforderung in dieser Partie, lyrisch und schlank in der Tongebung zu bleiben. Ich singe oft Brünnhilde aus der Götterdämmerung, und meine Stimme ist sehr dramatisch. Deshalb ist Kundry für mich fast wie ein Liederabend. Verglichen mit anderen Partien von Wagner ist es eher eine kurze Partie; es ist auch keine von den hochdramatischen WagnerRollen. Aber man braucht viele Farben und Nuancen in der Stimme.
In Zürich habe ich seit 2001 regelmässig gesungen, und ich bin sehr gern hier. Auch freue ich mich, wieder in einer Inszenierung von Claus Guth aufzutreten; ich habe mit ihm Tristan und Isolde hier in Zürich erarbeitet und die Ariadne in seiner Inszenierung in der Wiederaufnahme gesungen. Gemeinsam mit Christian Schmidt schafft er es, sehr tief in die Stücke und die Situationen einzudringen. Das gefällt mir sehr, ich geniesse den Luxus, sich die Zeit zu nehmen, den Charakter einer Figur Schicht um Schicht freizulegen. Neben der Musik ist es genau das, was mich immer wieder an Wagner reizt: Seine Figuren sind psychologisch unglaublich interessant.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 55, Januar 2018
Das Mag können Sie hier abonnieren
Die geniale Stelle
Unter unsäglichen Qualen ist Parsifal vom «reinen Toren» zum «durch Mitleid Wissenden» gereift und hat seine Aufgabe verstanden: die Gralsritter aus ihrem Siechtum zu befreien, die die heiligsten Güter hüten bis zur – vielleicht nahen, vielleicht fernen, vielleicht aber auch nie eintretenden – Erlösung der Welt, die ohne diese Reliquien nicht möglich ist. Denn in ihnen vergegenständlicht sich die Basis, auf der die neue Welt zu errichten ist: allumfassende Menschenliebe, bedingungslose Hingabe an den Nächsten – das «Liebesopfer» des Heilands.
Aber Parsifal weiss auch, dass er noch eine andere Aufgabe zu erfüllen hat, und wendet sich der Frau zu, deren Schicksal keinen anderen kümmert: Kundry. Auch sie hat er verstanden, ihre Not erkannt. Also verrichtet er sein «erstes Amt» als Gralskönig, in dem er ihr gibt, was er ihr geben kann: Die Taufe, mit der er sie annimmt, wie sie ist, die Einsame, Verachtete, die von ihrer Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit durch unzählige Welten, zahllose Existenzen gehetzt wird. Er kann ihr ein wenig Wärme spenden, sie «sanft auf die Stirn» küssen. Das ist wenig, und er weiss es. Man hört es im kläglichen Tonfall bei «die Taufe nimm und glaub’ an den Erlöser». In der fast endlosen Dehnung des Worts «Erlöser», als solle die reine Dauer die Triftigkeit der Hoffnung bestätigen, im kraftlosen Absturz um eine Septe bei der letzten Silbe eben dieses Wortes: Er ist es nicht, auf den Kundry wartet. Er kann sie nur zum Glauben ermutigen, dass der Ersehnte einst kommen wird. Aber Glaube ist nicht Gewissheit. So ist es wenig, was er ihr geben kann. Aber es ist alles, was ihm möglich ist, und so ist es viel.
Und Kundry weiss das. Glaube ist nicht Gewissheit, aber Hoffnung zu wecken, ist ein Akt liebevoller Güte, ist menschliche Zuwendung. Eine Zuwendung, die sie nicht mehr erfuhr in den Jahrhunderten, seit sie den gemarterten Jesus verlachte und er für einen Moment seinen Blick auf ihr ruhen liess. Die zarte Geste findet ihr Echo im sanften Klang des Motivs der göttlichen Gnade, das tröstend und traurig sich auf Kundry zu senken scheint, bis die Bewegung in einem übermässigen Dreiklang erstirbt: Sie weint. Ein scharf dissonierender Basston tritt hinzu und bringt die Bewegung wieder in Gang. Es folgt eine quälend langsam absinkende chromatische Linie, das Motiv des leidenden Heilands wird gestreift, dann bleibt nur noch unbestimmtes Wogen in tiefer Finsternis. Nun aber geschieht ein Wunder, erhebt sich eine Melodie von so vollendeter Schönheit, wie man sie selbst beim grossen Melodiker Wagner schwerlich ein zweites Mal finden wird: Der Tränenumflorte sieht die Welt verändert, sieht den Vorschein der erhofften, künftigen erlösten in der gegenwärtigen.
Doch das eigentliche Wunder dieser Stelle ist der erste Ton, der leise Einsatz der Oboe, der die Klangfarbe kaum merklich aber entscheidend ändert, mit dem ein Licht durch das Dunkel leuchtet, als wäre es schon immer dagewesen, das überirdisch zu sein scheint und doch ganz diesseitig ist. Unwillkürlich denkt man an jene Stelle des Johannesevangeliums: «Das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen.» So schwach dieses Licht sein mag, das aus der Zukunft leuchtet, die Finsternis kann es nicht besiegen, auch das Grauen der letzten Szene und die gläserne Erstarrung des Stückschlusses können ihm nichts anhaben: Es verbürgt die Hoffnung auf eine bessere Welt, die Wagner trotz allem, was dagegenspricht, bis in die letzte Stunde seines Lebens nicht aufgeben wollte.
Text von Werner Hintze
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 56, Februar 2018
Das MAG können Sie hier abonnieren