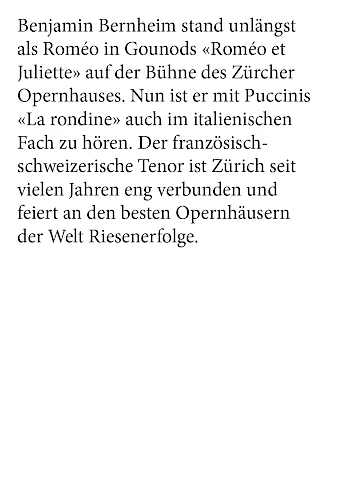La rondine
Giacomo Puccini (1858-1924)
Commedia lirica in drei Akten
Text von Giuseppe Adami nach einem Librettoentwurf von Artur Maria Willner
und Heinz Reichert, Schweizerische Erstaufführung
In italienischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 2 Std. 20 Min. inkl. Pause nach ca. 1 Std. 15 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Die Einführungsmatinee findet am 3 Sep 2023 statt.
 Official Timepiece Opernhaus Zürich
Official Timepiece Opernhaus Zürich
Gut zu wissen
Pressestimmen
«Ein grandioser Puccini-Clou»
NZZ, 19.09.23«Die Inszenierung von Christof Loy überwältigt Publikum und Sänger – ein Glücksfall.»
Tages-Anzeiger, 18.09.23«Sensationell sind Ermonela Jahos Spitzentöne im Pianissimo, grossartig ihr Spiel mit dem Verstecken oder Offenlegen ihrer Gefühle.»
bachtrack.com, 19.09.23«Benjamin Bernheim scheint durch die Partitur Puccinis (…) förmlich zu fliegen, entwickelt mit wenigen Noten eine ungeheure Spannung»
NZZ, 19.09.23«Puccini zum Schwelgen»
Deutschlandfunk Kultur, 17.09.23
Interview

Was habe ich im Leben verpasst?
Die Oper «La rondine» erzählt die Geschichte einer Frau, die den Erinnerungen an eine rauschhafte Jugendliebe nachhängt und sie noch einmal erleben will. Der Regisseur Christof Loy über ein Drama ohne Blutvergiessen, das Tragische am nicht gelebten Leben, und die Qualitäten einer bis heute unterschätzten Oper von Puccini, in der die Grenzen zwischen Traurigkeit und Leichtigkeit fliessend sind
Christof, du hast dieses Stück für Zürich vorgeschlagen. Warum passt La rondine zum Opernhaus Zürich
Ich glaube, dass die Rondine gut in einem Haus aufgehoben ist, das einen intimen Rahmen hat. Das Stück lebt von vielen kleinen Gesten und Blicken, von einzelnen Details. Für diese Art von Kammerspiel ist Zürich mit seinen gut tausend Plätzen ein ideales Opernhaus. Für mich wäre es undenkbar, La rondine auf einer Breitwandbühne wie der Amsterdamer Oper zu inszenieren. Man merkt dem Stück an, dass es letztlich in Monte-Carlo uraufgeführt wurde, einem noch viel kleineren Haus als Zürich.
Du kennst La rondine seit deiner Jugendzeit. Was faszinierte dich damals so daran?
Ich hatte von Anfang an eine starke Affinität zu Magda. Sie ist die Figur, mit deren Imagination alles losgeht, die in die Vergangenheit taucht und versucht, sich eine neue Gegenwart zu schaffen. Dieses Melancholisch-Verhangene, das immer nah am Tragischen ist, das Tragische im Alltäglichen, hat mich früh fasziniert. Es ist das Drama ohne Blutvergiessen, das mich an diesem Stück interessiert.
Das ist vielleicht ein noch viel grösseres Drama, weil das Leben weitergeht und die kleinen Tragödien in das Leben integriert werden müssen...
In La rondine werden viele kleine Tode gestorben, ohne dass wirklich jemand auf der Bühne stirbt. Ich finde das sehr berührend, und es schafft eine grosse Identifikationsfläche für das Publikum. Denn jeder kennt die Konflikte, die in diesem Stück ausgetragen werden. Was hat man im Leben alles verpasst? Kann man kostbare Momente, die sich erst im Nachhinein als wichtig herausstellen, erneut erleben, sie nochmals einfangen? Oder hat sich das Leben in der Zwischenzeit bereits zu sehr verselbständigt, so dass ein Zurückdrehen der Zeit nicht mehr möglich ist? Es geht auch um Reue, um das, was man sich selbst schuldig ist. Es ist ja so leicht, immer andere verantwortlich zu machen für das, was im eigenen Leben schiefläuft.
Daraus folgt diese nostalgische Note, die über diesem Stück schwebt.
Das hängt besonders mit Magda zusammen, die eine Aussenseiterfigur und eine fragile Person ist. Magda bewegt sich zwar in diesem gesellschaftlichen Rahmen mit grosser Souveränität, sie hat Sensibilität und Klasse. Aber sie ist ökonomisch abhängig. Magda hat keinen normalen Beruf, keinerlei soziale Absicherung. Wenn sie ein Mann fallen lässt, fällt sie ins Nichts. Mit ihrem reichen Gönner Rambaldo lebt sie eine Ehe-ähnliche Verbindung, aber ohne alle Vorteile einer Ehe, was, wie wir wissen, das Allerschlimmste ist. Zwischen Magda und Rambaldo greifen daher fatale Mechanismen mit einer latenten Aggressivität von beiden Seiten. Zwar hat Magda ein grosses Verdrängungspotenzial, aber gleichzeitig ist ihr Bewusstsein über die aktuelle Situation sehr ausgeprägt. Doch ist sie jemand, der gelernt hat, eine Fassade aufzubauen. Dahinter verbirgt sich ein ganzes, nicht gelebtes Leben. Dabei versucht sie aber auch, ihre Würde zu behalten. Das ist letztlich wie bei Marguerite Gautier, dem Vorbild zu Verdis Violetta, aus Dumas’ Kameliendame. Wenn man diesen Roman liest, wird deutlich, dass sie auch eine Art Geschäftsfrau ist, wie Magda. Sie passt nicht in die normale Schublade eines bürgerlichen Lebens.
Magda sagt einmal, dass das Unnormale in ihrem Haus die Regel sei...
Ja!
Dreh- und Angelpunkt der Oper ist Magdas wehmütige Erinnerung an eine längst vergangene Liebesepisode mit einem unbekannten Studenten. In der Figur des jungen Ruggero versucht Magda diese Begegnung zu wiederholen. Sigmund Freud prägte in der Entstehungszeit von La rondine den Begriff des Wiederholungszwanges, den er sogar mit dem Todestrieb in Verbindung brachte. Das Thema der Wiederholung scheint damals in der Luft gelegen zu haben.
Bei Magda sehe ich weniger eine Pathologie oder einen Zwang, ein gleiches Muster unentwegt durcharbeiten zu müssen, als vielmehr den Versuch, eine Situation zu schaffen, die zu einer Veränderung führt. Die Episode in ihrer Jugendzeit mit dem unbekannten Mann, die sie so geprägt hat, war das Abenteuer eines Abends, nicht einmal das einer Liebesnacht. Für einen Moment denkt Magda, dass ihr Leben mit Ruggero tatsächlich ganz anders weitergehen wird. Trotz aller Traurigkeit, die sie erwachsen werden liess, ist Magda eine kindliche Seele geblieben. Deshalb hat sie die fixe Idee, an diesem unerfüllten Traum des Lebens festzuhalten. Sie versucht, die neue Realität mit dem neuen Mann in einem Traumzustand zu bewahren. Im Grunde genommen möchte oder kann Magda aber keine richtige Beziehung mehr führen, sondern nur einen Traum leben. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Das ist alles nachvollziehbar, aber auch traurig anzusehen.
Wenn man das so hört, würde man nicht denken, dass in diesem Werk auch ein Operettenton mitschwingt.
Die Grenzen zwischen Traurigkeit und Leichtigkeit sind hier fliessend. La rondine hat etwas von einem Melodram. Ich muss da immer wieder an französische Filme denken, an Jacques Demys Les Parapluies de Cherbourg mit Catherine Deneuveaus den 1960er-Jahren etwa. Für mich ist die Tatsache, dass in diesem Werk auch Operette steckt, jedenfalls nichts Schlechtes. Im Gegenteil: Als ob man von einer Operette eine Krankheit bekommen könnte! Und der Begriff «Zarzuela» wird ja von Ignoranten wie ein Schimpfwort benutzt. Wie wir wissen, deckt das Genre der Operette viele verschiedene Formen des Musiktheaters ab und bedeutet nicht automatisch, dass wir es mit einem durchgängig lustigen Stück zu tun haben müssen. Nehmen wir die tragische Operette der Silbernen Operetten-Ära: La rondine hat viel Ähnlichkeit mit dem letzten Akt von Lehárs Zarewitsch oder der Giuditta. Selbst bei der Lustigen Witwe gibt es Momente, in denen alles kippen könnte. La rondine ist einfach ein sehr gutes Stück, bei dem jeder Takt erfordert, dass man genaue szenische und musikalische Entscheidungen fällt, damit die grosse Feinmechanik erhalten bleibt. Man muss alles gut dosieren, darf die Momente von Glück und Seligkeit für einen Moment auch ruhig zulassen, um im nächsten Moment wieder bewusst dagegen anzuarbeiten.
Der leichte Ton ist vor allem in den ersten beiden Akten spürbar. Der letzte Akt ist dann grosse Oper...
Bei der heutigen Probe wurde mir das nochmals ganz deutlich: Zwei Menschen müssen sich trennen, gerade weil sie sich lieben. Sie trennen sich nicht, weil sie sich entlieben, sondern weil sie Angst haben, dass einmal in ferner Zukunft eine Trennung stattfinden könnte und es dann noch schmerzhafter werden würde. Dass hier letzlich die Frau die Entscheidung trifft, ist gerade auch für Puccini bemerkenswert. Magda ist eben auch eine starke Frau, selbst wenn sie anlehnungsbedürftig erscheint, ein verträumtes Kind ist oder eine ausgehaltene Frau ohne Beruf.
Magdas Entscheidung, Ruggero zu verlassen, könnte man als einen Akt der Selbstermächtigung lesen.
Sie handelt hier jedenfalls auch aus einem grossen moralischen Gefühl heraus. Magda muss sich aber sehr dazu überwinden und tut sich dabei selbst Gewalt an. Sie sieht ein, dass diese Liebe nicht lebbar ist. Es ist vollkommen widersprüchlich, und doch wäre es zu einfach zu sagen, sie gibt auf. Sie kann letztlich ihr ganzes Leben lang stolz auf diesen Moment sein. So bitter das auch ist.
Puccini schrieb in einem Brief an seinen Librettisten Adami über den Schluss: «Ich habe die ganzen dramatischen Verwicklungen herausgestrichen, der Abschluss wird ganz diskret und leise erreicht, ohne grossen Radau im Orchester. Alles in Ordnung.»
Das bezieht sich auf die allerletzten Momente des Stückes. Natürlich wühlen Magda und Ruggero vorher in ihrer beider Wunden noch einmal ganz ordentlich. Das ist ein lauter Aufschrei. Das gesangliche Ende ist dann allerdings eine Art Verstummen in einem nicht artikulierten Laut, als ob man Magda die Sprache weggenommen hätte. Magda ist grundsätzlich ein verschlossener Charakter, der nicht viel von sich preisgibt. Dass sie ihren Freundinnen im ersten Akt von ihrem Erlebnis mit dem jungen Studenten erzählt, passiert ja auch nur, weil sie durch das Gedicht von ihrem Seelenfreund Prunier dazu angeregt wurde. Sie fühlt sich eingeladen und geht immer mehr in diese Erinnerung. Daraus entsteht dann ihr Wunsch, sich nochmals neu zu erfinden.
Mit Ruggero trifft sie auf jemanden, der völlig konträr zu ihr steht.
Ruggero hat natürlich auch seine eigenen Vorstellungen. Das Fatale ist, dass er in dem Masse bürgerlich ist wie sie unbürgerlich. Das meine ich überhaupt nicht wertend. Ruggero hat einfach den Wunsch eines klassischen Familienmodells. Magdas Selbstbewusstsein ist aber so ausgeprägt, dass sie weiss, sie kann das nicht leisten und wird seinen Vorstellungen nicht entsprechen. Ruggero will einen anderen Traum realisieren als sie, wobei man sagen muss, dass seiner viel realer ist als ihrer. Er hat sich ein falsches Bild von ihr gemacht, während sich Magda im Grunde gar kein Bild von ihm gemacht hat. Magda war für ein paar Wochen mit einem Fantom-Ruggero glücklich, mit dem sie sich als biografische Gestalt überhaupt nicht auseinandergesetzt hat.
Magda selbst gibt sich Ruggero gegenüber auch nicht wirklich zu erkennen. Wenn Ruggero Magda im Tanzlokal Bullier nach ihrem Namen fragt, stellt sie sich als Paulette vor. Das hat doch was von einer psychischen Doppeldeutigkeit...
Wobei Paulette möglicherweise sogar ihr richtiger Name ist. Aber das gehört ja auch zum Programm: Sie will nicht mehr Magda sein!
Magdas Dienstmädchen Lisette wiederum taucht bei Bullier verkleidet als Magda auf. Sie und der Dichter Prunier bilden – zunächst nur im Geheimen – das zweite Paar in dieser Oper. Wie sieht deren Schwalbenflug aus?
Beide Figuren sind für mich wie Volksfiguren und berühren mich sehr. Sie haben das Herz auf dem rechten Fleck, und beide finden im Gegensatz zu Magda und Ruggero für sich ihr Glück.
Prunier geht mit Lisette in der Öffentlichkeit allerdings sehr unzimperlich um.
Lisette aber auch mit ihm! Sie sind beide gleich stark. Es ist ein ständiges Spiel zwischen den beiden, und die Liebe ist gross. Doch es stimmt schon: Prunier ist ein widersprüchlicher Charakter. Prunier hat aber auch diese wunderbare seelische Verbindung zu Magda. Zwischen den beiden besteht eine Beziehung, die auf einer völlig anderen Ebene stattfindet als auf der üblichen Attraktivität oder Anziehungskraft zwischen Frau und Mann. Es ist eine sehr besondere Freundschaft. Man kann sich vorstellen, dass die beiden einst ein Liebespaar waren, aber jetzt zwischen ihnen alles gereinigt und geklärt ist und nur noch das Schöne übriggeblieben ist. Deshalb sehe ich da eine grosse Vertrautheit, ja fast Innigkeit zwischen den beiden. So nah kommt weder Ruggero an Magda, noch Lisette an Prunier.
Was ist für dich die Quintessenz dieser traurigen Komödie?
Bei aller Realistik ist dieses Stück auch eine Traumgeschichte. Für mich ist es ganz klar: Puccini übernimmt hier eine grosse Verteidigung der Träumer. Er weiss, wie wichtig Träume im Leben sind. Es wird nur dann gefährlich, wenn man denkt, dass sich alle Träume auch in die Realität umsetzen lassen. Diese Reise, die Magda unternimmt – sei sie wirklich, oder auch nur in ihrem Kopf – ist nah an der Absturzgefahr.
Viele Regisseurinnen und Regisseure machen einen Bogen um Puccini, dessen Musik fast als szenografisch zu beschreiben ist. Sie scheinen sich in ihrer szenischen Erfindungskraft eingeengt zu fühlen. Bei dir ist das anders...
Man muss natürlich Lust an der Genauigkeit haben, Takt für Takt. Ich merke sofort, wenn jemand nicht im richtigen Winkel im Raum steht, nicht im richtigen Moment zuhört oder sich wegdreht. Da rächt sich das Stück sofort. Menschen in Zeit und Raum – das ist mein Element. Bei der Rondine ist es allerdings sehr angenehm, dass Puccinis Vorgaben nicht so sehr mit Requisiten zu tun haben wie bei La bohème. Das kann einen durchaus lähmen.
Du hast voriges Jahr Puccinis fast zeitgleich zu La rondine entstandenes Il trittico in Salzburg inszeniert und einige Jahre zuvor La fanciulla del West in Stockholm gemacht. Interessiert dich besonders das Spätwerk Puccinis?
Ich finde seine späteren Stücke insgesamt gelungener als frühe Stücke wie Manon Lescaut oder Le Villi, die zwar schon eine grosse musikalische Qualität haben, aber noch nicht dieses ideale Timing, bei dem kein Takt zuviel ist. Natürlich besteht für mich auch ein Reiz darin, dass die späteren Stücke seltener gespielt werden und man mehr entdecken kann, weil man sie nicht so gut kennt.
Du arbeitest zum ersten Mal mit Ermonela Jaho.
Wir haben uns vor vier Monaten in München getroffen und waren beide sehr neugierig aufeinander. Der Wunsch war schon früher da, etwas gemeinsam zu machen, aber bisher hat es leider nie geklappt. Wir werden in dieser Spielzeit auch noch Poulencs La voix humaine in Madrid zusammen machen. Sie ist für mich, nun ja, um beim Stück zu bleiben, Traum gewordene Realität. Allerdings ohne Absturzgefahr.
Das Gespräch führte Kathrin Brunner
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 104, September 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Volker Hagedorn trifft...

Ermonela Jaho
Ermonela Jaho wurde in diesem Jahr bei den International Classical Music Awards als «Künstlerin des Jahres» ausgezeichnet. Die Sopranistin ist gebürtige Albanerin. Ihre Karriere führte sie an alle grossen Häuser der Welt. Höhepunkte der jüngeren Zeit waren ihr Debüt als Adriana Lecouvreur an der Wiener Staatsoper, Mimì am Teatro Real in Madrid, Liù an der New Yorker Met, Cio-Cio-San an der Staatsoper Hamburg sowie Blanche in «Dialogues de Carmélites» von Francis Poulenc an der Bayerischen Staatsoper.
Sie trinkt ihren Espresso ohne Zucker, das Guetzli bleibt liegen, das Wasserglas bleibt lange voll, trotz der Augusthitze im Wintergarten des Café Sphères, es gibt einfach zu viel zu erzählen. Ich muss nicht mal erklären, was das für eine Porträtreihe ist, für die wir uns hier treffen, nachdem sie, Ermonela Jaho, heute schon sechs Stunden Probe hinter sich hat und ich neun Stunden reiste, dank der üblichen «Störungen im Betriebsablauf» der Deutschen Bahn, von denen die Sängerin erstmals hört, überrascht: «Aber in Deutschland ist man doch so pünktlich!» «Das ist dreissig Jahre her.» Sie klopft mir amüsiert tröstend auf den Arm. Ob man vor dreissig Jahren in Deutschland oder in Albanien lebte, das ist ein himmelweiter Unterschied. Was Ermonela als Kind und Teenager erlebte, das spielt, wie sich herausstellen wird, bis heute eine grosse Rolle.
Auch für ihre Gestaltung der Magda in Giacomo Puccinis La rondine, über die wir zuerst sprechen, denn bis eben hat sie auf der Probebühne an dem Stück gearbeitet. Magda gelingt gerade das nicht, was Ermonela einst schaffte, gegen beträchtliche Widerstände einen Traum zu realisieren. «In dieser Oper stirbt keiner», meint sie, «aber es ist trotzdem dramatisch. Wenn du stirbst, ist das Leben vorbei», sie klatscht kurz in die Hände wie eine Lehrerin, die «Schluss für heute!» ruft, «aber leben mit einem Traum, der nie wahr wird, mit diesem Schmerz, das ist dramatischer, als nur zu sterben.» Magda komme aus der demi-monde wie Violetta in La traviata, der junge Mann, den sie liebt, aus solider Familie, «und vielleicht kommt er auch nicht im richtigen Moment…» Sie liebt es, wie der Regisseur Christof Loy arbeitet, «an allen Details, allen Personen. Jeder hat seine eigenen Gedanken, seine eigene Art, ans Leben heranzugehen, das ist in unserer Rondine auch so, nicht nur mit den Solistinnen und Solisten, auch mit der Tanztruppe und dem Chor. Es ist irgendwie eine Reise, die wir erleben hinter der Geschichte von Magda und Ruggero, eine Lebensreise. Ich bin ja seit dreissig Jahren unterwegs auf den Bühnen, ich will nicht sagen im world business, aber es passiert nicht so oft, dass ein Regisseur auf diese Weise Leben auf die Bühne bringt.» Von world business dürfte sie durchaus reden, sie singt, in New York lebend, an den grossen Häusern der Welt, und für Arte entstand sogar ein Film über sie und ihre Kolleginnen Barbara Hannigan und Asmik Grigorian, Fuoco sacro, eine Suche nach dem «heiligen Feuer des Gesangs».
Man könnte auch einfach von Wahrhaftigkeit sprechen, von der Identität von Leben und Kunst, die auf der Bühne gelingen kann, und keineswegs, sagt Ermonela, auf der Bühne allein: «Theater ist eine direkte Verbindung vom Herzen des Künstlers zu dem des Publikums. Verwundbar zu sein gehört auch dazu. Du kannst einem schönen Klang lauschen, fünf Minuten, zehn Minuten. Okay, schön, aber passiert da noch etwas? Die Menschheit existiert noch, weil es den Austausch von Gefühlen gibt, und Oper ist das in gross.» Ihre Stimme, ihre Mimik ändert sich bei diesen Worten, als stünde sie schon wieder auf der Bühne, überhaupt sind ihr schmales Gesicht, die Melodien und die Farben ihres Sprechens immer eins mit dem, was sie sagt. Mitunter könnte man sie fast ohne Worte verstehen – was auch im Getöse des Cafés sehr hilfreich ist. Dunkler und schattiger klingt sie, als sie von dem Erlebnis spricht, das sie überhaupt zur Oper brachte, La traviata im Tirana des Jahres 1988, als Ermonela vierzehn Jahre alt war, in der Dämmerung des kommunistischen Regimes, das Albanien vom Rest der Welt isoliert hatte. «Ich wusste nichts über diese Oper, es war meine erste. Da war etwas, das mich so sehr berührte. Violetta, das ist eine gefolterte Seele. Und wir, in Albanien geboren, haben all die Tragödien des Balkans im Blut. Kinder sind wie ein Schwamm, sie saugen alles auf. Es ist wie ein Archiv. Jeder Mensch hat das und weiss es nicht.» Das wurde ihr erst später klar. Damals erklärte sie dem älteren Bruder, mit dem sie in die Oper gegangen war: «Ich werde Opernsängerin, und ich werde nicht sterben, ohne einmal in meinem Leben Violetta gesungen zu haben.» Das wäre auch für ein Mädchen unter bequemeren Bedingungen eine kühne Ansage. Ermonela blieb ihr treu, studierte nach dem Zusammenbruch des Regimes Gesang am Konservatorium in Tirana und wurde dort von der Person entdeckt, ohne die es in kaum einer Sängerkarriere geht, die den entscheidenden Schritt ermöglicht. Katia Ricciarelli, italienische Sängerin, die einen Meisterkurs gab, lud sie nach Mantua ein. «Aber es war wirklich hart für mich, 1993 aus Albanien nach Italien zu kommen.» Zehntausende Albaner waren über das Meer nach Italien geflohen und dort nicht gerade willkommen, «und jeder dort sah mich an mit diesem Blick, obwohl ich dabei war, meinen Traum zu realisieren. Warum bin ich kein deutscher oder italienischer Teenager, fragte ich mich, warum muss ich leiden? Meine Therapie war es, zu singen.» Den Lebensunterhalt ihrer Ausbildung, zuerst in Mantua, dann in Rom, verdiente sie mit Babysitten und Gelegenheitsjobs. «Meinen Eltern habe ich immer gesagt, alles ist prima, ich wollte ihnen Sorgen ersparen. Sie hatten mir eine Erziehung gegeben und mich unterstützt, nun war es an mir, zu kämpfen. Wenn man aus Ländern mit solchen Schwierigkeiten wie Albanien kommt, ist das die positive Seite: Du siehst immer, wie du kämpfen musst, um dich durchzusetzen. Es gab auch Momente, in denen ich dachte, ich höre auf, jetzt reicht’s. Aber wenn ich zwei Tage lang nicht sang, merkte ich, das ist mehr als nur Karriere. Meine Seele braucht das. So machte ich weiter und weiter.» So lange, bis sie bei einem Wettbewerb auf einer Bühne ihre «Balkan side» ausspielen konnte, wie sie das nennt. Das ungefiltert Dramatische. «Ich bin auf der Bühne wie ein Tier, das aus dem Käfig kommt», sagt sie und lacht, «im Leben bin ich viel kontrollierter». Mit 26 Jahren hatte sie in Bologna ihr erstes professionelles Engagement als Mimì in La bohème, und von da an ging es so steil aufwärts, dass sie 2008 in London für die erkrankte Anna Netrebko einsprang und triumphierte – in der Rolle ihres frühen Traums, der Violetta. Es ist sozusagen die Rolle ihres Lebens, sie ist inzwischen 310-mal in Alfredos Armen gestorben, «aber ich bin nicht immer dieselbe Person. Ich habe in mir bestimmte Seiten entdeckt, die ich mit zwanzig Jahren nicht kannte.» Als sie dachte, jetzt gäbe es für diese Rolle doch nichts mehr zu entdecken, nach ihrer Violetta an der MET im Januar, da brachte ein junger italienischer Dirigent sie auf neue Ideen, Francesco Ciampa vom Teatro Massimo in Palermo. «Ich fühlte mich, als hätte ich das noch nie gesungen! Aber jetzt werde ich mit Violetta aufhören.»
Was bleibt, ist die Erfahrung von Leiden, die sie zuerst in dieser Gestalt gebündelt fand. Ermenola ist überzeugt, dass sie vor allem deswegen etwas zu sagen hat auf der Bühne, weil sie selbst gelitten hat. «Für mich muss ein Künstler ein kleines Trauma haben. Wir lernen aus Schmerz, und Schmerz verbindet, aber das heisst nicht, dass der Künstler traurig sein muss.» Auf die Idee käme man bei ihr ohnehin nicht, so aprilhaft wechseln Wolken und Sonne in ihrem Gesicht, so witzig führt sie vor, warum schöner Klang auch mal auf der Strecke bleiben muss. «Wenn im Drama geweint wird, kann ich nicht sagen, oh, lasst uns das schön machen» – sie sagt das mit süss flötender Stimme und tut, als blicke sie verklärt. «Wenn du weinst, weinst du. Das ist keine Schande. Du musst es wagen, das Publikum mag das.» Ein Vorbild bis heute ist für sie Maria Callas, «weil sie so viel am Gefühl arbeitet. Natürlich musst du deine Hausaufgaben in der Technik machen, ohne die kann man nichts ausdrücken. Es geht darum, der Rolle, die du singst, die Farben der Seele zu geben. Und keine Angst haben, sich verletzlich zu zeigen.» Noch weniger Angst davor hat sie seit Covid. «Wir Künstler sahen, dass wir nicht mehr existierten. Du weisst nicht, was morgen passiert. Seitdem gehe ich immer auf die Bühne, als wäre es die letzte Aufführung, das ist eine Art Befreiung, und ich weiss dann, ich habe 100 Prozent gegeben, mit all meinen Stärken und Schwächen. Like it or dislike it, but it was honest.»
Das Gespräch führte Volker Hagedorn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 104, September 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Fotogalerie
Ich sage es mal so
Benjamin Bernheim stand unlängst als Roméo in Gounods «Roméo et Juliette» auf der Bühne des Zürcher Opernhauses. Nun ist er mit Puccinis «La rondine» auch im italienischen Fach zu hören. Der französisch-schweizerische Tenor ist Zürich seit vielen Jahren eng verbunden und feiert an den besten Opernhäusern der Welt Riesenerfolge.Ich sage es mal so ist eine neue Interviewform in unserem MAG, in der Künstlerinnen und Künstler des Opernhauses - nach einer Idee des SZ-Magazins - in Form eines Fotoshootings Auskunft über sich geben
Drei Fragen an Andreas Homoki

Herr Homoki, das Opernhaus Zürich hat die vergangene Spielzeit mit Turandot von Giacomo Puccini beendet und beginnt die neue gleich wieder mit Puccini: Die Eröffnungspremiere ist die selten gespielte Oper La rondine. Was macht diesen Komponisten so wertvoll für das Opernrepertoire?
Er ist der letzte Opernkomponist, der mit seinen Werken das ganz grosse Publikum erreicht. Diese Breitenwirkung hat im zwanzigsten Jahrhundert nach ihm niemand mehr erzielt, nicht einmal Richard Strauss. Nach Puccini sind zwar kompositorische Meisterwerke wie Alban Bergs Wozzeck entstanden, aber an die Popularität von La bohème, Tosca oder Madama Butterfly reichen sie nicht heran. Das spüren wir bei der Spielplangestaltung bis heute, obwohl ausgerechnet über Puccini ja von verschiedenen Seiten immer wieder schlecht geredet wurde. Man hat ihn unter Kitschverdacht gestellt und kritisiert, seine Musik sei manipulativ in ihrem Streben nach grösstmöglicher theatralischer Wirkung. Da kann ich nur sagen: Ja, was denn sonst? Genau darum geht es doch: Dramatik und Emotionalität auf den Punkt zu bringen! Vorurteile gegen über Opernkomponisten haben oft auch mit einer den Blick verengenden Aufführungstradition zu tun. Wer immer nur kitschige Bohème-Inszenierungen erlebt, denkt natürlich, dass das eine Schmonzette ist. Wer sich aber auf das musikalische Material konzentriert, merkt schnell, wie unglaublich präzise und modern die Oper gearbeitet ist, und das gilt auch für die anderen Opern von Puccini. Ich habe das in den Theaterferien gerade selbst wieder erfahren, als ich in Bregenz war, um auf der Seebühne die Wiederaufnahme meiner Inszenierung von Madama Butterfly zu proben.
Was kann Puccini, was andere Komponisten nicht können?
Er hat einfach einen unfassbaren Theaterinstinkt. Er versteht es, direkt in eine Situation reinzuspringen und auf der Stelle deutlich zu machen, worin die Dramatik besteht. Er legt sie mit geradezu chirurgischer Präzision offen und arbeitet die emotionalen Möglichkeiten Moment für Moment ab – mit sparsamen, genau kalkulierten musikalischen Mitteln. Oft geniesst er es, die besonders atemberaubenden Momente mit beinahe nichts zu erzeugen. Dieses untrügliche Sensorium für Dramatik haben nur die ganz grossen Opernkomponisten. Ich bin sehr gespannt, wie das bei uns in La rondine über die Rampe kommt.
La rondine ist ein Mauerblümchen in Puccinis Opernschaffen. Das Stück wird kaum gespielt. Die Zürcher Neuproduktion ist sogar die Schweizerische Erstaufführung. Glauben Sie an die Qualität dieser Oper?
Absolut. Sonst hätten wir sie nicht in den Spielplan genommen. Der Regisseur Christof Loy hat die Oper vorgeschlagen. Wir sprachen über mögliche Projekte, und er sagte mir, dass er das Stück toll finde und gerne einmal machen würde. Es gehört ja zu unserem programmatischen Anspruch, auch immer wieder Werke auf die Bühne zu bringen, die zu Unrecht kaum gespielt werden. Also haben wir Christof Loy zugesagt und mit Ermonela Jaho und Benjamin Bernheim in den Hauptrollen und Marco Armiliato am Dirigentenpult eine wirklich hochkarätige Besetzung gefunden. Ich selbst habe die Oper noch nie auf der Bühne gesehen, ich kenne sie nur vom Hören. Die emotionalen Ausschläge sind nicht so extrem, wie wir das sonst von Puccini kennen. Seine Idee war ja, etwas Leichtes und Operettennahes zu schreiben. Vielleicht können wir mit unserer Produktion dazu beitragen, dass die Oper in Zukunft mehr Beachtung findet. Das würde mich natürlich sehr freuen.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 104, September 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Hintergrund
Eine Schwalbe, um die sich niemand kümmert
Eine Oper von Giacomo Puccini, die kaum je aufgeführt wird – gibt es das? Das ist das Schicksal von «La rondine», die jetzt als Schweizerische Erstaufführung in Zürich auf die Bühne kommt. Ein Gespräch mit dem Puccini-Forscher Anselm Gerhard über ein zu Unrecht vernachlässigtes Werk
Anselm Gerhard, wie haben Sie reagiert, als Sie hörten, dass das Opernhaus Giacomo Puccinis La rondine aufführen wird?
Ich habe mich riesig gefreut. Ich halte das für ein wirklich lohnendes, interessantes Stück, das einfach Spass macht und viel zu selten aufgeführt wird. Die Zürcher Produktion wird ja sogar eine Schweizerische Erstaufführung sein.
Wie sicher können wir sein, dass La rondine tatsächlich zum ersten Mal in der Schweiz aufgeführt wird?
Ich würde sagen, zu 99,9 Prozent. Es gibt exzellente Recherchemöglichkeiten mit Tageszeitungen bis in die Gegenwart, und wenn man da absolut nichts findet, kann man es eigentlich ausschliessen, dass das Stück jemals in der Schweiz gespielt wurde. Auch in der Datenbank des Schweizerischen Theaterarchivs sind keine Aufführungsreferenzen für die Schweiz bekannt.
Wie erklären Sie sich das?
La rondine ist kein Kassenschlager à la Tosca oder La bohème. Die Oper ist gewissermassen der arme Verwandte von Puccinis Opern, offenbar noch ärmer als Le Villi und Edgar. Vielleicht ist es aber auch ganz einfach dem Zufall geschuldet.
Wie haben Sie selbst La rondine kennengelernt?
Ich war in Norditalien und hatte bei der Gelegenheit einen Schwenker über Pisa gemacht, um dort eine Aufführung der Rondine zu besuchen: eine Aufführung mit einer sehr guten Provinzbesetzung in einer recht anständigen Inszenierung. Der Abend hat mir gut gefallen. Danach habe ich mich intensiv mit dem Stück auseinandergesetzt.
Es gibt kaum Einträge zu La rondine in den grossen Opernführern…
Das ist durchaus berechtigt. Ein Opernführer muss normalerweise in einen oder zwei Bände passen. Da gilt es zu entscheiden, welche Opern oft gespielt werden. La rondine gehört da definitiv nicht dazu.
Die Rondine ist in vielerlei Hinsicht ein Solitär in Puccinis Œuvre. Das Ungewöhnlichste daran aber ist vielleicht, dass der weltweit führende Opernkomponist ursprünglich eine Operette hätte schreiben sollen. Wie kam es zu diesem Auftrag?
Puccini war 1913 wegen einer Fanciulla-Vorstellung in Wien, als er vom Wiener Carltheater, das auf Operetten spezialisiert war, ein Angebot für eine Operette bekam. Ein renommiertes Autorenduo, Alfred Maria Willner und Heinz Reichert, das bereits für Lehár gearbeitet hatte, sollte das Szenario verfassen und Puccini acht bis zehn musikalische Nummern beisteuern. Etwas Leichtes, Eingängiges zu komponieren, das reizte Puccini offenbar. Doch eine Operette schreiben, das wollte er dann doch nicht. Er hatte das von Anfang an nicht im Sinn, das wird in seinen Briefen deutlich. Warum er den Auftrag dennoch annahm, ist mir nicht ganz klar. Puccini war offensichtlich selbst mit sich im Unreinen. Sicher lockte ihn auch das Honorar von 200’000 Kronen, eine enorme Summe, nach heutiger Kaufkraft umgerechnet etwa eine Million Euro. Puccini brauchte natürlich Geld, er hatte teure Hobbies und mehr als eine Geliebte. Andererseits spricht vieles dafür, dass Puccini ganz einfach ein grosses Faible für die Stadt Wien hatte. Er fühlte sich dort wohl und hatte mehrere enge Freunde.
Das Szenario der Wiener Librettisten war von Verdis La traviata und Johann Strauss’ Fledermaus inspiriert. Puccini war nicht gerade euphorisch, was den Stoff betraf, verwarf ihn aber auch nicht. Später zog er den italienischen Dramatiker und Librettisten der Turandot, Giuseppe Adami, hinzu. Was passierte bei dieser Transformation?
Adami war dafür verantwortlich, das Ganze in italienische Verse zu setzen und den direkten Anweisungen Puccinis anzugleichen. Es war eine mühselige Arbeit, wie alle anderen Libretti für Puccini. Schlussendlich hatte Adami 16 verschiedene Akte geschrieben, bis Puccini mit drei Akten zufrieden war. Diese Version muss sich erheblich vom ursprünglichen Entwurf der Wiener Autoren unterschieden haben. Wir Puccini-Forscher würden viel dafür geben, an das originale deutsche Wiener Libretto zu gelangen, aber es ist verschollen. Vieles aus den Wiener Archiven der damaligen Zeit wurde entweder entsorgt oder im Krieg durch Bombardierungen zerstört.
La rondine ist ein internationales Werk geworden. Der Auftrag stammt zwar aus Österreich, die Sprache ist Italienisch, die Geschichte spielt in Paris und an der Côte Azur, uraufgeführt wurde das Werk schliesslich wegen des Ersten Weltkrieges nicht mehr in Wien, sondern in Monte-Carlo…
Und dann verwendet Puccini auch noch Walzer, die an Richard Strauss’ Rosenkavalier erinnern… Puccini ist nicht so italienisch, wie wir ihn gerne hätten. Dieses Stück ist eben schwierig einzuordnen und passt nicht in unser Puccini-Bild. Dazu gehört auch die Frage, wie viel oder wie wenig Operette drin ist. Von Anfang an war das für die Rezeption ein ungelöstes Problem, wie man den ersten Wiener Aufführungskritiken entnehmen kann. Das behinderte den Erfolg des Werks enorm. Einem Komponisten kann es zuweilen sehr schaden, wenn er nicht in seinem ureigenen Genre arbeitet.
Wenn Puccini keine Operette schrieb, mit was für einem Gebilde haben wir es denn zu tun?
Für mich ist es eine melancholische Oper mit Operetteneinschlag, jedenfalls eindeutig eine Oper. Puccini bezeichnet sie als Commedia lirica. Für eine Operette wäre gesprochener Dialog konstitutiv und damit auch ein Sängerensemble, bei dem das Schauspiel mindestens genauso wichtig ist wie das Opernsingen, wenn nicht sogar wichtiger. La rondine hat aber keine Dialoge, sondern ist durchkomponiert. Es braucht hier exzellente Sängerinnen und Sänger.
Puccini bezeichnete die Oper einmal als sein «geliebtes Sorgenkind». Von La rondine gibt es drei verschiedene Fassungen...
Puccini wollte immer wieder nachjustieren und war letztlich vor allem mit dem dritten Akt nicht glücklich. Wir kennen Puccini zu Recht als melodienseligen Komponisten, als jemanden, der eingängig schreiben kann, verwechseln aber diese Begabung, Hits zu schreiben, mit leichter Schreibe. Puccini war jedoch ein extrem langsamer Arbeiter, viel langsamer als Verdi, ja sogar als Wagner. Er brauchte Zeit. Und das ging jeweils über die Uraufführungen heraus. Eine theatrale Situation musikalisch-dramaturgisch auf den Punkt zu bringen, daran feilte Puccini unentwegt.
Im Mittelpunkt der Handlung steht die Pariser Lebedame Magda. Sie, die Schwalbe des Titels, unternimmt einen kurzen Flug mit einem jungen Mann namens Ruggero aus der Provinz in die wahre Liebe. Schliesslich kehrt Magda jedoch wieder in den goldenen Käfig eines Pariser Bankiers zurück. Worum geht es für Sie in der Rondine?
Für mich geht es letztlich um die Frage, wie man ein erstes Verliebtsein in dauerhafte Liebe überführen kann. Das ist für uns alle ein fundamentales Thema. Auch für Puccini, der damals in einem fortgeschrittenen Alter war und eine veritable Midlife-Crisis als Italian Lover durchlebte. Ihm persönlich ist es zeitlebens nie gelungen, einen Flirt in tiefere Liebe zu verwandeln. Seine Frau Elvira lernte er kennen, als sie noch mit einem anderen Mann verheiratet war. Puccini lebte in wilder Ehe mit ihr und konnte sich das leisten, weil er ein anerkannter Komponist war. Als dann Elviras Mann starb, begannen die ganzen Affären Puccinis. Eine nach der anderen. Ohne den Reiz des Verbotenen ging es bei ihm offenbar nicht.
Die Magda der Rondine erzählt im ersten Akt von einer kurzen Affäre mit einem unbekannten Studenten, die jedoch nach einer intensiven Nacht bereits wieder zu Ende geht. Mit Ruggero sucht sie erneut dieses Gefühl…
Diese Reinszenierung oder dieses Reenactment, wie es in der Theaterwissenschaft heisst, ist ganz zentral für die Rondine. Nach ihrem emotionalen Höhenflug mit Ruggero muss Magda allerdings die komplette Desillusionierung erleben.
Gibt es für Sie so etwas wie eine charakteristische musikalische Sprache in La rondine, obwohl wir es mit einem hybriden Genre zu tun haben?
Ich möchte hier nochmals auf Verdis La traviata hinweisen, der die Rondine in Vielem folgt – inhaltlich allerdings mit einem wichtigen Unterschied: Die scheinbar so verachtenswerte Frau, Magda, muss am Ende nicht wie Violetta sterben, sondern darf aufrechten Hauptes weiterleben. Musikalisch übernahm Puccini von Verdis Traviata die Tanzrhythmen, die den gesellschaftlichen Rahmen für die Pariser Salons des 19. Jahrhunderts bilden. In der Traviata sind das der Galopp und der Walzer, in der Rondine der Walzer sowie modernere Tänze wie Foxtrott oder one-step. Puccinis Walzer sind opulenter als Verdis Walzer von anno 1853. Bei Puccini ist es dieser melancholisch-chromatisch aufgerauhte, sehr süffig orchestrierte Walzer des Rosenkavaliers. Da ist auch eine enge Verwandtschaft mit Ravels La Valse spürbar, die man als ein Symbol einer durch den Massenmord des Ersten Weltkriegs ruinierten Epoche lesen kann. Für mich hat die Musik der Rondine zwar etwas Leichtes, Filigranes und Träumerisches, gleichzeitig auch etwas Uneigentliches. Das hängt wesentlich mit dem Walzer zusammen, der als Modell seit der Fledermaus in jeder Operette anzutreffen ist und per se etwas Zitathaftes hat. Das wiederum entspricht auch inhaltlich der Idee des Reenactments, indem Magda die vergangene Liebesepisode mit dem unbekannten Studenten mit Ruggero zu wiederholen versucht. Das ist auch wieder ein Zitat. Magda lebt gewissermassen in ihrem eigenen Gefängnis, im Museum ihrer Erinnerungen – wie übrigens wohl wir alle.
Bei Puccini ist immer eine Spannung zwischen Handwerk, Tradition und Innovation zu beobachten. Wie innovativ ist Puccini in diesem Werk?
An der Oberfläche scheinbar nicht besonders, weil vieles in der Harmonik sehr eingängig daherkommt und auch in der taktmetrischen Gestaltung einen eher konventionellen Eindruck macht. Aber im Detail ist die Partitur sehr vielschichtig, sogar in den Harmonien. Man kann an vielen Stellen einen direkten Bezug zum Impressionismus von Debussy herstellen, nicht zuletzt, was die Instrumentation angeht. Bitonalität, Pentatonik – da ist alles drin. Ganz ähnlich wie der fast zeitgleich entstandene Tabarro, der unglaublich modern ist. Puccini hat sich intensiv mit den aktuellen musikalischen Strömungen seiner Zeit auseinandergesetzt. Für die italienische Erstaufführung von Schönbergs Pierrot lunaire setzte er sich extra ins Auto, um Schönberg zu begrüssen. Und schon 1908 nahm er die lange Reise von Budapest nach Graz auf sich, um sich dort Strauss’ Salome anzuschauen.
Ich höre auch Janáček in diesem Stück, besonders im letzten Akt.
Janáček und Puccini haben viel miteinander zu tun! Sowohl bei Janáček als auch beim späten Puccini ist zum Beispiel die Singstimme nicht immer das Primäre der musikalischen Erfindung. In Bezug auf die Rondine kann man das gut anhand der verschiedenen Fassungen beobachten: Puccini baut zuweilen in eine orchestrale Struktur nachträglich Stimmen ein oder lässt diese Stimmen in den nächsten Fassungen wieder weg. Die Partitur lebt von musikalischen Mikropartikeln, von einer Kurzatmigkeit der Melodik, die dann diesen für die Rondine so charakteristischen Parlandoton zur Folge hat.
Puccini war ein Detailfanatiker.
Er war Perfektionist, ja. Zum Glück, muss man sagen, sonst wären seine Opern nicht so gut.
Wie haben Sie übrigens zu Puccini gefunden? Gerade die deutsche Musikwissenschaft hat Puccini ja sehr lange verächtlich links liegen gelassen. Ist Puccini zu populär für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung?
Ich habe in den späten 1970er-Jahren in Frankfurt studiert, habe damals natürlich auch Adorno gelesen und mir das Vorurteil, Puccini sei Kitsch und leichte Muse, zunächst zueigen gemacht. Erst auf dem Umweg über Verdi habe ich verstanden, wie gut diese Stücke gearbeitet und alles andere als einfach gestrickt sind. In Puccinis Werken ist vieles sehr hart, pessimistisch, vielleicht sogar sarkastisch gestaltet, und das fasziniert mich.
Werden Sie eine Aufführung in Zürich besuchen?
Selbstverständlich.
Was erwarten Sie sich davon?
Ich hoffe, dass es den Sängerinnen und Sängern, dem Orchester und der Inszenierung gelingen wird, bei dieser Gratwanderung zwischen dickem postromantischem Pinselstrich und doppelbödiger Leichtigkeit den zündenden Funken dieses Stücks zu entfachen. Ich bin da sehr optimistisch.
Das Gespräch führte Kathrin Brunner
Anselm Gerhard ist emeritierter Professor für Musikwissenschaft an der Universität Bern. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört das europäische Musiktheater des 19. Jahrhunderts.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 104, September 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
La rondine
Synopsis
La rondine
Vorgeschichte
Magda, ein Waisenkind, wuchs bei einer alten Tante in Paris auf. Als sie siebzehn Jahre alt war, riss das schüchterne Mädchen für einen Abend aus und fand den Weg in das Café Bullier, ein Tanzlokal, in dem sich sowohl junge Studenten und Studentinnen als auch reiche Bankiers und vergnügungssüchtige Witwen treffen. An jenem Abend lernte Magda, als sie das Glück herausfordern wollte, einen jungen Studenten kennen, und beide verliebten sich ineinander. Doch Magda bekam plötzlich Angst vor ihrer eigenen Courage, liess Hals über Kopf den Studenten in dem Café zurück und rannte zu ihrer Tante zurück.
Seitdem sind viele Jahre vergangen, der Student ging ihr nie wieder aus dem Kopf, aber das Leben meinte es weniger romantisch mit ihr. Es blieb ihr verwehrt, einen eigenen Beruf zu ergreifen, und schliesslich musste sie aus ihrer Schönheit Kapital schlagen. Die reichen Herren der Pariser Gesellschaft schmückten sich nun mit ihr wie mit einer Trophäe, und so ging sie von Hand zu Hand. Nun ist sie schon längere Zeit die Kurtisane des Bankiers Rambaldo, der ihr ein luxuriöses Leben bietet. Sie schenkt ihm dafür ihren Körper, aber nicht ihre Gefühle.
Erster Akt
In der Wohnung, die Rambaldo ihr zur Verfügung stellt, gibt Magda de Civry, wie sie in der Pariser Gesellschaft heisst, einen Nachmittagsempfang. Die Gäste sind Rambaldo, seine Geschäftsfreunde und deren weibliche Begleitung, junge Frauen, denen es im Leben nicht anders ergangen ist als Magda. Eingeladen ist an diesem Nachmittag auch der Dichter Prunier, ein Bekannter aus den Zeiten, als sie noch in Künstlerkreisen verkehrte und Geld in ihrem Leben keine Rolle spielte. Prunier improvisiert vor den Gästen eine Romanze über die standhafte Doretta, die sich nicht vom König und seinem Reichtum verführen lässt. Als er inmitten seines Vortrags abbricht, erfindet Magda spontan den Schluss des Liedes. Doretta würde eines Tages in den Armen und im Kuss eines jungen Studenten ihr Glück finden. Alle sind beeindruckt und fast ein bisschen betroffen von der leidenschaftlichen und unerwarteteten Hingabe, welche die ansonsten so zurückhaltende Magda plötzlich an den Tag legt.
Ihren Freundinnen gegenüber verrät sie das Geheimnis, das hinter diesem Ausbruch liegt und erzählt ihnen die Geschichte aus ihrer Jugend, als sie für ein paar Stunden das Liebesglück mit dem jungen Studenten im Café Bullier entdeckte. Während sich die Frauen in einen Nebenraum zurückziehen, in dem der Dichter Prunier ihnen handlesend die Zukunft voraussagt, empfängt Rambaldo einen jungen Mann, den Sohn eines Geschäftsfreundes aus der südfranzösischen Provinz. Während Magda noch der Prophezeiung Pruniers nachhängt, ihr Leben werde wie das einer Schwalbe, einer «rondine», verlaufen, nämlich wie eine Reise zum Licht und zum Glück mit einer Rückkehr in eine ungewisse Zukunft, kümmern sich ihre Freundinnen um den jungen Provinzler Ruggero. Sie geben ihm Ratschläge, wo man am besten den ersten Abend in der Weltstadt Paris verbringt. Schliesslich ergreift das Dienstmädchen Lisette das Wort: Am besten amüsiere man sich im legendären Café Bullier. Plötzlich brechen alle Gäste auf, um sich in das nächtliche Paris zu stürzen.
Fast ohne es selbst zu bemerken, hatte Magda den jungen Ruggero beobachtet, und wieder steigen in ihr die Erinnerungen an das Erlebnis mit dem jungen Studenten auf, den sie damals im Café Bullier kennengelernt hatte. Noch einmal möchte sie in die Vergangenheit zurückkehren, den Moment von damals wiedererleben und sich in das Mädchen von damals verwandeln. Sie macht sich auf den Weg zum Café Bullier. Auch das Dienstmädchen Lisette hat an diesem Abend Ausgang. Sie hat sich mit dem Dichter Prunier verabredet. Sie ist, auch wenn er sich für sie geniert, seine Muse, die er liebt. Auch die beiden brechen auf, um in Paris auszugehen, wobei sich Lisette für den Ausgang heimlich am Kleiderschrank ihrer Herrin Magda bedient hat.
Zweiter Akt
Im Café Bullier begegnet Magda dem jungen Mann, den sie nur aus der Entfernung einige Stunden zuvor in ihrem Salon gesehen hatte. Er, Ruggero, hatte sie kaum wahrgenommen und erkennt sie nicht. Beide sind voneinander fasziniert, und der Zauber des Café Bullier beginnt zu wirken. Im Tanz finden sie zueinander und können nicht mehr voneinander lassen. Er fragt sie nach ihrem Namen, sie verschweigt nicht nur ihren wirklichen Namen, sondern gibt ihm auch weiter nichts von sich preis, während er ihr glücklich von dem Leben in seiner Heimatstadt Montauban erzählt. Beide treffen in dem Café ebenfalls auf Prunier und Lisette. Lisette glaubt ihre Herrin Magda zu erkennen, doch ist sie vollkommen verblüfft, als Ruggero sie als seine Freundin Paulette vorstellt. Alle vier geben sich ihren Illusionen und Träumen hin und stossen auf die Liebe an, oder vielmehr auf das Leben, das ihnen wiederum die Liebe schenkt.
Doch für Magda gibt es ein Erwachen, als sie bemerken muss, dass sie heimlich von Rambaldo beobachtet wird. Als es Prunier gelingt, Ruggero abzulenken, kommt es zur Auseinandersetzung zwischen Magda und ihrem Geldgeber Rambaldo. Doch in einem Akt der übermenschlichen Anstrengung sagt sie sich von Rambaldo und ihrem bisherigen Leben los. Sie möchte ihren Lebenstraum verwirklichen und mit Ruggero das Liebesglück erleben, nachholen, was sie vor Jahren versäumt hat. Rambaldo zieht sich zurück. Magda zittert in den Armen Ruggeros vor Glück und kann es kaum fassen, welchen Entschluss sie gerade gefasst hat.
Dritter Akt
Magda und Ruggero verbringen nun schon einige Wochen in einem Hotel in der Nähe von Nizza. Magda versucht noch immer, die Illusion des Glücks aufrecht zu erhalten, doch Ruggero ist realistischer und hat, ohne dass Magda es weiss, mit seinen Eltern Kontakt aufgenommen, damit sie ihm und seiner neuen Freundin finanziell aushelfen. An einem Spätsommermorgen unterrichtet er Magda schliesslich davon – und sagt sogar noch mehr, nämlich, dass er seine Eltern gebeten hat, einer Heirat mit ihr zuzustimmen. Magda, die nach wie vor verschweigt, welches Leben sie geführt hat, ahnt, dass ihr Traum vom grossen Glück bald enden wird. Während er ihr seinen Traum beschreibt, dem Leben in der Kleinstadt mit Haus und Garten und Kind, begreift sie, dass sie dieses Verhältnis beenden muss. Doch noch ist sie nicht bereit dazu. Prunier hat herausgefunden, wo sich Magda mit Ruggero aufhält, und will ihr helfen, wieder in ihr früheres Leben zurückzufinden. Er kommt mit der Nachricht von Rambaldo, dass er ihr vergeben würde und bereit ist, sie wieder wie früher zu «unterstützen». Prunier will Magda überzeugen, dass es das Richtige für sie sei, zu Rambaldo zurückzukehren. Auch er und Lisette hätten sich arrangiert, und er musste einsehen, dass er aus einer Frau, die sich zum Dienstmädchen geboren fühlt, nie eine Avantgarde-Künstlerin machen könnte. Magda bittet Prunier, sie mit diesen Ratschlägen zu verschonen. Eine vertraute Freundschaft findet ihr Ende.
Als Ruggero schliesslich überglücklich mit der Antwort auf sein Schreiben kommt, einem Brief seiner Mutter, die den Wunsch ihres Sohnes willkommen heisst, der sicher ein ehrsames und tugendhaftes Mädchen gefunden habe, bricht Magda endlich ihr Schweigen und macht Ruggero klar, dass sie sich trennen müssen. Sie habe ihn belogen und könne nie die Ehefrau sein, die er sich vorstellt. Obwohl sie sich lieben, löst sich Magda von Ruggero, der kaum begreift, was vor sich geht. Magda geht zurück in ihr früheres Leben, zurück zu ihrem luxuriösen Dasein, zu ihrem Schmerz und ihren Träumen… und schon scheint es, als wäre auch ihr Liebesglück mit Ruggero nur ein Traum gewesen.
Verfasst von Christof Loy