La forza del destino
Melodramma in vier Akten von Giuseppe Verdi (1813-1901)
Libretto von Francesco Maria Piave nach einem Drama von Angel de Saavedra
In italienischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 3 Std. 30 Min. inkl. Pause nach dem 1. Teil nach ca. 1 Std. 20 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Einführungsmatinee am 13 Mai 2018.
Partnerin Opernhaus Zürich 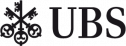
Vergangene Termine
Mai 2018
Juni 2018
Gut zu wissen
La forza del destino
Kurzgefasst
La forza del destino
«Die Welt spielt verrückt. Was sind das bloss für Zeiten!» Dieser Satz aus Fra Melitones Munde, dem brummeligen Mönch aus La forza del destino (Die Macht des Schicksals), könnte programmatisch für Giuseppe Verdis 1861 uraufgeführte Oper stehen. Tatsächlich ist die Welt in diesem Musikdrama arg aus den Fugen. Der knapp 50-jährige Verdi entwarf mit seinem gigantischen Melodrama ein schonungsloses Porträt einer von Kriegen geprägten, zerbrochenen Gesellschaft, in der Liebe, Zuneigung und Barmherzigkeit das Weltendunkel nur punktuell aufhellen.
Vor diesem Hintergrund bewegen sich die drei Hauptfiguren der Oper: Leonora, Don Alvaro und Don Carlo. Die Liebesbeziehung zwischen Leonora und Alvaro scheint von Beginn an zum Scheitern verurteilt zu sein – zu unterschiedlich sind ihre sozialen Positionen, als dass sie auf eine glückliche Erfüllung ihrer Liebe hoffen dürften. So ist der fatale Pistolenschuss zu Beginn des Dramas, der Alvaro zum unglücklichen Mörder von Leonoras Vater macht, wohl nicht allein ausschlaggebend für die unerfüllte Vereinigung des Paares. Genauso wenig hat das titelgebende «Schicksal» seine Hände im Spiel, wenn die Handlung auf ihr tragisches Ende zusteuert. Es ist vielmehr Leonoras Bruder Carlo, der durch seine verbohrte Rachsucht und seinen Hass eine mögliche Versöhnung immer wieder zerstört. Mit La forza del destino schuf Verdi eine seiner kraftvollsten und melodisch farbigsten Partituren. Dass sie in den Händen von Fabio Luisi einen idealen Interpreten findet, dürfte nicht erst seit seiner aufregenden Interpretation von Verdis Messa da Requiem deutlich geworden sein. Die grossformatige Anlage des Stücks ist auch für Regisseur Andreas Homoki wie geschaffen. Die horrend schwierigen Gesangspartien sind exquisit besetzt: Als Leonora ist zum ersten Mal an unserem Hause die abchasisch-russische Sopranistin Hibla Gerzmava zu hören, den Alvaro singt der Tenor Marcelo Puente und als Carlo ist der am Opernhaus bestens bekannte George Petean zu erleben.
Gespräch
Andreas Homoki und Fabio Luisi, La forza del destino ist Ihr erster gemeinsamer Verdi in Zürich. Warum ist Ihnen beiden dieses Stück wichtig?
Fabio Luisi: La forza del destino gehört ganz einfach zu den wichtigsten Werken von Verdi. Es ist ein komplexes und alle Kräfte herausforderndes Stück und wird von Dirigenten wie von Regisseuren gleichermassen gefürchtet.
Andreas Homoki: Stimmt das? Auch von Dirigenten?
F.L.: Durchaus. Eine grosse Herausforderung ist bereits die für Verdi ziemlich lange Spieldauer von zweieinhalb Stunden. Das Stück ist aus sehr vielen, mosaikhaft miteinander verbundenen Szenen aufgebaut und verlangt eine grosse Flexibilität des Dirigenten. Hinzu kommt, dass es gar nicht so leicht ist, den richtigen Ton, die richtige Farbe in diesem Stück herauszuarbeiten.
Sie sprechen die «Tinta musicale» an, die für ein Werk Verdis vorherrschende Klangfarbe. Verdi fand für jede seiner Opern eine eigene Klangfarbe. Was für eine Farbe hat dieses Stück?
F.L.: Im Prinzip ist es tiefschwarz, denn es handelt sich ja um eine tragische Geschichte. Aber das Stück hat, wie so oft bei Verdi, eine grosse geistige Verwandtschaft mit Shakespeare. Und genau wie bei Shakespeare gibt es auch hier immer wieder Momente des Lächelns, Momente, wo eine tieftragische Stimmung plötzlich in eine andere Richtung kippt, in das Heitere, Buffoneske, ja Ironische. Verdi verwendet dann einen leichteren Stil in der Art von Donizetti, der aber keinesfalls oberflächlich oder operettenhaft klingen darf. Das Tragische und das Buffoneske musikalisch unter einen Hut zu bringen und dennoch die Gegensätze scharf herauszuarbeiten, ist vielleicht die grösste Herausforderung für einen Dirigenten.
A.H.: Die Kombination von Tragischem und Heiterem ist wirklich bemerkenswert in diesem Stück und sorgt besonders in einem deutschsprachigen Rezeptionsumfeld immer wieder für eine gewisse Irritation. Hier herrscht ja oft die Meinung, dass, wenn man ernst ist, auch immer ernst bleiben muss. Komische Elemente in einem ernsten Kontext gelten dann als Verlust an Tiefe. Ich halte das aber für eine bedauerliche Beschränkung.
F.L.: Das sehe ich genau so. Im Grossen Saal des Leipziger Gewandhauses gibt es diesen lateinischen Spruch, «Res severa verum gaudium» – nur eine ernste Sache ist und beschert wahre Freude … Ein schrecklicher Satz!
Wie sieht denn dieser tragikomische Kosmos in La forza del destino aus?
A.H.: Den Kern dieser Geschichte bildet wie so oft bei Verdi eine Familie mit Vater, Tochter und Sohn. Erzählt wird ein ganz archaischer Konflikt. Leonora liebt Don Alvaro, der Vater Leonoras ist jedoch gegen diese Verbindung. Bei der missglückten Flucht der Liebenden kommt der Vater zu Tode, und die Familie ist auf einen Schlag zerstört, zumal es Leonoras Bruder Carlo nicht schafft, seine verletzte Ehre und tiefe Kränkung zu überwinden. Der Bruder, seine Schwester und ihr Geliebter finden keine Ruhe, bis am Ende die ganze Familie ausgelöscht ist. Diese tragische Individualerzählung kombiniert Verdi nun mit kollektiven Kriegsgenreszenen. Es tauchen episodisch anmutende Nebenfiguren auf, die auf den ersten Blick nichts zur eigentlichen Handlung beisteuern, aber dieses buffoneske Element ins Spiel bringen: Preziosilla, eine Soldatenbraut, der zwielichtige Händler Trabuco sowie der Mönch Fra Melitone, der eigentlich zur Welt des Klosters gehört, aber im dritten Akt ebenso in dieser Kriegslandschaft auftaucht.
Wie geht man als Regisseur mit diesen heterogenen Elementen um?
A.H.: Es ist genau so, wie es Fabio eingangs erwähnt hat: nur die tieftragische Seite dieses Stücks herauszuarbeiten, macht keinen Sinn. Man wird dem Stück auch nicht gerecht, wenn man als Regisseur glaubt, in den sehr ausladenden Kriegsszenen einen Kommentar zur Brutalität der heutigen Welt abgeben zu müssen, indem man versucht, möglichst schockierende Kriegsgräuel auf der Bühne abzubilden. In Forza gehört eben alles zusammen: das grosse Gefühl und das Triviale, Tragik und Komik. Diese Parameter machen das Stück insgesamt zu einer sehr grotesken Landschaft.
Diese Vielfarbigkeit widerspiegelt sich in einer eigenwilligen Dramaturgie, denn Verdi und seine Librettisten werfen die aristotelische Einheit von Ort, Zeit und Handlung wild über den Haufen. Die Geschichte ist zudem gespickt mit unglaubwürdigen Zufällen und Zusammentreffen. Der Oper wurde daher auch immer wieder zum Vorwurf gemacht, sie sei in ihrer Erzählform missglückt. Trifft das Ihrer Meinung nach zu?
A.H.: Nein. Nur muss man sich als Regisseur bei diesem Stück radikal von Standardlösungen verabschieden und sich Verdis dramaturgischer und ideeller Konzeption öffnen. Denn die musikalischdramatische Struktur, die Verdi geschaffen hat, lässt sich durch blosses Nachvollziehen der im Libretto beschriebenen Vorgänge nur sehr ungenügend abbilden. Verdi denkt in Forza letztlich immer in grossen szenischen Komplexen, in starken, theatralen Kontrasten. Ihn interessieren die Konflikte der Figuren und nicht, ob die Handlung im konventionellen Sinn immer vollkommen glaubwürdig ist. Es besteht allerdings die Schwierigkeit, dass Bruder, Schwester und Liebhaber bereits zu Beginn auseinandergerissen werden und bis kurz vor Ende nicht mehr zusammenkommen. Leonora verliert man dadurch während des gesamten dritten Aktes völlig aus den Augen, bis sich der Fokus erst wieder am Ende des vierten Aktes auf sie richtet. Da versuche ich als Regisseur ein wenig auszugleichen.
F.L.: Andererseits ist das auch interessant und von Verdi sicher mit Absicht so konstruiert. Jeder absolviert eben auf seine individuelle Weise seinen Leidensweg durch dieses apokalyptische Szenario. Am Ende treffen sich schliesslich alle zufällig im gleichen Kloster wieder, und es kommt zur finalen Katastrophe. Die einzelnen Fäden verschlingen sich erneut zu einem Knäuel. Darin äussert sich dann die Fügung des Schicksals …
A.H.: … oder eben die Macht des Schicksals, die Brutalität des Zufalls …
Eine Macht jedenfalls, die grösstmögliche Tragik hervorbringt: Leonora versucht in der Einsiedelei der Vergeltung ihres Bruders zu entgehen, wird aber von der schicksalhaften Kraft eingeholt. Ihr Liebhaber Alvaro sucht den Tod in der Schlacht als Feldherr, muss aber überleben, um in ihrem Bruder Carlo seinen eigenen Peiniger zu treffen. Und selbst als reuiger Mönch wird Alvaro später von Carlos’ Rachsucht eingeholt …
A.H.: Für mich kommt in diesem Stück letztlich ein nihilistischer Weltentwurf zum Ausdruck. Es ist eine Welt, in der sich alle gutgemeinten Bestrebungen im Leben als nichtig und sinnlos erweisen. Wir können uns auf einen gütigen Gott, wenn es ihn denn überhaupt gibt, nicht verlassen. In Forza waltet die pure Willkür, wenn man so will, ein böser Gott, letztlich vertreten durch die Autoren dieses Stücks, die diese Figuren mit der ganzen Lust am theatralen Konflikt aufeinanderprallen lassen. In unserer Aufführung wollen wir dieses Prinzip zusätzlich hervorheben, indem die drei Buffofiguren Preziosilla, Fra Melitone und Trabuco zu Spielmachern werden. Diese tauchen immer wieder auf und repräsentieren gemeinsam mit dem Chor eine Welt, die auf Leonora, Don Alvaro und Don Carlo einwirkt und sie zu ohnmächtigen Spielern in diesem Spiel machen, wie Flipperkugeln.
F. L.: Dadurch erhalten Preziosilla, Fra Melitone und Trabuco, die Verdi durchaus als Hauptfiguren verstanden haben wollte und für die er jeweils sehr charakteristische Musik geschrieben hat, eine zusätzliche, boshafte Schärfung. Die drei kommen mir grundsätzlich vor wie teuflische, verzerrte Gestalten aus einem GoyaBild. Fra Melitone ist in meinen Augen der Schlimmste: Ein Teufel im Priestergewand, der sich nur vordergründig gegenüber den Bedürftigen barmherzig gibt. Es sind Figuren, die eine direkte Verwandtschaft mit Oscar aus Verdis Maskenball aufweisen. Denn auch Oscar ist ja keineswegs eine solch putzige Gestalt, wie man ihn für gewöhnlich gerne sieht, sondern ein richtiges Monster, ein sexuell Besessener. Aber seine Musik wird meistens schön und elegant interpretiert, obwohl darin Boshaftigkeit steckt. Verdi hat das Element der Groteske wirklich wie kein Zweiter seiner Generation geliebt und verstanden.
Die Hauptfiguren sind in Ihrer Lesart also hilflose Spielbälle einer höheren Macht. Aber will uns Verdi nicht auch darauf hinweisen, dass die Gesellschaft in dieser Oper ein Stück weit selbst dafür verantwortlich ist, was hier geschieht? Zum Beispiel müsste Leonora nicht von zuhause fliehen, wenn ihr Vater von seinem Standesdünkel und seinen rassistischen Vorurteilen gegenüber dem Peruaner Don Alvaro ablassen würde. Und Carlo hätte doch immer wieder die Gelegenheit, seinen immensen Hass abzulegen. Gibt es kein Entrinnen aus der Unglücksspirale?
A.H.: Nicht in diesem Stück, nicht in diesem System. Hier läuft alles mit einer unerbittlichen Notwendigkeit ab. Für mich kommt dadurch eine philosophische Vorstellung zum Ausdruck, nach der wir alle Gefangene einer Welt sind, in der wir nur sehr begrenzt Einfluss auf unsere Geschicke nehmen können.
F.L.: Auch musikalisch gesehen waltet hier die Unentrinnbarkeit. Verdi arbeitet mit einer beinahe schon Wagnerschen Leitmotivik, mit charakteristischen Zellen, mit melodischen Verwandtschaften, die sich von Anfang an wie ein Netz durchs ganze Stück ziehen. La forza del destino ist, was die Musik angeht, eine der kohärentesten Opern Verdis.
Die Heilsverheissung Gottes wird also zumindest in Frage gestellt, und dennoch nimmt in keiner anderen Oper Verdis die Kirche einen grösseren Raum ein als in La forza del destino. Das mutet paradox an. Wie hat Verdi die Kirche insgesamt wahrgenommen?
F.L.: Wie sich bereits in der Figur von Fra Melitone zeigt, hat Verdi den Klerus gehasst. Er hat dem System der Kirche, dem institutionalisierten Katholizismus insgesamt misstraut.
Widerspiegelt sich diese negative Sicht auch in der Figur des Padre Guardiano?
A.H.: Dieser Padre Guardiano ist anders – eine Figur, die irgendwie über allem schwebt und nicht in die Geschichte verstrickt ist. Jemand, von dem man sich auch im eigenen Leben wünschen würde, dass er ab und zu bei einem vorbeischaut. In seinem Verhalten gegenüber Leonora ist er sehr väterlich und liebevoll, so, wie sich Leonora ihren Vater wünschen würde. Bereits sehr früh entstand daher die Idee, Guardiano und Leonoras Vater zu einer einzigen Figur zu verschmelzen. In Guardiano erfüllt sich Leonoras grosse Sehnsucht nach Vergebung, die sie von ihrem toten Vater nicht mehr bekommen kann. Aber es gibt in diesem Stück keine Erlösung, die von aussen kommt. Verdi scheint uns zu sagen, dass wir diese nur in uns selbst finden können. Wir nehmen daher auch Leonoras Zufluchtsort, die Einsiedelei, nicht wörtlich, sondern als ein Sinnbild für ihre Einsamkeit.
F.L.: Alle Figuren sind alleine in dieser Oper. Alvaro, weil er nicht zu diesem Kulturkreis gehört, Calatrava, weil er in seinem Dafürhalten von der Tochter im Stich gelassen wurde, Leonora, weil sie weder in der Familie noch bei ihrem Geliebten, der den Vater ermordet hat, Halt finden kann. Und Don Carlo ist allein gelassen in seiner blinden Wut und seinen Rachegelüsten.
Das Gespräch führte Kathrin Brunner.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 59, Mai 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Volker Hagedorn trifft …

Hibla Gerzmava
Ein Königinnengesicht hat sie, mit etwas Sphinx darin, nicht aus der Ruhe zu bringen, aus bernsteinfarbenen Augen in eine Weite blickend, die fern ist vom schmucklosen Appartement mit Küchenzeile gegenüber dem Dresdner Zwinger. Gut 2 000 Kilometer sind es von hier bis zur Ostküste des Schwarzen Meeres, wo Hibla Gerzmava zur Welt kam, knapp 1 700 Kilometer sind es bis Moskau, ihrer Basis, aber nur dreihundert Meter bis zur Semperoper, wo sie am Abend vorher als Desdemona in Verdis «Otello» bejubelt wurde.
Bis in den letzten Winkel des ausverkauften Hauses ist da ihre aussergewöhnliche Stimme gedrungen, hell, glühend, fokussiert, aber auch mit vibrierenden Abgründen, voller würziger Farben und aus einem eigenen Seelenraum heraus. Gestern Abend, sage ich, hätte die Oper eigentlich Desdemona heissen können.
«Thank you», sagt sie mit eher tiefer, rollender Stimme. Sie hat es sich auf der Couch bequem gemacht, ein paar Stunden vor dem Abflug nach Zürich und zwischen zwei sehr verschiedenen Rollen. Ich habe gelesen, dass sie mitunter Tage brauche, um aus der Identifikation mit einer Rolle wieder aufzutauchen. Kann sie so schnell umschalten zur Leonora in Verdis La forza del destino, die sie in Zürich erstmals singt? Sie antwortet auf Russisch. «Zum Umschalten ist diesmal keine Zeit», sagt ihre Managerin Julia Goldman auf Englisch, eine schmale, junge Frau mit grossen Augen hinter der Brille. Aber Desdemona habe sie nach vielen Produktionen so «in Herz und Geist», dass sie beide Gestalten verbinden und «mit derselben Stimme die unterschiedliche Energie der beiden Mädchen» gestalten könne. Sie nennt alle ihre Rollen «Girls».
Wie geht sie damit um, wenn ein Partner wie Otello mal nicht ganz so aufregend ist? Diplomatischer gefragt: Welchen Einfluss haben wechselnde Bühnenpartner auf ihre Gestaltung? «I’m a very happy woman, I have every performance a new Otello», antwortet sie ebenso diplomatisch und ergänzt auf Russisch, dass wechselnde Partner innerhalb einer Produktion schon eine professionelle Herausforderung seien. Besonders beglückt habe sie die Dresdner Premiere mit José Cura im März, «so einen Otello hatte ich nie zuvor. Natürlich respektiere ich alle Kollegen, aber sie sind sehr verschieden. Es hängt vieles von der Energie ab, die man vom Partner bekommt. Aber das wichtigste ist das Drama, die grosse Linie, das Gefühl der Liebe auf der Bühne. Ich kann alles machen, wenn das da ist. Dann ist das Atmen wie ein Wasserfall.»
Gesungen hat Hibla Gerzmava schon als Kind, 1970 geboren im Küstenstädtchen Pitsunda in Abchasien am Schwarzen Meer. Der Ort wurde fünfhundert Jahre vor Christus als griechischer Kolonialhafen gegründet, im 10. Jahrhundert entstand dort die schöne, noch byzantinisch geprägte Kathedrale, in deren unmittelbarer Nähe Hibla aufwuchs, die Tochter des Mannes, der den florierenden Tourismus im Ort beaufsichtigte. «Die Gegend war ein sehr beliebtes Urlaubsziel», sagt sie, «es kamen auch viele Deutsche.» Ihre Eltern waren ambitionierte Musikamateure. «Wir sangen polyphone abchasische Musik mit drei bis sechs Stimmen.» Mit fünf Jahren bekam sie Klavierunterricht, «es war der Traum meiner Mutter, dass ich Pianistin werden sollte.» Aber ihre Mutter starb, als Hibla sechzehn Jahre alt war, zwei Jahre später folgte der Vater. «Immer, wenn ich das Requiem von Verdi singe», sagt sie, «widme ich es meinen Eltern.» Es wäre ihnen sicher recht, dass aus ihrer Tochter eine der gefragtesten BelcantoSängerinnen der Gegenwart wurde.
Aber wie kam es dazu? «Ein Lehrer entdeckte, dass ich eine gute Stimme hatte, und so ging ich zum Studium nach Moskau ans Konservatorium», erklärt sie, als sei das die einfachste Sache der Welt. Jedenfalls entwickelte sich in Moskau, wo sie seitdem lebt, ihre Stimme so erfreulich, dass die junge Sängerin im Jahre 1994 am Internationalen TschaikowskiWettbewerb teilnahm. Weder Geiger, Cellisten noch Pianisten konnten in dem Jahr einen ersten Preis erringen, wohl aber, zum ersten und bis jetzt einzigen Mal in der Geschichte des Wettbewerbs, eine Sängerin. Und das war Hibla Gerzmava. Das Programm hat sie immer noch im Kopf: «In der letzten Runde die Rosina aus dem Barbiere, die Amalia aus I masnadieri und das Schneeflöckchen von RimskiKorsakow.» Nach diesem Grand Prix fand die Sängerin ihr erstes Haus: Das Moskauer StanislawskiTheater, eine der wichtigsten Bühnen Russlands, deren Operndirektor Alexander Titel für die Sängerin zu einem «zweiten Vater» wurde und viele Produktionen eigens für sie konzipierte. «Da bin ich gross geworden», sagt sie, «aber die internationale Karriere begann in London.» 2008 war das, als sie in Covent Garden die Tatjana in Eugen Onegin sang und ihr Sohn neun Jahre alt war – er studiert jetzt in New York. Dorthin, an die MET, kam sie 2010 mit gleich zwei Frauenrollen in Hoffmanns Erzählungen, später auch als Desdemona, Mimì, Liù und Donna Anna. Dort lernte sie auch Fabio Luisi kennen, «und er sagte mir, dass er mich gerne nach Zürich einladen würde.»
Er hielt Wort. Mit Forza ist für sie auch stimmlich ein neuer Abschnitt der Sängerlaufbahn erreicht – und ein anderer abgeschlossen. «Letztes Jahr habe ich mich von La traviata verabschiedet, im Bolschoi.» Warum? «Weil es nicht mehr gut für meine Stimme wäre. Ich kann das singen, aber ich sollte nicht. Ich singe auch Hoffmanns Erzählungen nicht mehr. Eine Sängerin sollte klug sein und wissen, wann sie mit etwas aufhört. Ich begann als Koloratursopran, jetzt bin ich ein lyrischer Sopran mit guter Höhe», sagt sie und lacht ein bisschen, während Julia das übersetzt. «Der nächste Level für mich, das könnten Bellinis Norma und die Leonora in Verdis Trovatore sein.» Sie achtet sorgsam auf ihr kostbares Instrument, aber ihre Heldin ist dennoch eine, die nicht so vorsichtig war – Maria Callas, «weil sie zugleich eine grosse Schauspielerin und Sängerin war. Ich bewundere die Sänger jener Zeit. Einen zweiten Tenor wie Mario del Monaco wird es nicht geben.» Ich erwähne, dass Riccardo Muti schon vor achtzehn Jahren klagte, es fehle an guten Sängern für Verdis Opern. «Muti hat recht», sagt Hibla Gerzmava, «noch immer. Es liegt daran, dass heute Sänger mit kleinen Stimmen denken, sie könnten sie zu grossen Stimmen ausbilden lassen…»
Sie blickt wieder in die Ferne, während draussen eine Strassenbahn dröhnt. Woher kommt ihre Liebe gerade zur italienischen Oper? «Ich komme aus dem Süden, und alle Leute aus dem Süden sind einander ähnlich, in ihrer Energie und Emotion. Ich fühle mich aber als russische und abchasische Sängerin. Ich habe auch ein Festival in Abchasien, das ist wie ein Baum mit Wurzeln.» Da ich mich in Eurasien nicht auskenne, frage ich, zu welchem Staat ihre Heimat gehört. «Sie mag keine Politik», sagt Julia entschuldigend.
Jetzt ist aber erstmal Zürich ihr Zuhause. Sie mag die Proben mit Andreas Homoki. «Es ist wichtig, dass der Regisseur selbst zeigt, was der Solist tun soll. Ich komme immer gut vorbereitet als Musikerin und als Schauspielerin, und es ist interessant, das mit Regieideen zu kombinieren und auch zu ändern.» Sie hebt die Hände und beschreibt eine Kugelform. «Ich möchte aus Leonoras Situation, ihrem Schicksal gern einen Energieball formen. Man kann vom Anfang bis zum Ende der Oper ihr ganzes Leben zeigen.» Und später? Nicht doch mal etwas Russisches jenseits von Tschaikowskis Tatjana? «Das ist für meine Stimme nicht geeignet», meint sie. «Ausser, wenn ich sehr alt bin… die alte Gräfin in Pique Dame!» Bei dieser Vorstellung muss sie wirklich lachen, die Königin mit den bernsteinfarbenen Augen. Denn Frauen wie sie altern ja nicht. Sie folgen nur ihrem Geheimnis. Und nur auf der Bühne kann man davon erfahren.
Text von Volker Hagedorn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 59, Mai 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Die Macht des Schicksals
Was an der Premiere 2018 geschah...
Gespräch
Alles Zufall?
Giuseppe Verdis Oper «La forza del destino» trägt das Thema schon im Titel – die Macht des Schicksals. Bestimmen wir selbst über unser Leben, oder wird es vom Spiel des blinden Zufalls gelenkt? Ein Gespräch mit dem Philosophen und Journalisten Georg Brunold, der über den Zufall nachgedacht hat wie wenige andere.
Herr Brunold, hatten Sie heute bereits ein Erlebnis, das Sie als «zufällig» beschreiben würden?
Zufällig ist so gut wie alles im Leben. Bereits Ihr Besuch bei mir ist hochgradig zufällig, sogar ein äusserst unwahrscheinliches Ereignis, wenn man bedenkt, welche Unmengen von notwendigen Bedingungen seit dem Urknall für eine solche Begegnung erfüllt sein müssen. Der Zufall ist jedenfalls ein ergiebiges und ein ebenso erfreuliches Thema. Und falls jemand den Zufall nicht mag, wird er sich in der Beschäftigung damit mit ihm versöhnen.
Der Zufall ist also etwas Positives.
Wir wollen das Schlusswort nicht vorwegnehmen, aber man kann sich nichts Abscheulicheres vorstellen, als eine Welt ohne Zufall. Das wäre der absolute Albtraum.
Was bedeutet denn Zufall genau?
Zufall im allgemeinsten Sinne ist das, was auch anders sein könnte. In der Philosophie nennt man das «Kontingenz», das heisst Möglichkeit, die als Kategorie der Notwendigkeit gegenübersteht, alles, was nicht notwendig ist und auch anders sein könnte. Fast alles könnte natürlich anders sein, wird man jetzt sagen, nur heisst das nicht, dass es beliebig anders sein könnte. Die Naturgesetze gelten immer. Falls etwas gegen die Naturgesetze verstösst, kann es sich nur um ein Wunder handeln.
In Verdis Oper La forza del destino gibt es einen Moment, in dem der Zufall zuschlägt: Der Protagonist wirft eine Pistole auf den Boden, und es löst sich ein Schuss, der den Vater der Protagonistin tötet. Das ist umso fataler, als der Liebhaber der Protagonistin die Pistole mit den Worten «sieh her, ich bin unbewaffnet» als ein Zeichen des Friedens weggeworfen hatte. Wie beurteilen Sie diesen Vorgang?
Die Leute werden geneigt sein anzunehmen, dass so etwas ja gar nicht sein kann. Als einzelnes Vorkommnis wirkt es in einem grotesken Grad unwahrscheinlich. Das kann dem Autor nicht entgangen sein. Der Vorfall hat natürlich Gleichnischarakter und deutet an, dass Zufall oder Schicksal eben schlechterdings alles können, was sie wollen. Wissenschaftlich muss man sagen: Unmöglich ist es nicht. Aber ein Sechser im Zahlenlotto, wenn nur eine einzige Person einen einzigen Tipp abgäbe, wäre nicht wahrscheinlicher.
Dass sich ein Schuss aus einer Pistole löst, ist aber doch gar nicht so unwahrscheinlich. «Murphys Law» besagt etwa, dass alles, was schiefgehen kann, auch irgendwann schiefgehen wird...
Irgendwann, ja. Wenn fünf Millionen Leute je fünfzig Mal ihre Pistolen hinschmeissen...
Wurden denn die Menschheitsgeschichte oder historische Ereignisse nicht immer wieder von absurden Zufällen geschrieben? Ich denke auch an wissenschaftliche Erfindungen wie das Penicillin, die Teflonpfanne oder den Pneu...
Sicher. Dabei ist das Glück oder eben der Zufall dem hold, der darauf vorbereitet ist, wie der Mikrobiologe Louis Pasteur gesagt hat – und vor ihm schon Machiavelli. Es kommt darauf an, die Gelegenheit zu erkennen, wenn sie kommt, und sie nicht zu verpassen. Dieses Zusammenspiel ist es, das die Erkenntnis und andere Fortschritte voranbringt. Von der unausgesetzten, nimmermüden Suche hängt alles ab, und wer beharrlich genug sucht, stösst dabei zumindest auf ganz andere Dinge als die gesuchten. Wir haben dafür den magisch klingenden Begriff «Serendipity».
Als ich zu Ihnen fuhr und den Anschluss verpasste, weil der Zug Verspätung hatte, traf ich eine Dame, die an den genau gleichen Ort musste. Wir teilten uns ein Taxi. Was für ein Zufall, befand ich. Die Dame entgegnete, das sei kein Zufall, sondern Glück, das einem zufalle...
Vieles «fällt» im Zusammenhang mit dem Zufall, vieles fällt auch «aus» – und «ab»...
...und «auf»...
Das Verb «auffallen» ist ein Schlüsselwort im Zusammenhang mit dem Zufall. Denn im Grunde genommen ist alles, was sich ereignet, im selben Masse absolut unwahrscheinlich. Wirklich exakt im selben Mass. Nur fällt nicht alles auf.
Können Sie ein Beispiel geben?
Sie denken an jemanden, und derjenige ruft Sie genau in diesem Moment an. Das ist natürlich ein sehr auffälliges Zusammentreffen und kann deshalb fast nicht zufällig sein, glauben Sie. Da muss etwas anderes im Spiel sein! Aber wenn Sie um 9.47 Uhr an jemanden denken, und dieser ruft Sie um 15.43 Uhr an, dann ist diese Konstellation nicht weniger zufällig und auch nicht weniger unwahrscheinlich, als wenn er im selben Augenblick anrufen würde. Oder nehmen Sie ein fabrikneues Kartenspiel von 52 Karten. Wenn Sie das gut mischen, ist die Zahl der möglichen resultierenden Kartensätze 10 hoch 68. Hätten Sie ein Kartenspiel von 62 Karten, wäre die Zahl möglicher Blätter, möglicher Anordnungen dieser 62 Karten, bereits grösser als die Zahl der Atome im Universum. Jedes Blatt, das hier liegt, ist genau gleich unwahrscheinlich, wie wenn zum Schluss ein Kartensatz in exakt der gleichen Ordnung auf dem Tisch liegt, wie Sie ihn ausgepackt haben: Herz Ass bis zur Zwei, Kreuz Ass bis zur Zwei – das wäre doch ziemlich unwahrscheinlich, wenn Sie nach fünf Minuten Mischen erneut ein solches Anfangsblatt hätten...
Da würde man zumindest den Kopf schütteln.
Genau wie im Zahlenlotto nur selten jemand die Zahlenreihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6 ankreuzt, obwohl die Wahrscheinlichkeit, damit einen Sechser zu machen, nicht kleiner ist als mit jeder anderen Zahlenkombination. Und das ist ein Modell für jede Art von Ereignissen. Nur dass die Ereignisse in sehr unterschiedlichem Masse auffällig sind. Wir erwarten vom Zufall eine einigermassen unauffällige Aufführung. Wir erwarten, dass er sich ein bisschen zufällig und nicht allzu unzufällig – unwahrscheinlich, heisst das – gebärdet, denn «unwahrscheinlich» neigen wir mit «unzufällig» gleichzusetzen, und da kann dann eben nur etwas anderes im Spiel sein.
Und hier kommen wir zum Schicksal...
Genau. Die Unglaublichkeit oder eben die plötzlich sichtbar gewordene Unwahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses lassen sich in unseren Augen dann einfach nicht mehr dem Zufall zuschreiben. Wenn der Zufall zu merkwürdige, zu bösartige, zu heftige Ergebnisse erzielt, muss etwas anderes der Grund dafür sein. Der Zufall ist immer wieder einmal zu wild am Werk, als dass er sich so ohne Weiteres schlucken liesse, unsere Überraschung hindert uns daran.
Dafür haben die Menschen dann das Wort «Schicksal» erfunden.
Ich glaube nicht, dass sie es dafür erfunden haben. Den heutigen philosophischen Zufallsbegriff gibt es seit den alten Griechen, seit Aristoteles, würde ich sagen – das Schicksal ist wahrscheinlich sehr viel älter, hat sich aber bis heute gehalten, und zwar durch sämtliche Wendungen der Geistesgeschichte. Das Schicksal geistert als ein Element in praktisch jedem bisher bekannten Weltbild herum. Das Wort ist sehr heterogen in seiner Bedeutung, changiert zwischen der Bestimmung durch höhere Mächte und dem Spiel des blinden Zufalls. Der Begriff des Schicksals ist überhaupt sehr schwer zu fassen. Was sich durch die Jahrtausende seiner mäandernden Karriere hält, ist wohl die Unverfügbarkeit für den Menschen. Schicksal ist, worauf wir keinen Einfluss haben.
Im Schicksalsbegriff schwingt also immer das Bewusstsein der eigenen Handlungsunfähigkeit und Ohnmacht mit?
Ich denke schon. Man kann dem Schicksal leider auch durch Fügsamkeit nachhelfen, man schickt sich in es, sagt man, und dann gibt es auch die Geschichte mit der sich selbst bewahrheitenden Prophezeiung, die eintritt, weil man daran glaubt...
... wie Leonora in Verdis La forza del destino, die bereits vor dem ersten Unglück davon redet, ein Opfer des unerbittlichen Schicksals zu sein. Einsam und alleine werde sie durch die Lande ziehen müssen – und genau das trifft dann auch ein.
Auf der Bühne herrscht seit der griechischen Antike grundsätzlich viel Schicksal, nicht wahr, diese tragische Unentrinnbarkeit, von Euripides bis Goethe, bis Beckett. Fast könnte man im Schicksal eine Erfindung des Theaters sehen. Wobei darin vermutlich auch die Katharsis zum Zug zu kommen hat: Dem Publikum soll über eigene Schläge hinweggeholfen werden, es soll gezeigt werden, dass die lieben armen Menschen damit nicht allein sind.
Wann und warum hadert man mit dem Schicksal oder dem Zufall?
Wahrscheinlich, wenn es Menschen schwerfällt, über ein Unglück hinwegzukommen und sie immer wieder darauf zurückkommen. Im Bemühen zu verdauen wird wiedergekäut, vor allem, wenn solche Schläge in Serie auftreten. Möglicherweise ist hier ein Selbstverstärkerprozess am Werk: Unverdaulichkeit durch hartnäckiges Verdauen. Und Glück und Pech kommen ja meistens in «Launen», in «Sprüngen» oder in «Strähnen» und nicht mit schön geordneter Regelmässigkeit. Werden Menschen von einer Serie von Unglücksmomenten gebeutelt, sind sie entkräftet und denken nicht mehr besonders klar und gradlinig. Wer entkräftet ist, neigt ausserdem dazu, die Waffen zu strecken. Das geht dann in Richtung Fatalismus und Pessimismus und drückt sich in der Haltung aus, dass man sowieso nichts dagegen tun kann. Schlimmer noch, wenn man als Handelnder selber daran beteiligt war. Wo eigenes Verschulden im Spiel ist, wird alles nur ärger.
Vielleicht wird dann auch ein Sündenbock gesucht. Ist das auch mit ein Grund dafür, dass die Menschen personifizierte Schicksalsmächte erfunden haben? Bei den Griechen sind das die Tyche und die Moiren, bei den Römern Fortuna und die Parzen...
Das gilt in einem stark erweiterten Sinn. In der kognitionswissenschaftlichen Literatur etwa ist sehr viel die Rede davon, dass die Evolution uns dahingehend präpariert haben muss, hinter allem Akteure zu vermuten. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sich in einem Laubwald auf einen Stein setzen und hinter Ihnen raschelt es? «Achtung, Schlange!» hoffe ich, denn besser denken Sie nicht zuerst an einen harmlosen Windstoss. Es gehört zu unserem überlebensnot wendigen Alarm system, allenthalben Akteure anzunehmen, vor denen wir uns davonmachen können – Akteure mit Absichten und Zielen, auch wenn wir sie nicht sehen. Im Prozess der Evolution hat sich das verallgemeinert, schloss auch Phänomene wie den Donner usw. ein. Die Vielzahl der Götter, die ganze Belegschaft des Olymps, wird von den Evolutionstheoretikern und gewissen Religionswissenschaftlern also als ein natürliches Phänomen erklärt.
Gott würfelt nicht, soll Albert Einstein einmal gesagt haben. Was steckt hinter diesem berühmten Zitat?
Einstein war schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts damit konfrontiert, dass in inneratomaren Vorgängen und in der Quantenwelt Zufallsprozesse am Werk waren. Dagegen wehrte er sich nach Kräften und glaubte, dass auch da nichts ohne Ursache geschieht. Die Ursache dafür habe man bloss noch nicht entdeckt. Er irrte sich. Heute und schon länger besteht Konsens darüber, dass er damit Unrecht hatte.
Also regiert der Zufall die Welt.
Nicht allein, aber er regiert mit. Der Zufall schafft Fakten, die dann «unzufällig» weiterwirken. Oft regiert der Zufall in einer erschreckenden Art und Weise, weil er eben vieles nicht ausschliesst und uns um einen Haufen Sicherheiten bringt, auf die wir uns gerne verlassen hätten. Aber das heisst nicht, dass schlimme Ereignisse in der Menschheitsgeschichte in jedem Fall dem Zufall zuzuschreiben wären. Böses kann durchaus auch Menschenwerk sein. Wie gesagt wäre für mich aber das Schlimmste, das man sich vorstellen kann, ein Universum, in welchem schlechterdings gar nichts dem Zufall überlassen bliebe. Dann wäre die gesamte Menschheitsgeschichte in der ersten Milliardstel Sekunde nach dem Urknall bereits festgestanden. Eine absolut groteske Vorstellung! Aber in der Physik gibt es zwingende Einwände dagegen, nur schon weil in der materiellen, physikalischen Welt nichts unendlich genau ist. Die Annahme, Ereignisse seien allesamt exakt vorherbestimmt, setzt deren unendliche Präzision voraus. Doch überall sind Spielräume, an denen wir uns freuen können. Die in der mikrophysikalischen Welt zeigen sich in der makrophysikalischen. Schon der Zeitpunkt, wann ein Wassertropfen am Wasserhahn abreisst, lässt sich nicht mit beliebiger Genauigkeit voraussagen. Das Sein aller Materie bedeutet Unschärfe und Vagheit. Der Determinismus, wonach alles vorbestimmt sein muss, ist jedenfalls längst erledigt. Diese Schlachten sind gewonnen, auch wenn dieses empörende und erschütternde Weltbild aus dem 19. Jahrhundert derzeit etwa durch die Hirnforscher wieder stark gemacht wird...
... im Zusammenhang mit der Frage nach der Freiheit des Willens und der Frage, wie unabhängig oder eingeschränkt wir in unseren Entscheidungen sind.
Ja. Aber auch da stellt sich sofort die Frage, worum es sich beim freien Willen denn überhaupt handelt und wo genau die Freiheit liegt. Nur dadurch, dass unsere Handlungen in einem naturwissenschaftlichkausalen Sinn nicht vorherbestimmt sind, kommt man dem freien Willen nicht näher. Indeterminismus heisst ganz einfach, dass nicht alles lückenlos kausal verursacht ist. Aber der Zufall allein kann es ja auch nicht sein, dem wir unsere Freiheit verdanken. Sonst hätten wir ein Bild von einem Willen, der einem Schlottergelenk gleicht, in welchem der Schalthebel einmal nach links und dann wieder nach rechts springt, rein zufällig gewissermassen. Und unsere Handlungen, das würde daraus folgen, wären dann gar nicht mehr verursacht. Doch Willensakte und die durch den Willen gesteuerten Handlungsabläufe gehorchen durchaus regelhaften Verknüpfungen von Ursachen mit Wirkungen, wobei man bei Handlungen eher von Gründen und Folgen spricht. Unsere Geschicke und unser Schicksal liegen sicher nicht allein in unserer Hand. Doch dank unseres Willens können wir darauf Einfluss nehmen, auf sie einwirken und sie mitgestalten.
Das Gespräch führte Kathrin Brunner.
Georg Brunold ist promovierter Philosoph.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 59, Mai 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Fragebogen

J’Nai Bridges
J’Nai Bridges gewann 2016 den renommierten Francisco-Viñas-Wettbewerb sowie 2018 die Sphinx Medal of Excellence. Sie war Mitglied des Opernstudios von Chicago. In jüngerer Zeit debütierte sie als Bersi («Andrea Chénier») an der San Francisco Opera und der Bayerischen Staatsoper sowie als Nefertiti (Glass’ «Akhnaten») in Los Angeles.
Aus welcher Welt kommen Sie?
Ich stamme aus Lakewood, Washington. Das ist etwa 45 Minuten südlich von Seattle.
Was wollten Sie als Kind unbedingt werden?
Kinderärztin und Psychologin, weil ich die Menschen verstehen und ihnen helfen wollte.
Worauf freuen Sie sich bei La forza del destino am meisten?
Ich freue mich darauf, diese Oper zum Leben zu erwecken! Vom Gesang über die Inszenierung bis zu den Kostümen – ich kann es kaum erwarten, Preziosilla zu verkörpern. Sie ist eine wunderbare Figur mit toller Musik. Was für ein Glück, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann!
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Als ich mich in meinem ersten Jahr am College mit französischer Musik beschäftigte, veränderte sich mein Zugang zu klassischer Musik völlig. Ich war sehr angetan von Debussy und Milhaud, besonders von den JazzEinflüssen in ihrer Musik. Mit Jazz bin ich aufgewachsen, und so fühlte es sich für mich ganz natürlich an, diese Musik zu singen. Damals wurde mir bewusst, dass der Unterschied zwischen klassischer Musik und Jazz gar nicht so gross ist.
Welches Buch würden Sie niemals aus der Hand geben?
Ich kann mich nicht für ein einziges Buch entscheiden, hier also zwei meiner Favoriten: Einfach lieben von Thich Nhat Hanh und Eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari.
Welche CD hören Sie immer wieder?
Alles von Ella Fitzgerald!
Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?
Ein echtes Laster: Ich liebe meinen Fernseher. Wenn ich nicht aufpasse, schaue ich viel zu lange.
Mit welchem/r Künstler/in würden Sie gerne einmal essen gehen?
Mit Leontyne Price! Sie ist eines meiner grössten Vorbilder. Ich würde mit ihr über alle Aspekte ihrer Karriere sprechen wollen – Ruhm, Musik, Familie –, und mich über alles freuen, das sie mit mir teilen möchte. Und vielleicht würde sie mir auch verraten, was sie am liebsten isst und trinkt!
Wie kann man Sie beeindrucken?
Indem man nicht versucht, mich zu beeindrucken, sondern leidenschaftlich ist und hart arbeitet für etwas im Leben.
Worüber können Sie nicht lachen?
Rassismus.
Was können Sie überhaupt nicht?
Fallschirmspringen. Ich könnte es zwar, aber will ich das? Auf keinen Fall.
Haben Sie einen musikalischen Traum, der wohl nie in Erfüllung gehen wird?
Ich glaube daran, dass ich alle meine musikalischen Träume verwirklichen kann. Am schwierigsten wird es wahrscheinlich, mit der Popsängerin Beyoncé aufzutreten. Aber ich bin zuversichtlich.
Nennen Sie drei Gründe, warum das Leben schön ist!
Liebe, Kunst und neue Dinge zu entdecken!
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 59, Mai 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
La forza del destino
Synopsis
La forza del destino
Erster Akt
Leonora di Vargas liebt Alvaro. Ihr Vater, der Marchese di Calatrava, akzeptiert die Verbindung aufgrund dessen fremder Herkunft nicht. Er überrascht die Liebenden während ihrer Flucht. Als sich der bewaffnete Alvaro ergeben will, löst sich ein Schuss und verletzt den Marchese tödlich. Im Sterben verflucht er seine Tochter.
Zweiter Akt
Leonora und Alvaro verlieren sich auf der Flucht aus den Augen. Leonora ist heimatlos. Als Mann verkleidet, flieht sie vor der Rache ihres Bruders Carlo. Dieser trifft auf Preziosilla, die Soldaten für einen Krieg anwirbt. Carlo gibt sich als Student aus. Doch Preziosilla durchschaut ihn und sagt ihm ein furchtbares Ende voraus. Carlo erkundigt sich nach dem Fremden, der ihm auf gefallen ist. Es ist Leonora. Sie entkommt, noch bevor ihr Bruder sie entdecken kann.
Leonora bittet Padre Guardiano um Aufnahme in ein Kloster. Sie erhofft dadurch die Vergebung zu erhalten, die ihr ihr verstorbener Vater nicht mehr geben konnte.
Dritter Akt
Alvaro ist als Hauptmann unter neuem Namen in den Krieg gezogen. Er rettet einem Offizier das Leben – es ist Carlo, der seinerseits unter falschem Namen kämpft. Die beiden schwören sich ewige Freundschaft. Als Alvaro im Kampf verwundet wird, entdeckt Carlo unter dessen Habseligkeiten das Porträt seiner Schwester Leonora. Er schwört Rache. Alvaro ist wieder genesen und wird von Carlo zum Duell aufgefordert. Doch die Kämpfenden werden von ihren Kameraden getrennt. Alvaro sucht Frieden in der Einsamkeit eines Klosters.
Mastro Trabuco macht zwielichtige Geschäfte. Fra Melitone beklagt eine verrückte Welt, Preziosilla feiert den Krieg.
Vierter Akt
Das Volk leidet Hunger.
Carlo hat die Suche nie aufgegeben und spürt Alvaro im Kloster auf, um ihn erneut zum Kampf zu fordern.
Leonora hat keine Ruhe gefunden – noch immer liebt sie Alvaro. Als sie ihm völlig unerwartet wieder begegnet, muss sie erfahren, dass er Carlo soeben im Kampf tödlich verwundet hat. Leonora eilt zum sterbenden Bruder, der sich auch noch im Tode unversöhnlich zeigt und sie tötet. Alvaro bleibt allein zurück.
Biografien

Fabio Luisi, Musikalische Leitung
Fabio Luisi
Fabio Luisi stammt aus Genua. Er war Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich, Music Director des Dallas Symphony Orchestra und Chefdirigent des Danish National Symphony Orchestra. Von 2011 bis 2017 war Fabio Luisi Principal Conductor der Metropolitan Opera in New York, zuvor Chefdirigent der Wiener Symphoniker (2005-2013), Generalmusikdirektor der Staatskapelle Dresden und der Sächsischen Staatsoper (2007-2010), Künstlerischer Leiter und Chefdirigent des MDR Sinfonieorchesters Leipzig (1999-2007) und Musikdirektor des Orchestre de la Suisse Romande (1997-2002), mit dem er zahlreiche CDs aufnahm (Poulenc, Respighi, Mahler, Liszt, eine Gesamtaufnahme der sinfonischen Werke von Arthur Honegger und Verdis Jérusalem und Alzira). Er ist Musikdirektor des «Festival della Valle d’Itria» in Martina Franca (Apulien) und Gastdirigent renommierter Klangkörper, darunter das Philadelphia Orchestra, das Cleveland Orchestra, das NHK Tokio, die Münchener Philharmoniker, die Filarmonica della Scala, das London Symphony Orchestra, das Concertgebouw Orkest Amsterdam, das Saito Kinen Orchester sowie zahlreiche namhafte Opernorchester. Bei den Salzburger Festspielen trat er mit Richard Strauss’ Die Liebe der Danae und Die Ägyptische Helena hervor. Zu seinen bedeutendsten Dirigaten aus seiner Zeit als Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich zählen u.a. die Neuproduktionen von drei Bellini-Opern sowie Rigoletto, Fidelio, Wozzeck und Verdis Messa da Requiem. Wichtige CD-Aufnahmen sind Verdis Aroldo, Bellinis I puritani und I Capuleti e i Montecchi, sämtliche Sinfonien von Robert Schumann sowie die Sinfonien und das Oratorium Das Buch mit sieben Siegeln des vergessenen österreichischen Komponisten Franz Schmidt. Ausserdem liegen verschiedene sinfonische Dichtungen von Richard Strauss und eine hochgelobte Aufnahme von Bruckners 9. Sinfonie mit der Staatskapelle Dresden vor. Für die Einspielungen von Siegfried und Götterdämmerung mit dem Orchester der Met erhielt er einen Grammy, 2013 wurde ihm der begehrte italienische Kritikerpreis Premio Franco Abbiati und 2014 der Grifo d’Oro der Stadt Genua verliehen. Er ist Träger des Bruckner-Ringes der Wiener Symphoniker sowie Cavaliere und Commendatore der italienischen Republik. Im 2015 neu gegründeten Label «Philharmonia Records» der Philharmonia Zürich erschienen unter seiner Leitung bisher Werke von Berlioz, Wagner, Verdi, Rachmaninow, Bruckner, Schubert, Rimski-Korsakow und Frank Martin sowie die DVDs zu Rigoletto (Regie: Tatjana Gürbaca), Wozzeck (Regie: Andreas Homoki), I Capuleti e i Montecchi (Regie: Christof Loy), die Messa da Requiem (Regie/Choreografie: Christian Spuck) und Das Land des Lächelns (Regie: Andreas Homoki).

Andreas Homoki, Inszenierung
Andreas Homoki
Andreas Homoki wurde als Sohn einer ungarischen Musikerfamilie 1960 in Deutschland geboren und studierte Schulmusik und Germanistik in Berlin (West). 1987 ging Andreas Homoki als Regieassistent und Abendspielleiter an die Kölner Oper, wo er bis 1993 engagiert war. In den Jahren 1988 bis 1992 war er ausserdem Lehrbeauftragter für szenischen Unterricht an der Opernschule der Musikhochschule Köln. Hier entstanden erste eigene Inszenierungen. 1992 führte ihn seine erste Gastinszenierung nach Genf, wo seine Deutung der Frau ohne Schatten internationale Beachtung fand. Die Inszenierung, die später auch am Pariser Théâtre du Châtelet gezeigt wurde, erhielt den französischen Kritikerpreis des Jahres 1994. Von 1993 bis 2002 war Andreas Homoki als freier Opernregisseur tätig und inszenierte u. a. in Köln, Hamburg, Genf, Lyon, Leipzig, Basel, Berlin, Amsterdam und München. Bereits 1996 debütierte er an der Komischen Oper Berlin mit Falstaff, es folgten Die Liebe zu drei Orangen (1998) sowie im Jahre 2000 Die lustige Witwe. 2002 wurde Andreas Homoki als Nachfolger von Harry Kupfer zum Chefregisseur der Komischen Oper Berlin berufen, deren Intendant er 2004 wurde. Neben seinen Regiearbeiten an der Komischen Oper Berlin inszenierte er u. a. am Théâtre du Châtelet in Paris, an der Bayerischen Staatsoper München, am New National Theatre Tokyo, an der Sächsischen Staatsoper Dresden und der Hamburgischen Staatsoper. Im Juli 2012 inszenierte er unter der musikalischen Leitung von William Christie David et Jonathas von Marc-Antoine Charpentier für das Festival in Aix-en-Provence – eine Produktion, die später auch u. a. in Edinburgh, Paris und New York gezeigt wurde. Seit Beginn der Spielzeit 2012/13 ist Andreas Homoki Intendant des Opernhaus Zürich und inszenierte hier u. a. Der fliegende Holländer (Koproduktion mit der Mailänder Scala und der Norwegischen Staatsoper Oslo), Fidelio, Juliette, Lohengrin (Koproduktion mit der Wiener Staatsoper), Luisa Miller (Hamburgische Staatsoper), Wozzeck, My Fair Lady (Komische Oper Berlin), I puritani, Medée, Lunea (von der Zeitschrift Opernwelt zur «Uraufführung des Jahres 2017/18» gekürt), Iphigénie en Tauride, Nabucco, Simon Boccanegra, Les Contes d’Hoffmann, Salome, den Ring des Nibelungen und Carmen. Andreas Homoki ist seit 1999 Mitglied der Akademie der Künste Berlin.

Hartmut Meyer, Bühnenbild
Hartmut Meyer
Hartmut Meyer studierte Bühnenbild an der Kunsthochschule Berlin-Weissensee. 1981 begann seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Regisseur Frank Castorf, die ihn u. a. von Anklam nach Basel, Köln, München und an die Volksbühne Berlin führte. Zu Ruth Berghaus’ Inszenierungen, die er als Bühnenbildner ausstattete, gehören Pelléas et Mélisande an der Staatsoper unter den Linden in Berlin, Don Carlos in Basel, Der Freischütz und Der fliegende Holländer in Zürich sowie Freispruch für Medea in Hamburg. Seine Zusammenarbeit mit Andreas Homoki umfasst Don Giovanni in Kopenhagen, Das Schloss in Hannover, Elektra und Requiem in Basel, Die Zauberflöte in Köln, Il trovatore in Bonn, La bohème und Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny an der Komischen Oper in Berlin sowie Lady Macbeth von Mzensk, Médée und La forza del destino am Opernhaus Zürich. Zudem war er unter anderem verantwortlich für die Ausstattung von Don Giovanni (Luzern) und Lohengrin (Karlsruhe) in der Regie von Reinhild Hoffmann, Ariadne auf Naxos (Basel), Tosca (Kassel), La bohème und Salome (Luzern), Werther (Berlin), Les Troyens (Mannheim) und Peter Grimes (Dresden) in der Regie von Sebastian Baumgarten sowie Tannhäuser (Dresden) in der Regie von Peter Konwitschny. Als eigene Inszenierungen entstanden 1996 Das Geräusch an der Volksbühne Berlin, 1999 Perlboot in Aachen und Die Schöpfung in Meiningen. Seit 2002 ist Hartmut Meyer Professor an der Universität der Künste Berlin und Leiter der Bühnenbildklasse.

Mechthild Seipel, Kostüme
Mechthild Seipel
Mechthild Seipel wurde in Bochum geboren. Nach einer Ausbildung zur Modedesignerin in Berlin führte sie ihr erstes berufliches Engagement als Assistentin und Kostümbildnerin an die Bühnen der Stadt Köln, wo ihre Zusammenarbeit mit Andreas Homoki begann. Diese verbindet sie nun seit vielen Jahren. Gemeinsam arbeiteten sie u.a. an Lulu und Capriccio (Amsterdam), Le nozze di Figaro und La fanciulla del West (Tokio), La bohème, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, Eugen Onegin und My fair Lady (Komische Oper Berlin). Am Opernhaus Zürich entwarf sie die Kostüme zu seinen Inszenierungen von Lady Macbeth von Mzensk, Médée und La forza del destino. Des Weiteren verbindet sie eine lange Zusammenarbeit mit der Regisseurin Karoline Gruber, für die sie unter anderem das Kostümbild für Don Giovanni an der Deutschen Oper am Rhein, für König Lear und Die tote Stadt für die Staatsoper Hamburg und zuletzt für Der Spieler an der Wiener Staatsoper entwarf. Am Theater Dortmund zeichnete sie in der Spielzeit 2020/21 für das Kostümbild zu Turandot in der Regie von Tomo Sugao verantwortlich, 2022/23 für Der fliegende Holländer am Theater Krefeld und Mönchengladbach sowie für Prokofjews Die Liebe zu den drei Orangen an der Komischen Oper Berlin.

Franck Evin, Lichtgestaltung
Franck Evin
Franck Evin, geboren in Nantes, ging mit 19 Jahren nach Paris, um Klavier zu studieren. Nachts begleitete er Sänger im Café Théâtre Le Connetable und begann sich auch für Beleuchtung zu interessieren. Schliesslich entschied er sich für die Kombination aus Musik und Technik. Dank eines Stipendiums des französischen Kulturministeriums wurde er 1983 Assistent des Beleuchtungschefs an der Opéra de Lyon. Hier arbeitete er u. a. mit Ken Russel und Robert Wilson zusammen. Am Düsseldorfer Schauspielhaus begann er 1986 als selbstständiger Lichtdesigner zu arbeiten und legte 1993 die Beleuchtungsmeisterprüfung ab. Besonders eng war in dieser Zeit die Zusammenarbeit mit Werner Schröter und mit dem Dirigenten Eberhard Kloke. Es folgten Produktionen u. a. in Nantes, Strassburg, Paris, Lyon, Wien, Bonn, Brüssel und Los Angeles. Von 1995 bis 2012 war er Künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung der Komischen Oper Berlin und dort verantwortlich für alle Neuproduktionen. Hier wurden besonders Andreas Homoki, Barrie Kosky, Calixto Bieito und Hans Neuenfels wichtige Partner für ihn. Im März 2006 wurde Franck Evin mit dem «OPUS» in der Kategorie Lichtdesign ausgezeichnet. Seit Sommer 2012 arbeitet er als künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung an der Oper Zürich. Franck Evin wirkt neben seiner Tätigkeit in Zürich weiterhin als Gast in internationalen Produktionen mit, etwa an den Opernhäusern von Oslo, Stockholm, Tokio, Amsterdam, München, Graz sowie der Opéra Bastille, der Mailänder Scala, dem Teatro La Fenice, der Vlaamse Opera und bei den Bayreuther Festspielen.

Kinsun Chan, Choreographische Mitarbeit
Kinsun Chan
Der schweizerisch-kanadische Choreograf und Designer Kinsun Chan studierte Kunst, Grafikdesign und Tanz in den USA. Als Tänzer war er u.a. Mitglied des Balletts Zürich unter Heinz Spoerli sowie des Balletts Basel unter Richard Wherlock, wo er als Solist in Choreografien von Jiří Kylián, William Forsythe, Nacho Duato, Heinz Spoerli, Hans van Manen, Richard Wherlock und Ed Wubbe zu erleben war. Seine ersten eigenen Choreografien entstanden für die Reihe «Junge Choreografen» des Balletts Zürich sowie im Rahmen der Noverre-Gesellschaft am Stuttgarter Ballett. Kinsun Chans Arbeiten wurden seither vom Ballett Basel, dem Singapore Dance Theatre, dem Ballett der Staatsoper Hannover, der Royal Ballet School Antwerpen, der John Cranko Ballet School, der Hong Kong Academy of Performing Arts, der Ballett Akademie München, der Tanz Akademie Zürich sowie am Tiroler Landestheater, am Staatstheater Kassel und am Luzerner Theater aufgeführt. Die Choreografie Black on Black, kreiert für das Hong Kong Ballet, wurde zum Jacobs Pillow Dance Festival (USA) und zum Festival des Arts de Saint Sauveur (Kanada) eingeladen. Zwei seiner Variationen wurden beim Prix de Lausanne 2021 und 2022 aufgeführt (Echo und Rain). Kinsun Chan ist zudem als Choreograf für Opern tätig. Dabei arbeitete er u.a. mit Jens-Daniel Herzog, Michael Sturminger, Götz Friedrich, Dominique Mentha, Bernd Mottl, Frank Hilbrich, Tatjana Gürbaca, Sebastian Baumgarten und Andreas Homoki. Kinsun Chan ist seit Beginn der Spielzeit 2019/20 Leiter der Tanzkompanie am Theater St. Gallen und wird ab 2024/25 Künstlerischer Leiter des Semperoper Balletts.

Janko Kastelic, Choreinstudierung
Janko Kastelic
Janko Kastelic ist ein kanadisch-slowenischer Dirigent, Chorleiter, Pianist und Organist. Er begann seine musikalische Ausbildung in Kanada am Royal/Western Conservatory of Music und der St. Michael’s Choir School. Er hat einen Abschluss in Dirigieren, Komposition und Musiktheorie von der Universität Toronto und setzte sein Studium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien fort. Seit 2017 ist er Chordirektor am Opernhaus Zürich. Er war einer der Kapellmeister der Wiener Hofmusikkapelle, Studienleiter des JET-Programms für junge Sänger am Theater an der Wien und Assistent bei den Bayreuther Festspielen sowie Gastchordirektor an der Hamburgischen Staatsoper. Zu den Positionen, die er im Lauf seiner Karriere bekleidet hat, gehört auch die Stelle des Generalmusikdirektors und Operndirektors am Slowenischen Nationaltheater Maribor, des Zweiten Chordirektors an der Wiener Staatsoper sowie des Korrepetitors an der Opéra National de Paris. Er war Assistenzprofessor an der Universität Ljubljana und Mentor an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Seine künstlerischen Leistungen sind dokumentiert auf mehreren Live-Aufnahmen, darunter Tschaikowskis Pique Dame und Schönbergs Moses und Aron. Er arrangierte und dirigierte auch Werke für die Feierlichkeiten zum Mozartjahr 2006. Zu seinen Arbeiten beim Klangbogen-Festival in Wien gehört die europäische Erstaufführung von Blochs Macbeth. Janko Kastelic ist auch ein engagierter Pädagoge, der sich der Förderung der nächsten Generation von Musikerinnen und Musikern verschrieben hat.

Kathrin Brunner, Dramaturgie
Kathrin Brunner
Kathrin Brunner wurde in Zürich geboren. Sie studierte in ihrer Heimatstadt sowie an der Humboldt-Universität Berlin Germanistik, Musikwissenschaft und Französisch. Nach diversen Regiehospitanzen (u.a. Die Dreigroschenoper am Luzerner Theater; Regie: Vera Nemirova) und Dramaturgiehospitanzen ist sie seit 2008 Dramaturgin am Opernhaus Zürich. Hier arbeitete sie u.a. mit Regisseur:innen wie Achim Freyer (Moses und Aron), Harry Kupfer (Die Meistersinger von Nürnberg, Tannhäuser), Stephan Müller, Guy Joosten, Damiano Michieletto, Christof Loy (La straniera, Alcina, I Capuleti e i Montecchi, Don Pasquale, La rondine), Willy Decker (Il ritorno d'Ulisse in patria, The Turn of the Screw), Andreas Homoki (Wozzeck, Das Land des Lächelns, La forza del destino), Christoph Marthaler (Il viaggio a Reims, Orphée et Euridice), Barrie Kosky (Die Gezeichneten, Boris Godunow), Nadja Loschky, Nina Russi, Jan Essinger und Jetske Mijnssen (Idomeneo, Hippolyte et Aricie, Platée). Bei den Salzburger Festspielen 2012 erarbeitete sie La bohème mit Damiano Michieletto. Während der Corona-Pandemie war sie Co-Gründerin der Konzertreihe Altchemie live in der Alten Chemie Uetikon (https://www.altchemie.live).

Hibla Gerzmava, Donna Leonora
Hibla Gerzmava
Hibla Gerzmava studierte Gesang am staatlichen Konservatorium in Moskau und gewann 1994 beim Tschaikowski-Wettbewerb den Grand Prix. Seit 1995 tritt sie als Solistin für das Moskauer Stanislawski- und das Nemirowitsch-Dantschenko-Theater auf. Für ihre Interpretationen der Titelpartie in Médée sowie als Lucia di Lammermoor am selben Haus wurde sie jeweils mit einer «Goldene Maske» ausgezeichnet. Heute gastiert die Sopranistin an den grossen Opernhäusern Europas: Am Royal Opera House in London sang sie u.a. Donna Anna, Mimì, Amelia (Simon Boccanegra), Tatjana (Eugen Onegin) und Liù (Turandot), an der Opéra Bastille war sie als Elisabeth (Don Carlos) und im Palais Garnier als Vitellia (La clemenza di Tito) zu erleben, an der Wiener Staatsoper gastierte sie ebenfalls als Vitellia sowie als Donna Anna, an der Metropolitan Opera in New York verkörperte sie Donna Anna, Liù, Mimì, Desdemona (Otello) sowie Antonia und Stella (Les Contes d’Hoffmann). Ebenfalls als Mimì gab sie ihr Hausdebüt an der Bayerischen Staatsoper. 2016/17 debütierte sie an der Semperoper Dresden als Desdemona, am Bolschoi-Theater in Moskau als Violetta und an der Scala di Milano in der Titelpartie von Anna Bolena. In der aktuellen Spielzeit war die Sopranistin bisher u.a. als Elisabeth an der Bastille und am Bolschoi-Theater in Moskau zu erleben, sang Mimì und Lucia di Lammermoor am Moskauer Stanislawski-Theater und kehrte als Desdemona nach Dresden zurück. Konzertengagements führten sie u.a. in die Carnegie Hall, an die BBC Proms, zu den Olympischen Winterspielen in Sotschi und ans Edinburgh International Festival.

George Petean, Don Carlo di Vargas
George Petean
George Petean wurde in Cluj-Napoca (Rumänien) geboren und studierte Klavier, Posaune und Gesang. Sein Bühnendebüt gab er 1997 an der Oper in Cluj-Napoca als Don Giovanni. 1999 erhielt er den Grossen Preis des internationalen Gesangswettbewerbes Hariclea Darclée. 2000 gab er sein Debüt als Marcello (La bohème) am Teatro dell’Opera di Roma, 2002 bis 2010 war er Ensemblemitglied der Hamburgischen Staatsoper. Seitdem ist er freischaffend tätig. Engagements führten ihn u. a. an das Royal Opera House Covent Garden, die Wiener Staatsoper, die Opéra de Paris, die Bayerische Staatsoper München, die New Yorker Met, das Gran Teatro del Liceu Barcelona, die Berliner Opernhäuser, die Semperoper Dresden, die Oper Amsterdam sowie zu den Bregenzer Festspielen. Sein Repertoire umfasst Partien wie Figaro (Il barbiere di Siviglia), Silvio (Pagliacci), Conte di Luna (Il trovatore), Rodrigo, Marquis von Posa (Don Carlo), Lord Enrico Ashton (Lucia di Lammermoor), Giorgio Germont (La traviata), Amonasro (Aida), Simon Boccanegra und Rigoletto. Am Opernhaus Zürich war er zuletzt u.a. als Macbeth, als Simon Boccanegra sowie konzertant als Carlo Gérard (Andrea Chénier) zu erleben. In der Spielzeit 2024/25 wird er ausserdem als Rigoletto in Turin, als Conte di Luna in Hamburg und an der Staatsoper Berlin sowie als Rodrigo in München zu erleben sein.

Marcelo Puente, Don Alvaro
Marcelo Puente
Marcelo Puente stammt aus Argentinien. Er studierte am Conservatorio de Córdoba sowie am Teatro Colón in Buenos Aires. In der Saison 2016/17 gab er einige wichtige Hausdebüts: er war als Pinkerton (Madama Butterfly) erstmals am Royal Opera House Covent Garden, an der Staatsoper Hamburg und am Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel zu erleben, debütierte als Cavaradossi (Tosca) mit der Canadian Opera Company sowie an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und sang Don José in Bizets Carmen bei seinem US-Debüt am Michigan Opera Theatre. Die aktuelle Spielzeit führte ihn bisher an die Vancouver Opera als Calaf (Turandot), an die Staatsoper Hamburg als Pinkerton, als Paolo in Zandonais Francesca da Rimini an die Opéra National du Rhin und an die Mailänder Scala, als Don José an die Opera Australia in Sydney und als Don Alvaro (La forza del destino) an die Semperoper Dresden. Sein Repertoire umfasst zudem Rollen wie Manrico in Il trovatore, den er u.a. an der Opéra de Toulon sang, Rodolfo in La bohème (Oper Stuttgart, Montevideo, Lucca, Pisa, Ravenna, Livorno), die Titelrolle in Don Carlo (Staatsoper Prag), Riccardo in Un ballo in maschera (Teatro Colón in Buenos Aires), Cassio in Verdis Otello (Palau de les Arts in Valencia) sowie Macduff (Macbeth) und Turiddu (Cavalleria rusticana). Zu seinen zukünftigen Engagements zählen u.a. Cavaradossi in Hamburg und an der Pariser Opéra, Don Alvaro und Don José an der Semperoper Dresden sowie Carmen in der Arena di Verona und Adriana Lecouvreur (Maurizio) in Verbier.

J'Nai Bridges, Preziosilla
J'Nai Bridges
J’Nai Bridges stammt aus Lakewood, Washington. Sie absolvierte den Bachelor im Bereich vocal performance an der Manhattan School of Music und den Master of Music am Curtis Institute of Music. 2015 vertrat sie die USA beim Wettbewerb BBC Cardiff Singer of the World. Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen zählt der Richard Tucker Career Grant 2016. Im selben Jahr gewann sie den renommierten Francisco Vinjas International Wettbewerb, 2018 die Sphinx Medal of Excellence. Während drei Jahren wurde sie als vielversprechende Nachwuchskünstlerin vom Patrick G. and Shirley W. Ryan Opera Center der Lyric Opera of Chicago gefördert. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sang sie u.a. Ines in Il trovatore, Vlasta in Weinbergs The Passenger unter der Leitung von Sir Andrew Davis und Flora in La traviata. Ausserdem war sie als Carmen in der Uraufführung von Bel Canto an der Lyric Opera of Chicago, Suzuki (Madama Butterfly) in San Diego und in der Titelrolle von The Rape of Lucretia zu erleben. Im Konzert war sie bereits neben Yo-Yo Ma mit dem Chicago Symphony Orchestra, mit den L.A. Philharmonic unter Gustavo Dudamel sowie mit dem NDR Sinfonieorchester unter Esa-Pekka Salonen mit Ravels Shéhérazade zu hören. In der Spielzeit 2016/17 debütierte sie als Bersi (Andrea Chénier) an der San Francisco Opera und an der Bayerischen Staatsoper sowie als Nefertiti (Philipp Glass’ Akhnaten) an der Los Angeles Opera. Mit dem Philadelphia Orchestra war sie in der Eröffnungswoche in der Elbphilharmonie zu Gast.

Christof Fischesser, Il Marchese di Calatrava, Padre Guardiano
Christof Fischesser
Christof Fischesser studierte Gesang in Frankfurt am Main. Im Jahr 2000 gewann er den ersten Preis beim Bundeswettbewerb für Gesang in Berlin, worauf er an das Staatstheater Karlsruhe engagiert wurde. 2004 wechselte er an die Staatsoper Berlin, von 2012 bis 2015 war er Ensemblemitglied am Opernhaus Zürich, mit dem ihn seither eine enge Zusammenarbeit verbindet. Er gastierte ausserdem an der Wiener Staatsoper, am Royal Opera House London, an der Opéra Bastille Paris, dem Teatro Real in Madrid, der Staatsoper München, der Komischen Oper Berlin, der Semperoper Dresden, der Opéra de Lyon, am Théâtre du Capitole de Toulouse, an der Houston Grand Opera, der Lyric Opera Chicago sowie den Opernhäusern von Antwerpen, Kopenhagen und Göteborg. Sein breitgefächertes Repertoire umfasst u.a. Rollen wie König Marke (Tristan und Isolde), Landgraf (Tannhäuser), König Heinrich (Lohengrin), Gurnemanz (Parsifal), Sarastro (Zauberflöte), Figaro (Le nozze di Figaro), Rocco (Fidelio), Banquo (Macbeth), Mephisto (Faust) und Baron Ochs von Lerchenau (Der Rosenkavalier). Zahlreiche CDs und DVDs dokumentieren sein künstlerisches Schaffen, so z.B. Beethovens Fidelio unter Claudio Abbado (mit Nina Stemme und Jonas Kaufmann), Massenets Manon unter Daniel Barenboim (mit Anna Netrebko und Rolando Villazón) oder Wagners Lohengrin unter Kent Nagano (mit Anja Harteros und Jonas Kaufmann). In Zürich war er u. a. als König Heinrich, Orest (Elektra), Kaspar, Daland, Gremin, Gurnemanz (Parsifal), Il Marchese di Calatrava, Padre Guardiano (La forza del destino), Hunding (Die Walküre) sowie als Jacopo Fiesco (Simon Boccanegra) zu erleben.

Jamez McCorkle, Mastro Trabuco
Jamez McCorkle
Jamez McCorkle stammt aus New Orleans. Er studierte am Curtis Institute of Music in Philadephia und gewann zahlreiche Wettbewerbspreise, darunter 2013 den George London Award bei der George London Foundation Awards Competition, den Betty Allen Award der Sullivan-Stiftung und den ersten Platz bei der Brava! Opera Vocal Competition sowie 2011 den zweiten Platz beim Regionalwettbewerb (Gulf Coast Region) der Metropolitan Opera National Council Auditions. 2016/17 war er an der New Yorker Met als Cover für Benvolio (Roméo et Juliette) engagiert, debütierte als Lenski (Jewgeni Onegin) beim Spoleto Festival in South Carolina und war am Curtis Opera Theatre als Ruggero (La rondine), James Nolan (John Adams’ Doctor Atomic) und Male Chorus (The Rape of Lucretia) zu erleben. 2017 sang er bei den Salzburger Festspielen im Rahmen des Young Singers Project in Verdis I due Foscari. Seit 2017/18 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios in Zürich und sang hier bisher den 1. Geharnischten (Die Zauberflöte), Nick (La fanciulla del west), Mastro Trabuco (La forza del destino), Remendado (Carmen), Normanno (Lucia di Lammermoor) und einer von den Deux gardes in Manon. Im Sommer 2018 gastierte er zudem als Tamino an der Kentucky Opera und als Lenski (Jewgeni Onegin) an der Michigan Opera und wird im September 2019 Peter the Honeyman in Porgy and Bess an der Metropolitan Opera in New York singen.






































