Iphigénie en Tauride
Tragédie en quatre actes von Christoph Willibald Gluck (1714-1787)
Libretto von Nicolas-François Guillard
nach der gleichnamigen Tragödie von Claude Guimond de La Touche
In französischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 1 Std. 45 Min. Keine Pause. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Vergangene Termine
Februar 2020
08
Feb19.00
Iphigénie en Tauride
Oper von Christoph Willibald Gluck , Samstag-Abo, Barock-Abo, Französische Oper-Abo
11
Feb19.00
Iphigénie en Tauride
Oper von Christoph Willibald Gluck , Dienstag-Abo A, Belcanto-Abo
16
Feb20.00
Iphigénie en Tauride
Oper von Christoph Willibald Gluck , AMAG Volksvorstellung, La Scintilla-Abo
Gut zu wissen
Iphigénie en Tauride
Kurzgefasst
Iphigénie en Tauride
Viel Blut ist geflossen in der Familiengeschichte des Atridengeschlechts: Auf den Mord im Namen der Götter folgte Rache, auf Rache wieder Mord, auf Mord erneute Rache. Ein Kreislauf, aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt: Um die Göttin Diana auf dem Weg in den trojanischen Krieg günstig zu stimmen, opferte Agamemnon seine Tochter Iphigénie. Als er Jahre später nach Hause zurückkehrte, rächte Iphigénies Mutter, Klytämnestra, diese Tat, indem sie Agamemnon umbrachte. Orest, Iphigénies Bruder, wiederum rächte den Mord an seinem Vater, indem er die eigene Mutter tötete. Seitdem wird er von den Eumeniden, den Rachegöttern, gequält. Das Orakel von Delphi verspricht Orest Befreiung von seinen Qualen, wenn er die Statue der Diana aus Tauris nach Griechenland zurückholt. In Tauris lebt Iphigénie, die von Diana im letzten Moment vor ihrer Opferung gerettet wurde, als deren Priesterin. Thoas, König der barbarischen Skythen auf Tauris, zwingt Iphigénie, jeden Fremden, der sich der Halbinsel nähert, auf dem Altar der Diana zu opfern. Als sie auch Orest opfern soll, erkennt sie ihn als ihren Bruder und weigert sich, erneut zu töten. In den daraufhin ausbrechenden Kampf zwischen Griechen und Skythen greift die Göttin Diana ein und zeigt einen Ausweg aus dem blutigen Kreislauf: Sie befreit Orest von seiner Schuld und schickt die Geschwister zurück nach Mykene, wo sie gemeinsam die Herrschaft übernehmen sollen.
Gluck, der grosse Erneuerer, machte aus der statischen französischen Oper des 18. Jahrhunderts ein lebendiges Drama menschlicher Leidenschaften und setzte die inneren Konflikte der Figuren überwältigend in Szene. Intendant Andreas Homoki inszeniert, die musikalische Leitung des Orchestra La Scintilla hat Gianluca Capuano.
Gespräch

Andreas, vor einigen Jahren hast du an der Oper in Genf Christoph Willibald Glucks Orphée et Euridice inszeniert, nun folgt Iphigénie en Tauride am Opernhaus Zürich. Was für eine Beziehung hast du zu diesem Komponisten, der in der Musikgeschichte häufiger für seine berühmte Opernreform erwähnt wird als für seine Werke selbst?
Ich würde Gluck als einen eher unaufgeregt komponierenden Musiker beschreiben, der unglaublich souverän Geschichten erzählt und dabei den Zuständen seiner Figuren sehr viel Raum gibt. Die Handlung steht oft eher still, aber häufig geht es auch gar nicht so sehr um die äussere Handlung, sondern viel mehr um die Innenwelten der Figuren. Es gibt in Glucks Opern keine Milieuschilderungen, die Stücke spielen an einem nicht genau festgelegten Ort, was mir als Regisseur eine grosse Freiheit gibt, Bildmetaphern zu finden. Mir gefällt auch das sehr ausgewogene Verhältnis zwischen dramatischen und kontemplativen Momenten. Das ist für mich das Wesen der Klassik: das Ebenmass, der Verzicht auf übermässige barocke Ornamentierung, die Einfachheit.
Genau das war ja auch Glucks erklärtes Ziel: die schematischen Strukturen der italienischen Metastasio-Opern zu überwinden und – im Verein mit den französischen Enzyklopädisten, allen voran Diderot und Rousseau – im Paris der 1770er Jahre zu einer neuen Form der Oper zu finden, die von Natürlichkeit und Wahrhaftigkeit des Ausdrucks geprägt ist. Das ist ihm also gelungen?
Ja, absolut. Man spürt bei Gluck sehr viel Empathie für seine Figuren, er zeichnet sie mit einer grossen Menschenliebe. Diese Menschen sind geprägt durch eine Empfindsamkeit, die natürlich für diese Zeit typisch ist – sie verhalten sich sehr nobel, verzichten zugunsten des anderen...
Hat uns diese Empfindsamkeit, dieses Verzichtenwollen heute überhaupt noch etwas zu sagen? Das sind nicht unbedingt Eigenschaften, die unsere Zeit charakterisieren...
Umso mehr müssen wir sie einfordern und auf dem Theater zeigen!
Anders gefragt: Was ist für dich das Moderne an diesem Stück?
Das Thema ist zeitlos! Es geht um eine Familie, konkret die exemplarische Familientragödie des Altertums – die Familie von Agamemnon und Klytämnestra. Diese Familie ist gefangen in einem Kreislauf von Mord und Rache, der damit beginnt, dass Agamemnon gezwungen wird, seine eigene Tochter Iphigenie zu opfern. Erst am Ende dieses Stückes wird der Fluch gelöst. Die Familie sollte eigentlich ja eine glückliche Keimzelle der Gesellschaft sein, das Familienleben wird – auch in der Werbung – oft als Idylle dargestellt; aber das Leben zerrt an den Menschen, die Wirklichkeit sieht häufig anders aus. Familienkonflikte können zu starken Reibungen und im schlimmsten Fall sogar zu Mord und Totschlag führen. Gerade wenn in einer patriarchalen Gesellschaft mächtige Väter beteiligt sind, wie in unserem Fall Agamemnon, der König von Mykene ist und Feldherr im Krieg gegen Troja.
Also geht es hier neben dem familieninternen Konflikt auch um den Konflikt zwischen der Familie und der Gesellschaft?
Ja, und dieser Konflikt kommt im Altertum immer wieder vor. Er hat mit der Entstehung der Polis zu tun, also mit der Entstehung von Strukturen, die es notwendig machen, dass Menschen aufgrund des gesellschaftlichen Fortschritts in immer grösseren Gemeinschaften zusammenleben, weil der Familienclan als Ordnungsprinzip nicht mehr ausreicht. So entsteht dieses Motiv – auch in der Bibel mit der Geschichte von Abraham und Isaak – des kindlichen Opfers für den Gott oder die Göttin, wobei ich Gott ganz allgemein verstehe als ein Bild für etwas, das über die eigene Existenz hinausgeht. Agamemnon kann seiner Funktion und seiner Verantwortung als Heerführer nur gerecht werden, wenn er seine Tochter Iphigenie opfert. Damit tut er sich zunächst schwer, und letztlich ist es die Tochter selbst, die den Konflikt löst, indem sie sagt, ich verstehe das Problem und bin bereit, in den Tod zu gehen. Agamemnon tötet daraufhin Iphigenie und besteht damit die Prüfung im Sinne der Gottheit.
Aber die Opferung Iphigenies führt innerhalb dieser Familie zu einem schweren Trauma...
Dieses Trauma ist mit dem Fluch des Tantalos beschrieben. Weil dieser Schuld auf sich geladen hat, haben die Götter verfügt, dass jeder seiner Nachkommen ein Mitglied der eigenen Familie umbringt. Dieser Fluch führt in der Folge dazu, dass die Mutter Klytämnestra ihren Ehemann Agamemnon tötet und selbst wiederum von ihrem Sohn Orest umgebracht wird. Soweit die Vorgeschichte. In der Oper selbst wird Orest seiner Schwester Iphigénie wiederbegegnen, die von der Göttin Diana gerettet wurde; sie ist jetzt Priesterin des Diana-Tempels und wird von Thoas, dem Gewaltherrscher auf Tauris, gezwungen, jeden Fremden, der hier landet, umzubringen. Die Geschwister erkennen sich zunächst nicht, weil sie seit ihrer Kindheit getrennt waren; erst im letzten Moment, als Iphigénie im Begriff ist, das grausame Opferritual auszuführen, erfährt sie, dass es ihr Bruder Orest ist, den sie im Begriff ist zu töten, und verweigert das Opfer.
Der Iphigenie-Stoff ist häufig bearbeitet worden, unter anderem auch von Johann Wolfgang von Goethe; Iphigenie wird hier zum Denkmal der alle Gewalt überwindenden Humanität stilisiert. Wie hat Gluck sie charakterisiert?
Iphigénie ist natürlich auch bei Gluck eine ausgesprochen humanistische Figur, aber sie ist zugleich auch sehr leidenschaftlich; wir sind ja schliesslich in der Oper! Das Stück beginnt mit einem Sturm im Orchester, und wir werden als Zuschauer direkt mit dem Seelenzustand Iphigénies konfrontiert; in der anschliessenden Arie sagt sie selbst: Der Sturm auf dem Meer ist vorüber, aber nicht der Sturm in meinem Inneren. Es geht also von Anfang an um Iphigénies Inneres. Mozart hat das übrigens wenige Jahre später in Idomeneo aufgegriffen, dort singt Idomeneo in seiner Arie: Zwar bin ich dem Sturm entkommen, doch ich habe den Sturm bzw. das Meer in mir. Iphigénie kann sehr leidenschaftlich sein, aber auch sehr elegisch. Sie verfügt über eine grosse emotionale Bandbreite und ist eine Frau aus Fleisch und Blut, wie übrigens alle Figuren in dieser Oper. Alles andere wäre auch uninteressant auf der Bühne.
Diana hatte also Mitleid mit Iphigénie und hat sie gerettet; zu Beginn der Oper lebt Iphigénie bereits seit 15 Jahren als Priesterin der Diana auf Tauris. Was ist dieses Tauris für ein Ort?
Zunächst mal ist es ein Ort, der sowohl geografisch als auch kulturell sehr weit von Iphigénies griechischer Heimat entfernt ist. Und auf gewisse Weise scheint es ein Ort zu sein, der Menschen anzieht, die traumatisiert sind, ein Ort, an dem Traumatisierte aufeinandertreffen. Dieser Ort, der von Gewalt und Barbarei beherrscht wird, ist für meinen Ausstatter Michael Levine und mich kein wirklicher Ort, sondern eine Art Unterwelt oder ein Fegefeuer. Iphigénie ist ja für ihre Familie tot, denn niemand weiss, dass sie gerettet wurde. Ihr Bruder Orest ist dem Tode nahe, denn die Rachegöttinnen verfolgen und quälen ihn; er trägt eine grosse Todessehnsucht in sich. Die Bühne, die wir entwickelt haben, vermeidet konkrete Örtlichkeiten. Im Zentrum des Stückes stehen für uns die Geschwister Iphigénie und Orest, dazu kommt der Freund des Orest, Pylades, der nicht zur Familie gehört. Alle Figuren sind dem Gewaltherrscher Thoas ausgesetzt. Die beiden Hauptfiguren durchleben an diesem Ort immer wieder albtraumhaft ihr Trauma; deshalb erschien uns Thoas als eine Art verzerrter, übersteigerter Reflex Agamemnons, der seine Tochter umgebracht hat und von dem Trauma dieser Tat allmählich seelisch zugrunde gerichtet wurde. Am Schluss der Oper erscheint die Göttin Diana; deren Vergebung löst den Fluch schliesslich auf. Dies steht für uns für die Vergebung, die Orest von seiner toten Mutter Klytämnestra nie wird erhalten können und die er daher umso mehr ersehnt. Die Figuren Agamemnon-Thoas und Klytämnestra- Diana werden sich in unserer Inszenierung so ineinander spiegeln, dass der Eindruck entsteht, das Personal des Stückes bestünde letztlich nur aus diesen vier Figuren: den beiden Kindern und ihren Eltern.
Interessant ist ja, dass in dieser Oper keine konventionelle Liebesgeschichte vorkommt; neben der Geschwisterliebe gibt es allerdings noch die sehr besondere Freundesliebe zwischen Orest und Pylades.
Die Beziehung zwischen Orest und Pylades ist unglaublich liebevoll gezeichnet, fast homoerotisch; auf jeden Fall geht sie weit über eine normale Männerfreundschaft hinaus. Dass es in dem Stück keine konventionelle Liebesbeziehung gibt, dient der Klarheit und ist nur konsequent. Zu den Hauptfiguren kommt dann noch der Chor, den wir aber auch als Spiegelungen oder Vervielfachungen einerseits von Iphigénie, andererseits von Thoas sehen; der Chor wird ja die meiste Zeit über in Männerchor und Frauenchor getrennt eingesetzt, es wird nie eine gemischte Gesellschaft gezeigt. Wir fokussieren die Geschichte auf die Familie in einem klaustrophobischen, tunnelartigen Raum, der nur ab und zu aufbricht und grelles Licht einlässt; innen ist es beklemmend, aber aussen ist es möglicherweise noch bedrohlicher. Es gibt eigentlich keinen Ausweg aus dieser albtraumhaften Innenwelt.
Wie siehst du dann den Schluss des Stückes – immerhin vergibt ja Diana Orest seine Schuld und schickt ihn als König zurück nach Mykene?
Ja, es gibt dieses «lieto fine», der Fluch wird gelöst und die Figuren entkommen ihrem Gefängnis. Wie erfolgreich sie ihr weiteres Leben nach all den seelischen Beschädigungen meistern werden, bleibt natürlich dahingestellt, aber wir werden hier nicht versuchen, eine Antwort zu geben.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach.
Bild von Frank Blaser.
Dieser Artikel erschien im MAG 75, Januar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Gespräch

Cecilia Bartoli, mit der Titelrolle in Iphigénie en Tauride treten Sie hier am Opernhaus zum ersten Mal in einer Oper von Christoph Willibald Gluck auf. Sie sind bekannt als eine Künstlerin, die ihre Projekte sehr sorgfältig auswählt. Was macht diesen Komponisten für Sie interessant?
Ich verehre Gluck sehr und kehre immer wieder gern zu ihm zurück. Iphigénie en Tauride war 2015 bei den Salzburger Pfingsfestspielen die erste Gluck-Oper, die ich gesungen habe. Ich bin sehr glücklich, dass wir dieses wunderbare Stück nun hier in Zürich auf die Bühne bringen. Gluck war ein sehr besonderer Komponist, denn er hat die Oper revolutioniert! Sein Anliegen war es, die Oper zu ihrem wahren Ursprung zurückzuführen: zu den Menschen und ihren Geschichten. Er wandte sich gegen die Gier der Zuschauer nach musikalischem und szenischem Feuerwerk und brachte die Schönheit des Dramas ins Zentrum der Oper zurück. Aber Glucks Iphigénie en Tauride ist nicht nur einfach ein schönes Stück, sondern theatralisch und musikalisch-dramatisch sehr aufregend; und es ist für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung!
Glucks Ziel war ja – ganz im Sinne Rousseaus – eine neue Natürlichkeit in der Oper; dramatische Wahrheit war ihm wichtiger, als seinen Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit zu geben, in langen Koloraturarien ihre Virtuosität unter Beweis zu stellen. Das ist einer der Gründe dafür, dass Glucks Gegner seine Musik als langweilig und melodisch uninteressant bezeichnet haben. Können Sie das nachvollziehen?
Als Sängerin kann ich in dieser Gluckschen Reformoper tatsächlich nicht auf die gleiche Art und Weise mit vokaler Virtuosität brillieren, wie ich das in einer seiner frühen barocken italienischen Opern könnte. Gluck wollte einen Schlusspunkt setzen hinter die Virtuosität der Kastraten und Primadonnen seiner Zeit, und in Iphigénie en Tauride ist es vor allem die Expressivität, die zählt. Es geht hier in erster Linie um die Bedeutung des Textes. Gluck konzentrierte sich ganz auf die Geschichte und auf die Emotionen der Figuren, auf die genaue Textausdeutung und die Balance von Musik und Text. Er gibt der Oper auf diese Art und Weise eine unvergleichliche Tiefe. Was für ihn zählt, ist die Intensität der Geschichte.
Warum ist es jetzt – an diesem Punkt Ihrer künstlerischen Entwicklung – der richtige Moment für Sie, Gluck zu singen?
Gluck verlangt von einem Sänger bzw. einer Sängerin, sich total zu exponieren; das ist der Grund, warum viele Sängerinnen sich nicht an seine späten, dramatischeren Werke wagen. In Iphigénie en Tauride muss ich als Sängerin bereit sein, dem Publikum meine nackte Seele zu zeigen. Die Rolle fordert sehr viel. Iphigénie kann sehr wütend, geradezu wild sein, aber auch zärtlich. Das ist aufwühlend, und die Stimme muss in der Lage sein, eine sehr grosse Bandbreite an Emotionen auszudrücken. Um eine Figur wie Iphigénie darzustellen, darf man sich nicht scheuen, sich selbst voll und ganz in die Rolle hineinzugeben, und dafür braucht man Mut. Und für diesen Mut wiederum ist eine gewisse Reife nötig, die ich nicht hatte, als ich 20 Jahre alt war. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, dass sowohl die Sänger als auch das Publikum sich mit Glucks Musik unglaublich wohl fühlen, wenn sie auf diese emotionale Reise gehen – trotz der ausserordentlichen Expressivität und Gefühlstiefe dieser Musik.
Sie haben sich ja mit der Partie bereits 2015 in Salzburg auseinandergesetzt; können Sie Iphigénies Charakter noch genauer beschreiben?
Die Iphigenie, die wir aus Goethes Drama kennen, ist das Idealbild einer klassischen griechischen Heroine. Als Figur erscheint sie mir hier eher statisch und passiv, getrieben von ihrem Schicksal. Bei Gluck dagegen ist sie eine äusserst lebendige Figur, leidenschaftlich und sogar rebellisch in dem Moment, in dem sie sich der Autorität des Königs Thoas widersetzt. Sie durchlebt Sehnsüchte, Erinnerungen und tiefe Verzweiflung. Glucks Iphigénie ist also keineswegs eine kalte griechische Statue, sondern eine Frau voller Gefühle und Zweifel.
Die Hauptquelle für die Geschichte ist die griechische Mythologie. Wie haben Sie sich auf diese Rolle vorbereitet, haben Sie viel gelesen?
Ich liebe es, in neue Welten einzutauchen, mich in den Tiefen der Archive zu verlieren, alte Aufführungspraxis zu studieren. Die Vorbereitung auf Iphigénie en Tauride war eine fantastische Gelegenheit für mich, die griechische Mythologie zu studieren, aber auch, mich in Goethes Iphigenie zu vertiefen. Ausserdem habe ich mich natürlich intensiv mit Gluck beschäftigt und damit, wie er die Oper seiner Zeit revolutioniert hat.
Was macht diese Oper Ihrer Meinung nach für ein heutiges Publikum interessant?
Das Stück erzählt von Tod, von Trauer und von der Zerstörung einer Familie. Dennoch ist die Darstellung dieser dramatischen Situationen nicht exhibitionistisch. Gluck beschreibt das Leiden seiner Figuren sehr respektvoll und sensibel. Dadurch kann sich das Publikum auch heute, 200 Jahre nach der Uraufführung, immer noch sehr gut in diese leidenden Menschen hineinversetzen. Gluck will nicht beeindrucken; er will sein Publikum berühren. Diese Oper ist verstörend. Sie berührt uns tief im Innern.
In letzter Zeit haben Sie sehr intensiv mit dem Dirigenten Gianluca Capuano zusammengearbeitet. Was schätzen Sie an ihm?
Ich gehe sehr gern mit ihm auf musikalische Expeditionen, denn wir teilen das Interesse an historischer Aufführungspraxis. 2016 habe ich das Barockensemble «Les Musiciens du Prince – Monaco» gegründet, das auf historischen Instrumenten spielt. Letztes Jahr wurde Gianluca Chefdirigent dieses Orchesters – eine unglaubliche, einzigartige Konstellation! Gemeinsam erforschen wir nicht nur das barocke Repertoire, sondern auch den Belcanto. Das ist eine intensive, interessante Arbeit, die uns immer wieder neue Möglichkeiten für die Interpretation eröffnet. Und Gianluca ist genau der Richtige, um das Publikum mitzunehmen auf eine Reise durch die musikalische Revolution Glucks.
Mit Andreas Homoki arbeiten Sie dagegen zum ersten Mal zusammen. Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit?
Er ist ein fantastischer Regisseur und mittlerweile auch ein guter Freund. Er ist immer offen für Ideen, und wir arbeiten sehr gut zusammen. Ich schätze ihn und das Zürcher Opernhaus sehr. Es ist mein zweites Zuhause.
Sie sind die designierte Intendantin der Oper von Monte-Carlo. Werden Sie sich mit dieser neuen Aufgabe in Zukunft von der Bühne zurückziehen?
Die Intendanz der Oper von Monte-Carlo zu übernehmen, ist eine neue Phase in meiner Karriere, und zugleich ist es die Erfüllung eines Traums. Ich werde die erste Frau sein, die diese Position übernimmt. Ich sprudele vor Ideen und freue mich sehr darauf, die Monegassische Kulturszene mit meiner Kreativität und meiner Leidenschaft für die Musik zu bereichern. Ich freue mich auch deswegen so sehr auf meine Aufgabe an diesem Haus, weil mich mit der Oper von Monte-Carlo eine ähnlich lange Geschichte verbindet wie mit dem Zürcher Opernhaus. Aber keine Sorge, ich bleibe eine leidenschaftliche Sängerin und werde auch in Zukunft singen!
Das Gespräch führte Beate Breidenbach.
Bild von Uli Weber.
Dieser Artikel erschien im MAG 75, Januar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Pressestimmen
«Schöner kann man über Mord nicht singen. Glucks Iphigénie en Tauride begeistert am Zürcher Opernhaus: [auch] dank [...] Andreas Homokis radikal reduzierter Regie.»
Tages-Anzeiger vom 3. Februar 2020«Es ist eine Iphigénie, die nahegeht»
SRF Tagesschau vom 1. Februar 2020
Gespräch
Frau Bronfen, Glucks Oper Iphigénie en Tauride geht zurück auf ein Drama von Euripides, das wiederum eine Geschichte aus der griechischen Mythologie aufnimmt. Diese Geschichten wurden zunächst mündlich überliefert und dann um 800 vor Christus erstmals von Homer aufgeschrieben. Lässt sich heute noch sagen, wo diese Geschichten ihren Ursprung hatten? Wurden sie mit einer bestimmten Intention erzählt?
Um es mit dem Philosophen Hans Blumenberg zu sagen: Man erzählt sich Geschichten, um die Furcht zu bannen. Die griechischen Mythen beziehen sich auf die Religion in der Antike, in der man sich Götter vorgestellt hat, die sehr viel menschlicher waren, als wir das aus der judäo-christlichen Religion kennen. Der Familienstreit der antiken Götter spiegelt den Streit der Menschen auf der Erde, die göttlichen Geschlechterverhältnisse spiegeln das Geschlechterverhältnis unter den Menschen, und das Verhältnis von Herrscher und Beherrschtem spiegelt eben diese Verhältnisse unter den Menschen. Wir sehen also in den mythischen Geschichten, wie überhöhte Figuren das erfahren, was die Menschen in den Familien, in grösseren, die Gemeinschaft betreffenden Einheiten oder im Kampf zwischen Nationen durchleben. Die mythologischen Geschichten bieten im doppelten Sinn Lösungen, weil innerhalb des antiken Denkens die Idee des Schicksals ganz entscheidend ist – die Menschen sind nicht selbst verantwortlich für das, was sie tun. Sie können Entscheidungen gar nicht selbst treffen, sondern müssen erst das Orakel befragen. Die Verantwortung wird also an eine höhere Instanz abgegeben. Zudem spielen die Mythen Probleme durch und zeigen häufig Lösungen, die es in der Realität nicht gibt, eben durch das Eingreifen der Götter. Das ist übrigens auch die Analogie, die man zwischen den alten Mythen und unseren heutigen fiktionalen Erzählungen ziehen kann, sei es im Theater, im Kino oder eben in der Oper: Es wird an einem anderen Schauplatz ein Problem dargestellt...
...und wir als Publikum erkennen uns in diesem Problem wieder...
...wissen dabei aber immer, dass es überhöhte Geschichten sind, die tragische oder positive Lösungen durchspielen – und nicht die Realität.
In der heutigen Realität wäre es ja auch eher unwahrscheinlich, dass meine Tochter von meinem Mann geopfert wird, damit er in den Krieg ziehen kann, wie es in der Vorgeschichte von Iphigénie en Tauride geschieht.
Da bin ich mir nicht so sicher! Ich schaue im Moment gerade die Fernsehserie Succession, darin geht es um den sehr mächtigen Besitzer eines Medienkonzerns und um die Frage, wer sein Nachfolger werden soll. Hier werden auch Kinder geopfert, indem das eine Kind gegenüber dem anderen bevorzugt wird, oder indem ein Kind gezwungen wird, den Konzern zu übernehmen, statt die eigenen Träume zu leben.
Warum muss es denn innerhalb des Iphigenien-Mythos die Tochter sein, die geopfert wird und nicht der Sohn?
Banal gesagt: Den Sohn opfert man besser nicht, denn den braucht man ja als Krieger an seiner Seite. Die Tochter kann man eher entbehren. Töchter sind in der Antike und bis weit ins 19., ja bis ins frühe 20. Jahrhundert Teil des Tauschmaterials zwischen Männern. Wenn Töchter gegen ihren Willen verheiratet werden, um ein Machtbündnis zwischen Männern zu festigen, ist das auch eine Opferung oder sogar eine Form von Tod. Bei Iphigenie ist es ein Tausch zwischen dem Vater und einer Gottheit, bei dem die Tochter statt ins Ehebett auf den Altar kommt. Die Tochter ist der Besitz des Vaters, über den er seine Macht etablieren kann.
Geht es auch darum, die eigene Familie gegenüber der Gemeinschaft und dem grossen Ganzen zurückzustellen?
Kulturgeschichtlich sind es die Frauen, also die Mütter und Gattinnen, die auf den partikularen Interessen beharren. Durch das Opfer beweist Agamemnon, dass er aus der Position des Vaters und Ehemanns in die Position des Generals übergetreten ist, und dieses Opfer hält das Heer zusammen. Denken wir an die Geschichte von Lucrezia, die vergewaltigt wird und dann Selbstmord begeht: Ihre Leiche wird benutzt, um die Männer zusammenzuschweissen, die später die römische Republik gründen. Über dem toten Frauenkörper kommen Männer zusammen, um eine von Tötungslust und Nationalismus geprägte Kampfeinheit zu bilden. Das hat eine lange Tradition.
Agamemnon war bereit, die eigene Tochter zu opfern; wie kann Iphigenie mit diesem Trauma weiterleben?
Iphigenie ist das Lieblingskind Agamemnons, seine älteste Tochter. Das ist also auch eine Liebes- und Vertrauensgeschichte. Gleichzeitig sieht sie, dass der Vater bereit ist, sie zu zerstören. Das bedeutet nicht nur eine Infragestellung des Verhältnisses der Tochter zum Vater, sondern auch einer jungen Frau zu einem älteren, von ihr geliebten Mann. Psychoanalytisch könnte man sagen, es geht hier – in sehr stark überhöhter Weise – um etwas, das alle Töchter erfahren müssen: Sie müssen sich von ihrem Vater, mit dem sie meist die wichtigere Beziehung haben als mit der Mutter, trennen. Man kann es also auch als eine notwendige Trennungsgeschichte verstehen. Die Tochter muss erkennen: Mein Vater ist nicht mein geliebtes Gegenstück, sondern er ist ein von mir abgetrenntes Wesen, das seine eigenen Interessen meinen Interessen gegenüber privilegiert. Das hat natürlich auch etwas mit dem Erwachsenwerden zu tun.
Dann wäre also die Opferung der Iphigenie durch ihren Vater ein Bild für einen natürlichen Vorgang und gar nicht so grausam, wie sie auf den ersten Blick erscheint? Oder ist dieser «natürliche» Vorgang umgekehrt im Grunde ein sehr grausamer?
Wenn man den Mythos als Familiengeschichte liest, wird deutlich, wie grausam dieser natürliche Vorgang ist. Diese Trennung kann von den Kindern durchaus als eine Form von Opferung verstanden werden. Denn sie begreifen, dass sie dem Vater nicht absolut vertrauen können, nicht von ihm geschützt werden, Zutrauen und Liebe nicht mehr an ihm festmachen können. Erwachsenwerden heisst, zu verstehen: Der Vater ist kein Übermensch, der Vater ist sowohl gut als auch böse, er wird mich nie schützen können. Tod und Opferung sind in der Mythologie Chiffren. Man darf das nicht immer wörtlich nehmen und muss es übersetzen: Es geht um Begeisterung, Hingabe, Abtrennung, Lust. Diese Geschichten lassen sich sehr zeitgenössisch lesen.
Glucks Iphigénie en Tauride hat Ereignisse zum Thema, die lange nach der Opferungsszene stattfinden, denn Iphigénie wurde auf dem Opferaltar im letzten Moment von der Göttin Diana gerettet und lebt nun seit 15 Jahren als Priesterin der Diana auf Tauris. Dort sieht sie im Traum die Gewalt, die ihre Familie in der Zwischenzeit zerstört hat. Ihr Bruder Orest wird – ebenfalls im Traum – von den Eumeniden verfolgt, den Rachegöttinnen, die ihm den Mord an seiner Mutter Klytämnestra vorwerfen. Welche Rolle spielen Träume in dieser Geschichte?
Innerhalb der Antike ist Wachen und Träumen nicht so strikt voneinander getrennt wie bei uns. Oft geht es dabei um Prophezeiungen, in denen die Götter mit den Menschen sprechen. Bei Gluck geht es darum, dass wir in unseren Träumen unsere Ängste, unsere positiven oder negativen Erwartungen oder unsere Schuld durchspielen, Dinge, die wir so direkt nicht ausdrücken können. Es ist wie eine Geschichte, die man sich selbst erzählt, es kommen Dinge zum Ausdruck, die wir im Licht des Tages nicht zulassen würden. Es ist chiffrierte Fantasiearbeit, Theater im Theater oder auch ein inneres Theater, das sowohl die Theatersituation reflektiert als auch die Theatralität unseres Seins in der Welt. Wir beobachten uns hier selbst.
Interessant ist, dass die Grenzen zwischen Realität, Traum, Erinnerung, Fantasie in Glucks Oper sehr fliessend zu sein scheinen.
Für mich ist auch der Krieg letztlich eine Fantasie. Es hat etwas geradezu Rauschhaftes, wenn die Männer als eine Einheit gegen Troja ziehen, und es hat auch etwas Rauschhaftes oder Traumartiges, wenn der Vater die Tochter nicht mehr als Tochter sieht und bereit ist, sie für diesen Krieg zu opfern.
Neben den Träumen ist auch die Todessehnsucht der Hauptfiguren auffallend. Iphigénie möchte lieber sterben, als weiter auf Tauris Menschen zu opfern. Orest wird so sehr von seiner Schuld gequält, dass er den Tod herbeisehnt, und Pylades, Orests Freund, möchte lieber selbst geopfert werden, als seinen Freund dem Tod zu überlassen. Selbstmord scheint aber für keine dieser Figuren eine Option zu sein.
Zur Zeit Glucks beginnt sich zu zeigen, dass in der bürgerlichen Familie etwas nicht stimmt: Es geht nicht nur um das Verhältnis zwischen Gatte und Gattin, sondern auch um das zwischen Eltern und Kindern und zuweilen auch Schwestern und Brüdern. Die Todessehnsucht der verschiedenen Figuren kann man sehen als Erlösungsfantasie aus der Unmöglichkeit heraus, sich zurechtzufinden in einem System, in dem mir so vieles vorgeschrieben und in dem mein Begehren nicht mit meinen Pflichten zu vereinbaren ist. Damit wird diese Todessehnsucht auch zu einer Kritik an der Familieneinheit: Diese bürgerliche Familie, die stark von der Aufklärung, von einem paternalen, rationalen Denken und von ebensolchen Gesetzen getrieben ist, hat etwas Zerstörerisches. Ich denke da immer an den Streit zwischen der Königin der Nacht und Sarastro in der Zauberflöte: Er setzt mit absoluter Brutalität auf Aufklärung, während sie noch dem magischen Denken verhaftet ist. Dieser Streit zwischen den Eltern frisst die Kinder auf. Deren Todessehnsucht wird dreissig Jahre nach Gluck in der Romantik bei Novalis, Kleist und anderen ihre grosse Blütezeit haben.
Der Fluch der Familienmorde, von dem Agamemnons Geschlecht nicht loskommt, wird durch die Göttin Diana gelöst. Es sind also wiederum nicht die Menschen, die eigenverantwortlich Entscheidungen treffen, sondern die Götter müssen eingreifen, um eine Lösung herbeizuführen.
1779, als Glucks Oper entstanden ist, konnte man noch akzeptieren, dass nur die Götter in der Lage sind, eine Lösung herbeizuführen. Zehn Jahre später, nach der französischen Revolution, wird man sich dann nicht mehr vorstellen können, dass die Menschen zu keiner eigenen Entscheidung fähig sein sollen – dann häufen sich übrigens auch die Selbstmorde oder Liebestodfantasien wie etwa in Wagners Tristan und Isolde. Zur Zeit Glucks gibt es für die Erkenntnis des Unbehagens an der bürgerlichen Familie und an den bürgerlichen Gesetzen mit all ihren Zwängen nur auf der Ebene der Götter eine Lösung. Umgekehrt könnte man auch sagen, das Eingreifen der Göttin ist wie die letzte Feier des noch nicht mündigen individuellen Subjekts. Das absolut mündige individuelle Subjekt gipfelt im revolutionären Subjekt, das dann später in Frankreich den König umbringt. Hier wird eine Art Umbruchphase markiert.
Eine solche Umbruchphase scheint sich auch in dieser Oper zu spiegeln: Iphigénie trifft selbständig die Entscheidung, einen der beiden Gefangenen frei zu lassen. Dann geht sie noch einen Schritt weiter und entscheidet – als sie erkennt, dass der zweite Gefangene ihr Bruder ist –, diesen auf keinen Fall zu opfern. Sie ist also durchaus zu einer selbstbestimmten Handlung fähig. Die Göttin Diana erscheint erst, als die wichtigste Entscheidung bereits getroffen ist, sie ist also strenggenommen gar keine Dea ex machina mehr.
Hier treffen zwei Denksysteme aufeinander, und es ist interessant, dass es die Frau ist, also das weibliche Subjekt, das auf ihrer Handlungsbefähigung insistiert und im Gegensatz zu ihrem Vater die Göttin herausfordert.
Die Figur Iphigénie ist in dem Moment, in dem sie geopfert werden soll – also noch in der Vorgeschichte der Oper – dem Willen der Götter und dem Willen ihres Vaters ausgeliefert, entwickelt sich aber im Laufe der Oper zu einer aktiven, selbst handelnden Figur.
Dass die Göttin am Schluss noch einmal auftritt, das wirkt wie eine Konzession an die Konvention, von der man aus heutiger Perspektive sagen könnte, dass sie sogar als Konvention ausgestellt wird. Die Dea ex machina wird dekonstruiert und bleibt ein leerer Gestus. Die Tochter erhält die Handlungsbefähigung und durchbricht den Kreislauf der Gewalt.
Und die Göttin erkennt die Handlungsfreiheit Iphigénies an und verzeiht.
Am Anfang und am Ende der Geschichte steht die Göttin, aber die wandelt sich und insistiert nicht mehr auf dieser auf Gewalt basierenden Wiederholungsschleife von «Frauenraub fordert Krieg fordert Frauenopfer fordert noch mehr Krieg». Sie insistiert deshalb nicht, weil sie in einer Tochter etwas sieht, was ihr ein anderes Modell vorgibt. Das würde ich potenziell feministisch nennen.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach.
Dieser Artikel erschien im MAG 75, Januar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Porträt

Es ist Mittagspause auf der Probebühne am Escher-Wyss-Platz. Nur der nachtschwarze, weit in die Tiefe gehende Bühnenraum lässt etwas von der Tragik des Stücks erahnen, das hier geprobt wird. Am Klavier unterhält sich der Sänger Stéphane Degout mit dem Dirigenten Gianluca Capuano. Aber der von Rachefurien bedrängte Muttermörder Orest, den Degout in der Zürcher Neuproduktion von Glucks Iphigénie en Tauride gibt, ist weit weg: Die beiden sprechen über Essen. Der Franzose empfiehlt dem Italiener die besten Restaurants und Brasserien von Lyon.
Der französische Sänger als schwärmerischer Gourmand – das mag wie ein Klischee wirken, ist bei Stéphane Degout aber nur Ausdruck von Heimatliebe, denn er lebt in Lyon und ist in dieser Stadt, die für ihre Gastronomie berühmt ist, gross geworden. Und er pflegt ein inniges Verhältnis zur Kultur seines Heimatlands auch jenseits der Haute Cuisine. Begonnen hat das schon zur Schulzeit mit Stéphanes Begeisterung für die französische Sprache: «Wir mussten damals regelmässig Gedichte auswendig lernen und aufsagen. Ich habe es geliebt!», erinnert er sich. Um an Theaterworkshops teilzunehmen, zieht Stéphane vom Land nach Lyon. Dort singt er bald auch im Chor und wird von seinem Lehrer ermutigt, Gesangsunterricht zu nehmen. Die Stimme entwickelt sich erfolgreich: Stéphane wird Student am Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon und anschliessend Mitglied im Atelier Lyrique, dem Nachwuchsprogramm der Opéra de Lyon, wo er bald auch zum ersten Mal auf der Opernbühne steht.
Seinen ersten grossen Erfolg erlebt er beim Festival d’Aix-en-Provence allerdings mit einer ganz und gar unfranzösischen Partie, nämlich als Vogelfänger Papageno (dem Feinschmecker!) in Mozarts Zauberflöte. «Als Stéphane Lissner 1998 die Leitung des Festivals übernahm», erzählt Degout, «gründete er dort eine Académie, die zur Nachwuchsförderung bestimmt und bis heute ein wichtiger Bestandteil des Festivals ist.» Degout hatte das Glück, zu den ersten Mitgliedern zu gehören, zu den Lehrenden gehörten damals Sängerinnen wie Régine Crespin und Gundula Janowitz – für Stéphane eine prägende Erfahrung – «wenn auch sprachlich sehr herausfordernd, denn Papageno wird ja meist von Muttersprachlern gesungen und gerne mit Wiener Dialekt gesprochen.»
Mit seiner Liebe zu sprachlichen Details hängt es wohl zusammen, dass der Bariton heute besonders das französische Repertoire intensiv pflegt und stetig erweitert. Seit er im vergangenen Jahr beiden «Victoires de la musique» als Sänger des Jahres geehrt wurde und für seine Alben mit Musik von Debussy, Berlioz, Rameau und Gluck einen «Grand Prix» der Académie Charles Cros erhalten hat, wurde er in den französischen Medien gar als «Prince du chant français» bezeichnet.
Es fasziniert Degout, wie konsequent man die musikalische Entwicklung seiner Muttersprache durch die Jahrhunderte hindurch verfolgen kann: «Jeder Komponist nutzt die klanglichen Möglichkeiten der Sprache auf ganz unterschiedliche Weise», sagt er, und nennt als Beispiel Jean-Baptiste Lully, bei dem die Sprache beinahe rezitiert wird wie in der gesprochenen Tragödie. «Auf ihn folgen die grossen Neuerer Rameau und Gluck, dann Berlioz, der mit den Nuits d’été einen ersten französischen Liederzyklus mit Orchesterbegleitung komponierte, und schliesslich Debussy, der sich wiederum mit dem Sprachgebrauch Rameaus auseinandersetzte.» Auch bei Glucks Tragédie Iphigénie en Tauride kommt er gleich auf den «qualitativ hochstehenden» Text des Librettisten Nicolas-François Guillard zu sprechen.
Mit Sprachen, die er weniger gut kennt als seine eigene, ist Stéphane vorsichtig, mit fremdsprachigen Opernrollen entsprechend wählerisch. Zu den wenigen italienischen Partien, die er in letzter Zeit gesungen hat, zählt der Graf Almaviva in Mozarts Le nozze di Figaro (2019 am Théatre des Champs-Élysées). Im kommenden Frühjahr wird er mit Jeletski in Tschaikowskis Pique Dame erstmals eine russische Partie singen. «Vor zwei Jahren habe ich als Marquis Posa meine erste Verdi-Oper gesungen. Ich habe dieses Angebot aber nur angenommen, weil der Don Carlos in Lyon in der originalen französischsprachigen Fassung auf die Bühne kam.»
Ganz frei sei man natürlich nicht in der Wahl der Rollen, sagt Degout, es sei ihm aber stets wichtig, der natürlichen Entwicklung und den Möglichkeiten seiner Stimme zu folgen – und das bedeutet auch, sich zur rechten Zeit von Partien zu verabschieden. So hat er beispielsweise 2016 beim Festival d’Aix-en-Provence zum letzten Mal Debussys Pelléas gesungen – immerhin in einer Inszenierung von Katie Mitchell, die er als Regisseurin besonders schätzt, «das hat es einfacher gemacht, diese wichtige Partie gehen zu lassen». Andere Theatermacher, die er als besonders prägend in Erinnerung hat, sind die beiden verstorbenen Regisseure Patrice Chéreau, in dessen legendärer Inszenierung von Così fan tutte er 2005 den Guglielmo sang, oder Klaus Michael Grüber, mit dem er 2002 Don Giovanni erarbeitete, «obwohl ich damals eigentlich zu jung dafür war...». Ausserdem nennt er den französischen Regisseur und Dramatiker Joël Pommerat. Mit seiner ganz besonderen Art, Theater zu machen habe der ihn mit zeitgenössischer Musik in Verbindung gebracht.
Am Opernhaus Zürich hat Stéphane Degout bisher noch nicht gesungen. Jetzt steht er hier als Orest auf der Probebühne. Regisseur Andreas Homoki probt eine Szene aus dem dritten Akt: Orest und sein Freund Pylades (gesungen von Frédéric Antoun) streiten sich geradezu um das Vorrecht, für den anderen sterben zu dürfen. Stéphane hat die Partie bereits in Wien und Paris auf der Bühne gesungen – aber er gesteht, dass es für ihn immer noch ungelöste Fragen zu diesem komplexen mythologischen Charakter gibt. Das Schicksal Orests ist auf der Opernbühne vor allem durch Richard Strauss’ Elektra bekannt: Um seinen Vater Agamemnon zu rächen, bringt Orest dort seine eigene Mutter Klytämnestra um. Seither wird er von Rachegöttinnen verfolgt, die ihn in einen andauernden Wahnzustand versetzen. In Glucks Oper trifft Orest auf seine totgeglaubte Schwester Iphigénie. Doch die Geschwister erkennen sich zunächst nicht. «Iphigénie hat als Priesterin den Auftrag, Fremdlinge, die sich dem Ort Tauris näheren, zu opfern», erklärt Stéphane, «und geopfert zu werden, beziehungsweise endlich zu sterben, ist eigentlich das einzige Verlangen, das Orest in seiner verzweifelten Situation noch hat». Dann fügt er hinzu: «Ich frage mich manch mal, warum Orest seine Todessehnsucht nicht einfach selbst befriedigt, und sich umbringt. – Oder war das in der Antike verboten?» Hätte Orest sich umgebracht, gäbe es freilich den inneren Zwiespalt nicht, den diese Figur so stark macht, sein Kampf mit den Eumeniden, seine Schuldgefühle, die Verzweiflung – und genau aus diesen extremen Empfindungen speist sich die musikalische Gestaltung Glucks, die Degout sehr bewundert: «Die Umsetzung von Orests Wahnsinn durch Gluck ist genial! Seine Musik ist, mit Ausnahme einer kurzen Schlaf szene im zweiten Akt, immer völlig aufgebracht, oft beinahe schreiend, fast naturalistisch verzweifelt. Erst im vierten Akt, wenn Orest glaubt, dass er nun endlich geopfert wird und sterben kann, scheint er auf einmal gelöst und seine Musik wird ganz ruhig.»
Auf dem Album Enfers, das Stéphane Degout gemeinsam mit dem französischen Dirigenten Raphaël Pichon zusammengestellt und aufgenommen hat, sind Ausschnitte der Orest-Partie zu hören. «Dieses Album ist eine Art Hommage an Henri Larrivée, der in der Uraufführung von Glucks Iphigénie en Tauride den Orest gesungen hat. Wir haben dafür Nummern aus verschiedenen Werken kombiniert, welche dieser damals sehr bekannte Bariton interpretiert hat. Neben Musik von Gluck sind das auch Ausschnitte aus Opern von Jean-Philippe Rameau.» Auch dieses furiose Album ist ein Beispiel dafür, wie detailliert sich Stéphane Degout mit der Geschichte und den musikalischen Traditionen und Entwicklungen der französischen Oper beschäftigt.
Wenn Stéphane nach der Probe den Klavierauszug zugeklappt hat und den Orest samt den mit ihm verbundenen Fragezeichen darin ruhen lässt, wird er sich vermutlich ein Glas Beaujolais und eine gute Mahlzeit gönnen. Schliesslich muss er seinem Ruf gerecht werden. Auf seinem Twitter-Profil beschreibt er sich nämlich als «Chevalier de la Fourchette, souventen vadrouille, rarement le ventre vide – Ritter der Gabel, oft auswärts, selten mit leerem Magen».
Text von Fabio Dietsche.
Bild von Jean-Baptiste Millot.
Dieser Artikel erschien im MAG 75, Januar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Essay
In der Familiengeschichte des Atridengeschlechts, dem auch Iphigenie entstammt, ist viel Blut geflossen. Begonnen hat die endlose Kette der Gewalt mit Tantalos, dem Urahn der Familie: Er wollte die Allwissenheit der Götter auf die Probe stellen und setzte ihnen seinen eigenen Sohn zum Mahl vor. Die Götter durchschauten ihn und verbannten Tantalos zur Strafe in die tiefsten Tiefen der Unterwelt, wo er seither unvorstellbaren Qualen ausgesetzt ist, den sprichwörtlichen Tantalosqualen. Die Götter verfluchten zudem seine Nachkommen: Jeder seiner Nachfahren solle bis in alle Ewigkeit ein Familienmitglied töten und immer weiter Schuld auf sich laden.
Als eines Tages der Aufbruch des Heeres in den trojanischen Krieg kurz bevorstand, versammelte sich das griechische Heer in Aulis. Der Heeresführer Agamemnon ging auf die Jagd und tötete dabei eine Hirschkuh. Diese war der Göttin Artemis jedoch heilig, und Agamemnon wurde von ihr mit Windstille bestraft. Daraufhin befragten die Griechen einen Seher. Dessen Vision zeigte, dass Agamemnon seine Tochter Iphigenie der Göttin Artemis opfern müsse; zum Wohle seines Heeres war Agamemnon dazu auch bereit. Doch die Göttin verspürte Mitleid mit dem Mädchen, und kurz bevor das Messer des Vaters Iphigenie traf, rettete sie diese und brachte sie nach Tauris. Vor Agamem non aber lag nun eine Hirschkuh, und er glaubte, die Tochter für immer verloren zu haben.
Der Fluch des Tantalos hatte also in Agamemnons Familie ein neues Opfer gefordert. Weitere sollten folgen: Klytämnestra, Agamemnons Frau, verzieh ihrem Mann die Opferung der Tochter nie und ermordete ihn. Um den Tod seines Vaters zu rächen, brachte Orest seine Mutter Klytämnestra um. Seitdem wird Orest von grausamen Rachegöttinnen verfolgt. Um sich von seiner quälenden Schuld zu befreien, befragt Orest das Orakel Apollos. Dieses rät ihm, er solle auf der Insel Tauris die Statue der Artemis holen und nach Athen bringen.
Auf Tauris, wo das barbarische Volk der Taurier unter der Herrschaft des Königs Thoas lebt, muss Iphigenie seit ihrer Rettung durch Artemis der Göttin alle dort Gestrandeten opfern. Der König hatte nämlich die Vision, dass ein Fremder ihn eines Tages umbringen werde.
Kaum auf der Insel eingetroffen, werden Orest und sein Freund Pylades sogleich entdeckt und als Opfer zum Tempel geführt. Die Priesterin Iphigenie erfährt, dass Orest aus ihrer Heimatstadt kommt, und fragt ihn sogleich nach Agamemnons Familie, ohne zu wissen, dass es ihr Bruder ist, der vor ihr steht. Sie bittet ihn, zurück zu segeln und ihrer Familie einen Brief zu überbringen. Doch Orest fleht Iphigenie an, Pylades zu schicken, denn sein Freund verdiene den Tod viel weniger als er selbst. Um sicherzugehen, dass die Botschaft ankommt, erzählt die Priesterin den Griechen, was in dem Brief steht: «Iphigenie lebt.» Da erkennt Orest seine Schwester.
Nun plant Iphigenie die Flucht: Sie berichtet dem König Thoas von den blutigen Taten der beiden Griechen. Sie seien unrein und müssten im Meer gereinigt werden. So auch die Statue, da Orest diese berührt habe. Thoas bleibt zurück, weil er das heilige Ritual nicht stören will, und die Fliehenden haben genug Zeit, um das griechische Schiff zu erreichen. Doch der Wind treibt sie zurück, und Thoas erfährt von dem Verrat. Bevor die Taurier den Strand erreichen, erscheint die Göttin Athene. Unter ihrem Schutz soll die Statue der Artemis nach Athen gebracht werden. Ausserdem befreit sie Orest von seiner Schuld. Thoas akzeptiert das Urteil der Göttin und lässt die Griechen mit der Statue fortsegeln.
Glucks Oper «Iphigénie en Tauride» weicht vom Mythos ab. Pylades segelt mit dem Brief nicht zurück nach Griechenland, sondern versteckt sich auf der Insel, um seinen Freund zu retten. Iphigénie bricht die Opferung ab, als sie ihren Bruder Orest erkennt. Wütend eilt Thoas zum Tempel, doch bevor er die Geschwister umbringen kann, stürmt Pylades hinein und tötet den König. Ein Krieg bricht aus. Da erscheint die Göttin Diana (griechisch Artemis), schlichtet den Streit und befreit Orest von seiner Schuld. Dieser soll bis zu seinem Tod als König über Mykene herrschen, und Iphigénie wird als Priesterin in Athen leben.
Text von Laura Minder.
Dieser Artikel erschien im MAG 75, Januar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
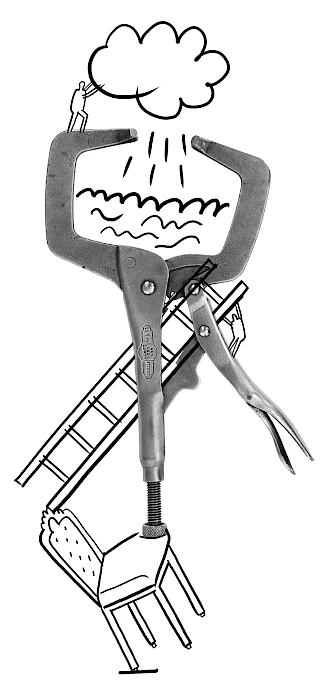
Risse im Bühnenbild
Das Bühnenbild unserer Neuproduktion Iphigénie en Tauride wird in den Rezensionen zumeist als schlichter schwarzer Raum beschrieben – doch das ist nur der erste Eindruck, beim genaueren Hinblicken erweist er sich nämlich bald als spektakulär. Es ist ein schwarzer, perspektivisch sich verjüngender Raum, ohne Ein- und Ausgänge, eine Art Höhle, Höllenschlund oder Abgrund. Keine Naht, nichts ist erkennbar. Und dennoch können in diesem Raum plötzlich Figuren aus dem Nichts erscheinen...
Das Bühnenbild unserer Neuproduktion Iphigénie en Tauride wird in den Rezensionen zumeist als schlichter schwarzer Raum beschrieben – doch das ist nur der erste Eindruck, beim genaueren Hinblicken erweist er sich nämlich bald als spektakulär. Es ist ein schwarzer, perspektivisch sich verjüngender Raum, ohne Ein- und Ausgänge, eine Art Höhle, Höllenschlund oder Abgrund. Keine Naht, nichts ist erkennbar. Und dennoch können in diesem Raum plötzlich Figuren aus dem Nichts erscheinen: Auf einmal öffnet sich ein gleissend weisser Riss, der immer weiter aufgeht, bis Gestalten durch ihn hineindringen können. Sekunden später ist der Riss wieder weg. Nahtlos geschlossen. Pechschwarzes Dunkel. Nur die Gesichter eines Chores zeichnen sich gespensterhaft im tiefen Schwarz ab. Im grossen Finale bricht dann sogar Tageslicht durch unzählige Risse in den Raum und löst ihn nahezu auf, bevor er sich am Ende wieder in den schwarzen Schlund des Nichts verwandelt.
Wir haben dieses magisch wirkende Bühnenbild aus neun fahrbaren Wagen zusammengesetzt, die hintereinander auf einer nach hinten ansteigenden Schräge stehen. Jeder Wagen hat einen Boden, eine Decke und zwei Seitenwände. Der vorderste ist 14 m breit und 9 m hoch, steht direkt hinter der Bühnenöffnung, verjüngt sich aber nach hinten. Die Wände, der Boden und die Decke vom zweiten bis zum letzten Wagen sind so passgenau gefertigt, dass sie nahtlos an den jeweils vorderen Wagen anschliessen und immer kleiner werden: Von vorne gesehen erhält man den Blick in einen liegenden viereckigen Trichter. Der hinterste Wagen bildet den Abschluss und ist nicht einmal mehr 2m breit und hoch. Er ist mit aufklappbaren Seitenwänden ausgestattet, durch welche die Darstellenden unbemerkt im vollkommenen Dunkel verschwinden oder auftauchen können. Die Kanten jedes einzelnen Wagens sind nicht gerade gebaut, sondern wie Bruchkanten zackig geschnitten. Sie passen jeweils zentimetergenau in den nächsten Wagen, so dass man sie aus dem Zuschauerraum nicht wahrnehmen kann.
Um nun Risse im Bühnenbild entstehen zu lassen, müssen wir diese Wagen auseinanderfahren. Dazu haben wir an der Rückseite jedes Wagens Seile angebracht, mit denen wir den Wagen die Schräge hochziehen können. Wenn wir nun z.B. die fünf letzten Wagen hochziehen, entsteht ein Schlitz zwischen dem vierten und fünften Wagen. Zum Schliessen lockern wir die Seile, und die Wagen rollen von allein die Schräge hinunter, bis sie aneinanderstossen und geschlossen sind. Wenn zwischen allen Wagen Risse entstehen sollen, ziehen wir jeden Wagen auf eine ganz bestimmte Position in einer genau definierten Geschwindigkeit. Gut sichtbar werden die Risse, wenn wir von aussen mit sehr hellen Scheinwerfern in den Raum hineinleuchten.
Die Seile wären gefährliche Stolperfallen auf der Bühne. Wir haben sie deswegen ganz unten an den Wagen befestigt und in Nuten im Boden eingelassen.
Da die vorderen grossen Portale fast eine Tonne wiegen und teilweise der ganze Chor mitfährt, können wir natürlich nicht von Hand an den Seilen ziehen: Die Seile werden am Ende der Schräge mit einer Rolle nach oben umgelenkt und sind an unsere Zuganlage angeschlossen. Diese kann computergesteuert und lautlos alles perfekt auf die gewünschten Positionen fahren. Mit welchem genialen Trick wir es schaffen, in diesem «schlichten» Raum nur die Gesichter von über 60 Personen anzuleuchten – und sonst nichts –, ist ein eigenes Kapitel wert und vielleicht einmal an dieser Stelle nachzulesen.
Text von Sebastian Bogatu.
Illustration von Anita Allemann.
Dieser Artikel erschien im MAG 76, Februar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Volker Hagedorn trifft...

Brüssel zur Rushhour, ein Winternachmittag mit Sonne, die Strassen sind ebenso voll wie die Bürgersteige. Wo ist denn nur der Haupteingang des Palais des Beaux Arts, das sie einfach «Bozar» nennen? Die runde Ecke hier an der Rue Ravenstein? Mit Shops und Cafés hinter den Glastüren? Schnell mal eine SMS schreiben. Zwei Sekunden nach der Antwort «coming» sehe ich einen Mann aus dem Gebäude treten, der könnte es sein. Er ist es auch. Sie sollten bei der Agentur mal das Foto aktualisieren, ich hatte mit einem Mittzwanziger gerechnet. Gianluca Capuano schätze ich auf Anfang vierzig. Mittelgross, schlank, bärtig, freundlich, mit wachem Blick und einem Zigarillo in der Rechten. Den raucht er noch zu Ende und freut sich, dass ich mir auch eine anzünde.
Auf wie verschiedene Weisen man sich mit Künstlern treffen kann! Manche habe ich auf der Bühne erlebt, andere nur kurz in der Probe, mal trifft man sich in der Kantine, mal geht man spazieren. Von den einen gibt es meterweise Archivmaterial und dreissig Mitschnitte bei Youtube. Bei anderen ist es, als vermieden sie es, allzu breite Spuren zu hinterlassen. Zu ihnen zählt Capuano, der doch mehr als gut beschäftigt ist von Hamburg bis Salzburg und jetzt gerade mit Cecilia Bartoli durch Europatourt. Dann kommt Zürich, wo er Glucks Iphigénie en Tauride dirigieren wird. «Wir können gern deutsch reden», sagt er, während wir reingehen und einen Platz im Café suchen. Da ist es zu voll und zu laut. Tiefer hinein ins Gebäude.
Deutsch hat der Mailänder in Freiburg gelernt, während eines zweijährigen Studiums der Philosophie. «Bei Freiburg und Philosophie fällt einem Halbgebildeten erstmal Heidegger ein», sage ich, Capuano lächelt. «Seinetwegen war ich auch da. Ich wollte bei Heideggers letzter Schülerin promovieren – aber dann wurde es mit der Musik zu viel.» Wir gehen durch immer leerere Flure, bis wir seine Garderobe erreicht haben. Er füllt an der kleinen Kaffeemaschine zwei Tassen. «Ich habe es immer geliebt, mit Stimmen zu arbeiten», meint er. «Die mysteriöse Welt der Stimmen hat viele philosophische Implikationen. Musik und Sprache sind sich in ihr so nah. Hier liegt der Schlüssel, um Musik zu verstehen. Es fasziniert die Philosophen, wie die Stimme, dieses Immaterielle, so viele Bedeutungen haben kann.»
Er empfiehlt mir Flatus vocis von Corrado Bologna und verschweigt, dass er auch ein Buch publizierte. Darauf stosse ich viel später, als ich seinem Tipp nachgehe und Bologna zitiert finde in diesem Band von 220 Seiten: I segni della voce infinita (Die Zeichen der unendlichen Stimme – Musik und Schrift), vor siebzehn Jahren in Mailand erschienen. Dort kam Capuano 1968 zur Welt, und dort fand er noch vor der Philosophie zur Musik. An seinen «total nicht musikalischen» Eltern lag das nicht, eher schon an einer Grossmutter, «die eine grosse Leidenschaft für die Oper hatte. Ich nehme an, das ist der Ursprung meines Interesses für Stimmen.» Und es gab einen Nachbarn, der Orgel spielte. Als der achtjährige Gianluca ihn in einem Konzert hörte, «war das die Offenbarung. Ich habe gesagt, das ist mein Instrument. Es gab Privatunterricht, und mit dreizehn, vierzehn habe ich im Konservatorium weitergelernt.»
Zur Alten Musik führte ihn seine Liebe zu Bach und Buxtehude, «von da ging ich rückwärts zum Italien des 17. Jahrhunderts», und zwar an der wichtigsten Adresse für Italiener, die das Spiel in historischer Aufführungspraxis lernen wollen: Die ehrwürdige Mailänder Civica Scuola di Musica, genauer, deren Institut für «Musica Anti ca». Hier begann vor ihm auch Giovanni Antonini seinen Weg, der Flötist und Gründer von Il Giardino Armonico, und beider Wege würden sich später sinnreich kreuzen… Zunächst aber gründete Capuano, inzwischen versierter Cembalist und Barockorganist, sein Ensemble Il canto di Orfeo, und er spielte mit bei den Barocchisti, die 2012 mit Cecilia Bartoli das Album Mission mit Musik von Agostino Steffani aufnahmen. Lassen wir mal die Frage beiseite, wie und wann er ausser Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch auch noch genug Russisch lernte, um Bulgakows Der Meister und Margarita im Original zu lesen. Er war jedenfalls, dank seiner Liebe zu Stimmen, Chorleiter jener Norma vor fünf Jahren in Salzburg, bei der Antonini La Scintilla dirigierte und Cecilia Bartoli die Titelrolle sang. Und er war auch dabei, als die Produktion in Edinburgh gastierte und im letzten Moment der Dirigent ausfiel. Capuano übernahm und überzeugte. «Das war meine erste Erfahrung als Dirigent mit Cecilia, eine grosse Verantwortung. Seitdem mache ich fast alle Produktionen mit ihr. Es gibt eine besondere Chemie. Ich liebe es, wie sie mit dem Text umgeht, das ist einzigartig.»
Das heisst viel bei einem, dem die Beziehung zwischen Text und Musik und die Rhetorik so immens wichtig sind. Sie geht weit über die paar Affekte hinaus, die jeder Barockmusiker von heute kennt. «Es ist ein unendlicher Katalog, der auch theologische Aspekte hat. Früher lernten das schon die Kinder, wie Latein. Man findet dieselben Figuren bei Bach und Mozart, Gluck und Rossini, bis zum Belcanto. Man muss nur wissen, was das bedeutet, und auf der Basis musizieren. Das ändert viel, auch in der Instrumentalmusik. Die Zeichen der Komponisten sind natürlich nicht immer unmittelbar klar. Und umso schwächer, je weiter man zurückgeht. Unsere Arbeit ist die Hermeneutik der Zeichen, die Auslegung. Die Philosophie ist immer da!» Er lacht. Genau darin sieht er auch einen Weg zur Musik von Gluck, die nach ihrem Pariser Revival durch Hector Berlioz nie wieder anhaltend populär wurde. Bei Mozart, meint der Dirigent, könnten die wunderschönen Melodien den Musikern wie den Hörern «sozusagen ersatzweise» hinweghelfen über das verlorene Wissen, bei Gluck nicht. Der sei aber mit seinen expressiven Rezitativen ein Modell für Mozart und setze auf neue Weise fort, was Monteverdi begann, «dieses Experiment mit Monodie und sprezzatura, eine gewisse Freiheit, für die Stimme zu schreiben. Übrigens tat Monteverdi das mit Orfeo im selben Jahr, als in Japan das Kabuki entstand, das moderne Musiktheater. Wirklich erstaunlich!»
Bis vorhin hatte ich eigentlich gedacht, in der Alten Musik sei soweit alles klar. Capuano lacht herzhaft. «In der Tat ist nichts klar! Viele Musiker haben das Verhältnis von Text und Musik total vergessen. Für mich ist es wichtig, immer mit Wissenschaftlern im Gespräch zu sein. Aber wer sagt, ich habe die Wahrheit gefunden, liegt falsch. Ich mag die Taliban der Alten Musik nicht, die behaupten, so habe es zu sein. Wir kommen nicht an ein Ende. Die letzte Generation hat einer obsessiven Akzentuierung abgeschworen. Man hatte am Anfang ein wenig übersehen, dass es auch eine Horizontalität der Musik gibt. Aber einige Punkte sind fixiert: Bach ohne Darmsaiten kann ich mir nicht vorstellen.»
Also ist er selbst doch ein bisschen «Taliban»? «Teilweise.» Er grinst. Und dass Opern meist kein bisschen «historisch» inszeniert werden? «Zum Glück! Es geht um Wahrhaftigkeit, Glaubwürdigkeit, nicht um Authentizität. Wenn wir die Marienvesper von Monteverdi im Konzert hören, entspricht das auch nicht ihrem ursprünglichen Zweck. Mit dem, was man sieht, kann man die Tiefe dessen, was man hört, entdecken und verstärken. Das ist eine Idée fixe von mir. Aber ich kenne viele Kollegen, die Regisseure geradezu verabscheuen – als ob die Musik etwas Reines wäre.»
Wie weit reicht sein Repertoire? Ein unhörbares Seufzen. «Jetzt bin ich vor allem Spezialist für Belcanto, natürlich freut mich das. Aber wenn mich jemand fragen würde, willst du Strawinsky oder Alban Berg dirigieren, wäre ich begeistert. Das würde ich gern machen. Auch Zeitgenössisches. Und mehr Monteverdi und Cavalli…» Als ich wieder auf der Rue Ravenstein stehe, haben wir erst 45 Minuten geredet. Wirklich? Die Zeit ist ein sonderbar Ding.
Text von Volker Hagedorn.
Dieser Artikel erschien im MAG 75, Januar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Die geniale Stelle
«Aber Meister, was ist das? Hier scheint Euch etwas Menschliches widerfahren zu sein. Wenn Orest von der Ruhe singt, die in sein Herz zurückkehrt, wie könnt Ihr das Orchester eine so unruhige Begleitung spielen lassen?» – «Er lügt! Er hat seine Mutter ermordet. Wie könnte er Ruhe finden?»
Der sich hier so leidenschaftlich verteidigt, ist Christoph Willibald Gluck, der gerade einem erlesenen Kreis von Musikkennern Teile aus seiner neuen Oper vorgespielt hat. Dieses Gespräch, das in nahezu allen Gluck-Biografien zitiert wird, mag so oder ähnlich abgelaufen sein, die Quellen geben verschiedene Varianten, aber selbst wenn es gar nicht stattgefunden haben sollte, wäre dies eine jener Erzählungen, von denen man sagt: «Wenn sie nicht wahr ist, ist sie gut erfunden.» Denn sie öffnet die Augen für das Originelle, das bis dahin im Wortsinne «Unerhörte» der besagten Stelle, an der sich Gluck als grosser Komponist und kühner Neuerer erweist.
Orest ist auf der Flucht vor seinem Gewissen und sucht rastlos nach dem Ort, wo er seiner Schuld ledig werden kann. So geriet er nach Tauris, wo ihm der Tod auf dem Altar der Diana droht und er auch noch seinen Freund Pylades mit in den Strudel der Vernichtung reisst. Als dieser anscheinend zum Tode geführt wird, gerät Orest in wilde Raserei, die in einem Zustand der Schwäche endet, den er für Frieden hält. Gluck gestaltet diesen Moment als ein Arioso, dessen Text von der zurückkehrenden, kaum noch erhofften Ruhe spricht, während die Singstimme mit ihren kleinen Tonschritten und ihrem oft langen Verharren auf einem Ton unmissverständlich hörbar macht, dass es sich um einen Schwächeanfall handelt. Das Orchester umgibt den Gesang mit einem Gewebe, das aus einem Tremolo der Bratschen und einer metrisch unruhigen Begleitung der anderen Streicher geformt ist, wobei die Bratschen fast durchgehend den Ton a spielen, während das Umfeld harmonisch bewegt ist, wodurch sich immer wieder scharfe Dissonanzen ergeben.
Eine solche Separation der Ebenen, vor allem ein derartig widersprüchliches Verhältnis zwischen dem Text und seiner Vertonung war seinerzeit vollkommen neu. Gluck hat sich damit eine Möglichkeit geschaffen, tief in die Seele seines unglücklichen Protagonisten einzudringen: in die Seele des Mörders, der seiner Schuld nicht ausweicht, sondern sie auf sich nimmt, der den wohlfeilen Ausweg des «ich habe nur auf Befehl gehandelt» verschmäht, weil er die Welt und sich von der Befleckung wirklich befreien will. Die hochkomplexe psychische Situation, die Gluck zu schildern hatte, liess ihn das Tor für künftige Entwicklungen der Musikdramatik weit aufstossen und eine Technik entwickeln, die über Mozart, Wagner und die «Nervenkontrapunktik» des Richard Strauss bis in unsere Zeit verbindlich geblieben ist. Und gleichzeitig verweist er mit dieser auffälligen Neuerung darauf, dass an diesem Punkt der Handlung der fundamentale ethische Gedanke der Tragödie erkennbar wird: Glucks Taurische Iphigenie ist die Erzählung von drei Menschen, die in der schlimmsten Bedrohung verzweifelt um die Bewahrung ihrer moralischen Integrität und ihrer Humanität ringen und schliesslich, darin zeigt sich Gluck als aufklärerischer Optimist, eine Veränderung der Weltordnung bewirken, so dass sie den Konflikt siegreich bestehen können.
Text von Werner Hintze.
Dieser Artikel erschien im MAG 75, Januar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Fragebogen

Aus welcher Welt kommen Sie gerade?
Aus Montreal, Kanada. Dort ist es etwa 20 Grad kälter als in Zürich!
Auf was freuen Sie sich in der Neuproduktion Iphigénie en Tauride?
Ich bin sehr neugierig darauf zu sehen, wie das Bühnenbild in dieser Produktion zum Leben erwacht. Es ist fast wie eine eigenständige Figur in dieser Oper: Es bewegt sich, dadurch entstehen Risse im Raum und durch diese Risse fällt grelles Licht ein. Es wird sehr aufregend sein, im Bauch dieser Bestie zu singen!
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Meine Bühnenerfahrung und meine Gesangsstunden. Ich hatte grosses Glück, am Curtis Institute of Music in Philadelphia angenommen zu werden; daneben durfte ich während drei Jahren an vielen anderen Orten arbeiten. Ich war weniger als sechs Monate pro Jahr in Philadelphia, während ich meine ersten professionellen Rollen auswärts gesungen habe. Trotzdem haben sie mir grosszügigerweise Gesangsstunden und Coachings und zahlreiche andere praktische Erfahrungen ermöglicht, die für die Vorbereitung auf meine professionelle Karriere sehr wichtig waren. Es war ein Segen!
Welches Buch würden Sie niemals weggeben?
Shogun und Shantaram habe ich sehr gerne gelesen. Die einzigen Bücher, die ich zweimal gelesen habe, waren Der Graf von Monte Christo und Die drei Musketiere von Dumas. Meine Muttersprache ist ja Französisch, und Dumas ist mein Lieblingsschriftsteller, weil seine Texte unglaublich lyrisch sind. Ich kann mich als Opernsänger mit ihm identifizieren!
Welche CD hören Sie immer wieder?
Brad Mehldaus Live in Marciac und Canadiana Suite vom Oscar Peterson Trio. Auf der CD Live in Marciac spielt Brad Mehldau alleine für fast zwei Stunden Klavier und improvisiert neben virtuosen Jazz-Kontrapunkten auch lyrische, melancholische Melodien, die den Zuhörer direkt ins Herz treffen. Und Canadiana Suite ist einfach eines der besten Alben dieses grossartigen Montrealers.
Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?
Unseren Beamer. Er projiziert das Bild auf eine einfache weisse Wand, und das ist ebenso packend wie angenehm für das Auge. Ich empfehle jedem, statt eines Fernsehers einen Beamer zu kaufen!
Mit welchem Künstler würden Sie gerne essen gehen, und worüber würden Sie reden?
Sehr schwierige Entscheidung… Ludwig van Beethoven wahrscheinlich. Wir würden natürlich über den kreativen Prozess, die Inspiration und, wieso nicht, über die Bedeutung des Lebens reden.
Nennen Sie drei Gründe, warum das Leben schön ist!
1. Wir sind die Glücklichen auf diesem Planeten.
2. Es gibt immer etwas zu lernen, das deinen Geist und dein Herz öffnen wird.
3. Wenn du die Menschen respektierst, wird das sowohl dein als auch deren Leben besser machen. Harmonie!
Foto von Le Bureau Artists Management.
Dieser Artikel erschien im MAG 75, Januar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Iphigénie en Tauride
Synopsis
Iphigénie en Tauride
Vorgeschichte
Die griechischen Heere haben sich in Aulis versammelt, um in den Krieg gegen Troja zu ziehen. Doch der Wind bleibt aus, die Flotte sitzt im Hafen fest. Der Heerführer Agamemnon erfährt durch einen Seher, dass die Windstille durch den Zorn der Göttin Diana verursacht wurde, welche von ihm fordert, seine Tochter Iphigenie zu opfern. Tatsächlich lässt Agamemnon Iphigenie nach Aulis kommen und führt sie zur Schlachtbank. Doch im letzten Moment wird Iphigenie von der Göttin Diana gerettet; statt ihrer hat Agamemnon eine Hirschkuh getötet. Iphigenie bleibt verschwunden und wird für tot gehalten. Niemand weiss, dass sie seitdem als Priesterin der Diana auf Tauris lebt.
Erster Akt
Ein Unwetter tobt. Die Priesterinnen flehen die Götter an, sie von der blutigen Pflicht, Menschen zu opfern, zu entbinden. Auch als der Sturm sich legt, ist Iphigenie innerlich noch immer in Aufruhr. Sie hat in der Nacht von ihrer Familie geträumt: In diesem Traum wurde ihr Vater Agamemnon von seiner Frau Klytämnestra ermordet, die wiederum Iphigenie bedrängte, ihren Bruder Orest umzubringen.
Thoas, Herrscher auf Tauris und König der Skythen, fordert von Iphigenie neue Menschenopfer. Ein Orakel hat ihm verkündet, dass ihn eines Tages ein Fremder töten wird. Von Todesangst getrieben lässt er seither alle Fremden, die in Tauris stranden, umbringen. Auch zwei junge Griechen, die soeben an der Küste entdeckt wurden, will Thoas opfern lassen. Keiner ahnt, dass es sich bei ihnen um Iphigenies Bruder Orest und dessen Freund Pylades handelt.
Zweiter Akt
Orest wird von furchtbaren Schuldgefühlen gequält. Er hat seine Mutter getötet und fühlt sich nun verantwortlich dafür, dass sein einziger Freund mit ihm in den Tod gehen wird. Pylades hingegen findet Trost in der Vorstellung, gemeinsam mit Orest begraben zu werden.
Die Gefangenen werden getrennt. Alleingelassen, wird Orest im Schlaf von Rachegöttinnen, den Eumeniden, gepeinigt.
Er erschrickt vor einer Erscheinung seiner toten Mutter – diese stellt sich jedoch beim Erwachen als Iphigenie heraus, die gekommen ist, ihren Gefangenen nach seiner Herkunft zu befragen. Sie erfährt, dass dieser wie sie selbst aus Mykene stammt. Als sie ihn nach der Familie des Königs fragt, erfährt sie, dass Agamemnon von Klytämnestra erschlagen wurde und ihr Bruder diesen Gattenmord an seiner Mutter gerächt hat. Orest selbst sei tot; allein seine Schwester Elektra lebe noch in Mykene.
Verzweifelt sieht Iphigenie ihre Vorahnungen bestätigt: Ihre Familie ist ausgelöscht, und auch auf Orest kann sie nicht mehr hoffen.
Dritter Akt
Iphigenie beschliesst, gegen Thoas’ Willen zu verstossen und nur einen der beiden Gefangenen zu opfern; der andere soll nach Mykene eilen und ihrer Schwester Elektra einen Brief überbringen.
Iphigenie zögert lange und entscheidet sich schliesslich für Pylades als Opfer. Doch Orest sieht sich um die Erfüllung seines Todeswunsches und die Erlösung von seinen inneren Qualen betrogen. Er zwingt Iphigenie dazu, ihre Entscheidung zu revidieren. Sie übergibt Pylades den Brief an Elektra.
Allein geblieben schwört Pylades, seinen Freund zu retten.
Vierter Akt
Iphigenie graut vor der Ausführung des Opfers. Orest hingegen sieht in seinem Tod eine Befreiung. Iphigenies Mitleid rührt ihn.
In dem Moment, als sie im Begriff ist, Orest zu töten, beklagt dieser, den gleichen Opfertod erleiden zu müssen wie einst seine Schwester Iphigenie.
Die Geschwister erkennen sich. Thoas hat unterdessen von Iphigenies Verrat erfahren und fordert die sofortige Tötung des Opfers. Dass Orest Iphigenies Bruder ist, berührt ihn nicht. Als Thoas zum Messer greift und beide selbst töten will, erscheint der zurückgekehrte Pylades und ersticht ihn.
Aufruhr droht.
Da erscheint die Göttin Diana und verkündet den Willen der Götter: Orest sei von seinen Schuldgefühlen befreit und kehre gemeinsam mit Iphigenie nach Mykene zurück.
Biografien

Gianluca Capuano, Musikalische Leitung
Gianluca Capuano
Gianluca Capuano studierte Orgel, Komposition und Orchesterleitung am Konservatorium seiner Heimatstadt Mailand sowie historische Aufführungspraxis an der Civica Scuola di Musica ebenfalls in Mailand. 2015 debütierte er an der Semperoper Dresden mit Händels Orlando, 2016 am Opernhaus Zürich mit Haydns Orlando paladino. Ebenfalls 2016 dirigierte er Norma mit Cecilia Bartoli in der Titelrolle zur Eröffnung des Edinburgh Festival, gefolgt von Aufführungen in Paris und Baden-Baden. 2017 erfolgte eine Europatournee von La Cenerentola mit Cecilia Bartoli. In jüngerer Zeit dirigierte er u.a. Ariodante, La donna del lago, Il barbiere di Siviglia und Alcina bei den Salzburger Festspielen, Händels Il trionfo del tempo e del disinganno an der Oper Köln, das Weihnachtsoratorium an der Staatsoper Hamburg, Orfeo ed Euridice am Teatro dell’Opera in Rom, Il matrimonio segreto in Amsterdam, Mozarts Requiem in Bari, L’elisir d’amore am Teatro Real in Madrid sowie La finta giardiniera, La Cenerentola und Iphigénie en Tauride in Zürich. In der Spielzeit 2021/22 dirigierte er Le nozze di Figaro am Bolschoi-Theater in Moskau, Il turco in Italia an der Bayerischen Staatsoper, L’italiana in Algeri in Zürich und L’elisir d’amore in Hamburg, 2022/23 u.a. Alceste in Rom und Florenz sowie L’elisir d’amore an der Wiener Staatsoper. Seit 2019 ist er Chefdirigent von Les Musiciens du Prince – Monaco, mit denen er ein Manuel García gewidmetes Album mit Javier Camarena aufnahm sowie eine CD mit Varduhi Abrahamyan. Als Forscher widmet sich Gianluca Capuano, der auch ein Studium der Theoretischen Philosophie absolviert hat, hauptsächlich der Musikästhetik.

Carrie-Ann Matheson, Musikalische Leitung
Carrie-Ann Matheson
Carrie-Ann Matheson stammt aus Kanada. 2014 wurde sie von Fabio Luisi als Dirigentin und Korrepetitorin ans Opernhaus Zürich engagiert. Davor arbeitete sie als Assistenz-Dirigentin an der New Yorker Met und war als Pianistin, Souffleuse und Korrepetitorin festes Mitglied des künstlerischen Personals der Met. Sie hat Dirigenten wie Fabio Luisi, James Levine, Daniel Barenboim, Daniele Gatti, Yannick Nézet-Séguin, Gianandrea Noseda u. a. assistiert. Ihr Debüt als Dirigentin gab sie am Opernhaus Zürich 2015 und hat hier u.a. Mozarts La finta giardiniera, Oscar Strasnoys Fälle, Jonathan Doves Das verzauberte Schwein, Jörn Arneckes Ronja Räubertochter und Glucks Iphigénie en Tauride dirigiert. Besonderes Anliegen ist ihr die Förderung der jungen Sängergeneration. An der Met war sie viele Jahre feste Korrepetitorin des Lindemann Young Artist Development Program. Ab 2017 leitete sie als Dirigentin regelmässig die Gala-Konzerte des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich. Als Liedpianistin ist sie mit berühmten Sängerinnen und Sängern aufgetreten, u. a. mit Rolando Villazón, Benjamin Bernheim, Jonas Kaufmann, Piotr Beczala, Joyce DiDonato, Diana Damrau, Thomas Hampson, Barbara Bonney und Marilyn Horne. Kammermusik-Auftritte absolvierte sie mit Mitgliedern des New York Philharmonic, Metropolitan Opera Orchestra, Cleveland Orchestra, Montreal Symphony Orchestra und der Philharmonia Zürich. Als Korrepetitorin/Dirigentin arbeitete sie für die Salzburger Festspiele, das Seiji Ozawa Matsumoto Festival, das Lyric Opera of Chicago Ryan Opera Center, die Los Angeles Opera und das Mariinsky Atkins Young Artist Program. Seit 2021 ist sie künstlerische Leiterin des San Francisco Opera Center an der San Francisco Opera.

Andreas Homoki, Inszenierung
Andreas Homoki
Andreas Homoki wurde als Sohn einer ungarischen Musikerfamilie 1960 in Deutschland geboren und studierte Schulmusik und Germanistik in Berlin (West). 1987 ging Andreas Homoki als Regieassistent und Abendspielleiter an die Kölner Oper, wo er bis 1993 engagiert war. In den Jahren 1988 bis 1992 war er ausserdem Lehrbeauftragter für szenischen Unterricht an der Opernschule der Musikhochschule Köln. Hier entstanden erste eigene Inszenierungen. 1992 führte ihn seine erste Gastinszenierung nach Genf, wo seine Deutung der Frau ohne Schatten internationale Beachtung fand. Die Inszenierung, die später auch am Pariser Théâtre du Châtelet gezeigt wurde, erhielt den französischen Kritikerpreis des Jahres 1994. Von 1993 bis 2002 war Andreas Homoki als freier Opernregisseur tätig und inszenierte u. a. in Köln, Hamburg, Genf, Lyon, Leipzig, Basel, Berlin, Amsterdam und München. Bereits 1996 debütierte er an der Komischen Oper Berlin mit Falstaff, es folgten Die Liebe zu drei Orangen (1998) sowie im Jahre 2000 Die lustige Witwe. 2002 wurde Andreas Homoki als Nachfolger von Harry Kupfer zum Chefregisseur der Komischen Oper Berlin berufen, deren Intendant er 2004 wurde. Neben seinen Regiearbeiten an der Komischen Oper Berlin inszenierte er u. a. am Théâtre du Châtelet in Paris, an der Bayerischen Staatsoper München, am New National Theatre Tokyo, an der Sächsischen Staatsoper Dresden und der Hamburgischen Staatsoper. Im Juli 2012 inszenierte er unter der musikalischen Leitung von William Christie David et Jonathas von Marc-Antoine Charpentier für das Festival in Aix-en-Provence – eine Produktion, die später auch u. a. in Edinburgh, Paris und New York gezeigt wurde. Seit Beginn der Spielzeit 2012/13 ist Andreas Homoki Intendant des Opernhaus Zürich und inszenierte hier u. a. Der fliegende Holländer (Koproduktion mit der Mailänder Scala und der Norwegischen Staatsoper Oslo), Fidelio, Juliette, Lohengrin (Koproduktion mit der Wiener Staatsoper), Luisa Miller (Hamburgische Staatsoper), Wozzeck, My Fair Lady (Komische Oper Berlin), I puritani, Medée, Lunea (von der Zeitschrift Opernwelt zur «Uraufführung des Jahres 2017/18» gekürt), Iphigénie en Tauride, Nabucco, Simon Boccanegra, Les Contes d’Hoffmann, Salome, den Ring des Nibelungen und Carmen. Andreas Homoki ist seit 1999 Mitglied der Akademie der Künste Berlin.

Michael Levine, Ausstattung
Michael Levine
Michael Levine stammt aus Kanada. Er studierte an der Central School of Art and Design in London und ist seit 35 Jahren international als Bühnen- und Kostümbildner tätig. Zu den Regisseur:innen, mit denen er regelmässig zusammenarbeitet, gehören Andreas Homoki, Robert Carsen, Deborah Warner, Simon McBurney und Tim Albery. Zuletzt entwarf er Bühnenbilder u. a. für Iphigénie en Tauride, Wozzeck, Sweeney Todd, Madama Butterfly (Opernhaus Zürich), Die tote Stadt (Komische Oper Berlin), Hell’s Fury, The Hollywood Songbook (Luminato Festival Toronto), The Rake’s Progress (Festival d’Aix-en-Provence), Billy Budd (Teatro Real Madrid/Teatro dell’Opera di Roma), Hänsel und Gretel (De nationale Opera Amsterdam), Madama Butterfly (Bregenzer Festspiele) und Parsifal (Opéra National de Lyon/Metropolitan Opera New York). Seine Arbeiten wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 1981 wurde Michael Levine zum «Chevalier des Arts et des Lettres» ernannt. In der Saison 2021/22 debütierte er an der Bayerischen Staatsoper mit dem Bühnenbild zu Das schlaue Füchslein und schuf dort in der Spielzeit 2022/23 das Bühnenbild für Semele. Zuletzt entwarf er Bühnenbilder für Turandot an der Oper Amsterdam, für Doppelgänger an der Park Avenue Armory, Chicago an der Komischen Oper Berlin und Carmen an der Metropolitan Opera sowie für Adriadne auf Naxos und Cathy Marstons Ballet Atonement am Opernhaus Zürich.

Franck Evin, Lichtgestaltung
Franck Evin
Franck Evin, geboren in Nantes, ging mit 19 Jahren nach Paris, um Klavier zu studieren. Nachts begleitete er Sänger im Café Théâtre Le Connetable und begann sich auch für Beleuchtung zu interessieren. Schliesslich entschied er sich für die Kombination aus Musik und Technik. Dank eines Stipendiums des französischen Kulturministeriums wurde er 1983 Assistent des Beleuchtungschefs an der Opéra de Lyon. Hier arbeitete er u. a. mit Ken Russel und Robert Wilson zusammen. Am Düsseldorfer Schauspielhaus begann er 1986 als selbstständiger Lichtdesigner zu arbeiten und legte 1993 die Beleuchtungsmeisterprüfung ab. Besonders eng war in dieser Zeit die Zusammenarbeit mit Werner Schröter und mit dem Dirigenten Eberhard Kloke. Es folgten Produktionen u. a. in Nantes, Strassburg, Paris, Lyon, Wien, Bonn, Brüssel und Los Angeles. Von 1995 bis 2012 war er Künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung der Komischen Oper Berlin und dort verantwortlich für alle Neuproduktionen. Hier wurden besonders Andreas Homoki, Barrie Kosky, Calixto Bieito und Hans Neuenfels wichtige Partner für ihn. Im März 2006 wurde Franck Evin mit dem «OPUS» in der Kategorie Lichtdesign ausgezeichnet. Seit Sommer 2012 arbeitet er als künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung an der Oper Zürich. Franck Evin wirkt neben seiner Tätigkeit in Zürich weiterhin als Gast in internationalen Produktionen mit, etwa an den Opernhäusern von Oslo, Stockholm, Tokio, Amsterdam, München, Graz sowie der Opéra Bastille, der Mailänder Scala, dem Teatro La Fenice, der Vlaamse Opera und bei den Bayreuther Festspielen.

Janko Kastelic, Choreinstudierung
Janko Kastelic
Janko Kastelic ist ein kanadisch-slowenischer Dirigent, Chorleiter, Pianist und Organist. Er begann seine musikalische Ausbildung in Kanada am Royal/Western Conservatory of Music und der St. Michael’s Choir School. Er hat einen Abschluss in Dirigieren, Komposition und Musiktheorie von der Universität Toronto und setzte sein Studium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien fort. Seit 2017 ist er Chordirektor am Opernhaus Zürich. Er war einer der Kapellmeister der Wiener Hofmusikkapelle, Studienleiter des JET-Programms für junge Sänger am Theater an der Wien und Assistent bei den Bayreuther Festspielen sowie Gastchordirektor an der Hamburgischen Staatsoper. Zu den Positionen, die er im Lauf seiner Karriere bekleidet hat, gehört auch die Stelle des Generalmusikdirektors und Operndirektors am Slowenischen Nationaltheater Maribor, des Zweiten Chordirektors an der Wiener Staatsoper sowie des Korrepetitors an der Opéra National de Paris. Er war Assistenzprofessor an der Universität Ljubljana und Mentor an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Seine künstlerischen Leistungen sind dokumentiert auf mehreren Live-Aufnahmen, darunter Tschaikowskis Pique Dame und Schönbergs Moses und Aron. Er arrangierte und dirigierte auch Werke für die Feierlichkeiten zum Mozartjahr 2006. Zu seinen Arbeiten beim Klangbogen-Festival in Wien gehört die europäische Erstaufführung von Blochs Macbeth. Janko Kastelic ist auch ein engagierter Pädagoge, der sich der Förderung der nächsten Generation von Musikerinnen und Musikern verschrieben hat.

Beate Breidenbach, Dramaturgie
Beate Breidenbach
Beate Breidenbach studierte zuerst Violine, dann Musikwissenschaft und Slawistik in Nowosibirsk, Berlin und St. Petersburg. Nach Assistenzen an der Staatsoper Stuttgart und der Staatsoper Unter den Linden Berlin wurde sie als Musikdramaturgin ans Theater St. Gallen engagiert, drei Jahre später wechselte sie als Dramaturgin für Oper und Tanz ans Theater Basel. Anschliessend ging sie als Operndramaturgin ans Opernhaus Zürich, wo sie bisher mit Regisseurinnen und Regisseuren wie Calixto Bieito, Dmitri Tcherniakov, Andreas Homoki, Herbert Fritsch, Nadja Loschky, Kirill Serebrennikov und anderen arbeitete und die Entstehung neuer Opern von Pierangelo Valtinoni, Michael Pelzel, Samuel Penderbayne und Jonathan Dove betreute. Gastdramaturgien führten sie u.a. an die Potsdamer Winteroper (Le nozze di Figaro, Regie: Andreas Dresen), zum Schweizer Fernsehen (La bohème im Hochhaus) und 2021 an die Opéra de Génève (Krieg und Frieden, Regie: Calixto Bieito). Mit Beginn der Spielzeit 2026/27 wird sie als Chefdramaturgin an die Deutsche Oper Berlin wechseln.

Cecilia Bartoli, Iphigénie
Cecilia Bartoli
Cecilia Bartoli hat sich mit einer grandiosen, seit über 30 Jahren andauernden Bühnenkarriere als eine der weltweit führenden klassischen Musikerinnen etabliert. In Rom geboren und ausgebildet von ihrer Mutter, der Gesangslehrerin Silvana Bazzoni, wurde Cecilia Bartoli von Daniel Barenboim, Herbert von Karajan und Nikolaus Harnoncourt entdeckt. Bald trat sie mit weiteren führenden Dirigenten und bedeutenden Orchestern in allen grossen Opernhäusern und Konzertsälen Nordamerikas, Europas, des Fernen Ostens und Australiens sowie bei renommierten Festivals auf. Zum Markenzeichen ihrer Tätigkeit sind innovative Projekte geworden, die vernachlässigter Musik gewidmet sind und aus denen ausgedehnte Konzerttourneen, Bestseller-Aufnahmen, spektakuläre Bühnenproduktionen, innovative Filmformate und Multimedia-Events hervorgegangen sind. Seit 2012 ist Cecilia Bartoli Künstlerische Leiterin der Salzburger Festspiele Pfingsten; seit Beginn des Jahres 2023 zudem Direktorin der Opéra de Monte-Carlo – als erste Frau in der Geschichte dieses Hauses. Ebenfalls in Monte-Carlo wurden 2016 unter dem Patronat von SD Prinz Albert II. und IKH Prinzessin Caroline von Hannover Les Musiciens du Prince – Monaco gegründet: Mit ihrem auf historischen Instrumenten spielenden Orchester tritt Cecilia Bartoli sowohl am Heimatsitz Monte-Carlo als auch auf grossen Tourneen in ganz Europa auf. Meilensteine ihrer Karriere bildeten u. a. 1997 die allererste Inszenierung von Rossinis Cenerentola an der New Yorker Met, das legendäre, seit 1999 millionenfach verkaufte Vivaldi Album, 2008 der Pariser Konzertmarathon zu Maria Malibrans 200. Geburtstag, 2013 ihr radikal neuer Zugang zu Bellinis Norma, dessen Ergebnis auch eine wissenschaftliche Edition der rekonstruierten Originalpartitur war, sowie 2022 eine umjubelte Rossini-Woche an der Wiener Staatsoper. Die Cecilia Bartoli – Musikstiftung wurde im Rahmen von Cecilia Bartolis philanthropischer Arbeit gegründet. Unter anderem schuf die Stiftung gemeinsam mit Decca ein neues Label, mentored by Bartoli. Dank dieser Initiative wurde es Künstlerinnen und Künstlern wie Javier Camarena oder Varduhi Abrahamyan erstmals möglich, ein Studioalbum aufzunehmen. Zahlreiche Orden und Ehrendoktorate, fünf Grammys, mehr als ein Dutzend ECHO-Klassik und BRIT Awards, der Polar Music Prize, der Léonie-Sonning-Musikpreis, der Herbert-von Karajan-Musikpreis und viele andere Ehrungen unterstreichen ihrerseits Cecilia Bartolis Bedeutung für die Welt von Kultur und Musik. In diesem Zusammenhang wählte Europa Nostra Cecilia Bartoli zur Präsidentin, eine Position, welche sie 2022 für ein erstes Mandat von fünf Jahren antrat.

Birgitte Christensen, Iphigénie / Diane
Birgitte Christensen
Brigitte Christensen stammt aus Norwegen, wo sie an der Academy of Music in Oslo Gesang studierte. Ihre Karriere begann sie als Ensemblemitglied an der Oper in Innsbruck. Engagements führten sie seither u.a. an die Staatsoper Unter den Linden, die Komische Oper Berlin, die Semperoper Dresden, die Staatsoper Stuttgart, das Badische Staatstheater Karlsruhe, das Nationaltheater Mannheim, das Theater an der Wien, das Teatro Municipal de Chile, das Bolschoi Theater Moskau sowie die Norwegian National Opera. Zu ihren wichtigsten Rollen zählen Donna Anna (Don Giovanni), Vitellia (La clemenza di Tito), Violetta (La traviata), Liù (Turandot), Nedda (I Pagliacci), Micaëla (Carmen), Elisabetta (Don Carlo), Amelia (Un ballo in maschera) sowie die Titelrollen in Alcina, Alceste, Armina sowie Aida. Als Konzertsängerin ist sie an den grossen europäischen Häusern und Festivals aktiv. Birgitte Christensen singt ein breites Repertoire, welches vom frühen 17. Jahrhundert bis in die Moderne reicht. Höhepunkte der jüngeren Vergangenheit waren u.a. Glucks Alceste unter René Jacobs bei der Ruhrtriennale und Donna Anna an der Komischen Oper, Eva in Scarlattis Il primo omicidio an der Opéra National in Paris und im Concertgebouw Amsterdam sowie Aida an der Oscarsborg Opera. Eine regelmässige Zusammenarbeit verbindet sie mit Teodor Curretzis, unter welchem sie 2022 bei den Osterfestspielen Baden-Baden als Isolde in einer konzertanten Vorstellung von Tristan und Isolde und als Solistin in Beethovens 9. Sinfonie in Athen, Moskau und St. Petersburg auftrat sowie mit René Jacobs, unter dem sie 2022/23 in Beethovens Missa Solemnis bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen und beim Gstaad Menuhin Festival sang sowie in Bachs Johannespassion im Concertgebouw Amsterdam. In Zürich war sie zuletzt 2020 als Iphigénie zu erleben.

Stéphane Degout, Oreste, Iphigénies Bruder
Stéphane Degout
Stéphane Degout wurde nach seinem Studium am Konservatorium von Lyon Mitglied des Atelier Lyrique de l’Opéra de Lyon. 1999 debütierte er als Papageno beim Festival d’Aix-en-Provence. Seitdem gastiert er an Opernhäusern wie der Opéra National de Paris, der Scala in Mailand, der Berliner und der Bayerischen Staatsoper, dem Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel, dem Theater an der Wien, dem Royal Opera House Covent Garden, der Metropolitan Opera in New York sowie bei den Festivals von Glyndebourne, Salzburg und Edinburgh. Zu seinem Repertoire zählen Partien wie Marcello (La bohème), Guglielmo (Così fan tutte), Wolfram (Tannhäuser), Harlekin (Ariadne auf Naxos), Oreste (Iphigénie en Tauride), Dandini (La Cenerentola), Almaviva (Le nozze di Figaro) sowie die Titelpartien in Debussys Pelléas et Mélisande, in Monteverdis Orfeo und Il ritorno d’Ulisse in patria sowie in Thomas’ Hamlet. Degout gibt weltweit Liederabende und arbeitet dabei eng mit Ruben Lifschitz zusammen. In Orchesterwerken singt er regelmässig mit dem Chicago Symphony Orchestera unter Riccardo Muti sowie mit dem Los Angeles Philharmonic unter Esa-Pekka Salonen. Zudem arbeitet er mit Dirigenten wie Alain Altinoglu, René Jacobs, Marc Minkowski und Charles Dutoit. Auf der Opernbühne war er in jüngerer Zeit als King in der Uraufführung von Lessons in Love and Violence von George Benjamin in Amsterdam, Lyon und London zu erleben, als Valentin (Faust) in London und in Madrid und als Oreste und Almaviva am Théâtre des Champs-Elysées Paris. 2012 wurde er zum «Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres» ernannt.

Frédéric Antoun, Pylade, Orestes Freund
Frédéric Antoun
Frédéric Antoun stammt aus Québec und studierte Gesang am Curtis Institute of Music in Philadelphia. 2008 erregte er Aufsehen als Belmonte (Die Entführung aus dem Serail) in einer Produktion des Opera Atelier Toronto; seither ist er regelmässig Gast auf den grossen Opernbühnen in Amerika und Europa. So sang er an der Bayerischen Staatsoper München, an der Opéra National de Paris, am Théâtre de la Monnaie in Brüssel und am Théâtre du Capitole in Toulouse. Er gastiert regelmässig am Royal Opera House in London, wo er bisher als Cassio (Otello), Tonio (La Fille du régiment), Fenton (Falstaff) und Alfredo Germont (La traviata) zu erleben war. 2016 sang er in der Uraufführung von Adès’ The Exterminating Angel (Raúl) bei den Salzburger Festspielen, eine Rolle, welche er später in London sowie an der Met in New York verkörperte. Sein Konzertrepertoire umfasst Werke wie Mozarts Requiem, Händels Messiah, Schumanns Das Paradies und die Peri, Berlioz’ L’Enfance du Christ, Beethovens Neunte Sinfonie, Orffs Carmina burana sowie Bachs Magnificat, die Johannes- und die Matthäuspassion. Zu den Dirigent:innen, mit denen er zusammengearbeitet hat, zählen u.a. Marc Minkowski, Emmanuelle Haïm, Michel Plasson, Alain Altinoglu und Ivor Bolton. 2021/22 sang er u.a. Fenton an der Wiener Staatsoper, Alfredo Germont am ROH London und in Wien, Nadir (Les Pêcheurs de perles) in Graz und am Grand-Théâtre de Genève, François (A Quiet Place) an der Opéra National de Paris sowie Gérald (Lakmé) in Washington und an der Opéra-Comique Paris. In Zürich war er bisher als Nadir, Gonzalve (L’Heure espagnole), Ferrando (Così fan tutte) und Jupiter / Apollo (Semele) zu erleben.

Jean-François Lapointe, Thoas, König von Tauris
Jean-François Lapointe
Der kanadische Bariton Jean-François Lapointe hat seit seinem Debüt im Jahr 1983 auf zahlreichen grossen Bühnen Europas gesungen, darunter die Opernhäuser von Paris, Strassburg, Bordeaux, Wien, Barcelona, Madrid, Lissabon, Hamburg, Frankfurt, Berlin, Amsterdam, Genf und Toulouse. Ausserdem gastierte er in den USA und Japan. Eine seiner wichtigsten Rollen ist die Titelpartie in Debussys Pelléas et Mélisande, die er in Peter Brooks berühmter Inszenierung interpretierte sowie in Toronto, Bonn, Cincinnati, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Toulon, an der Mailänder Scala, im Théâtre des Champs-Elysées und im Concertgebouw Amsterdam unter Bernhard Haitink. Die Entwicklung seiner Stimme führte zu seinem gefeierten Debüt als Golaud in demselben Werk in Nantes und Helsinki im Jahr 2014. In jüngerer Zeit sang Jean-François Lapointe die Titelrolle in Ambroise Thomas’ Hamlet, Rodrigo (Don Carlo), Albert (Werther) in Bologna und Monaco, Wolfram von Eschenbach (Tannhäuser) und Ford (Falstaff) an der Opéra de Monte-Carlo, die Titelrolle in Guillaume Tell sowie Valentin (Faust) am Grand Théâtre de Genève, Marquis de la Force (Dialogues des Carmélites) an der Opera in Amsterdam, der Opera in Rom, an der Met in New York und im Théâtre du Capitole in Toulouse sowie Giorgio Germont an der Opéra Nationale de Paris. In der Spielzeit 2022/23 war er als Escamillo an der Opéra in Marseille und als Giorgio Germont am Théâtre du Capitole in Toulouse zu erleben.

Justyna Bluj, Diane
Justyna Bluj
Justyna Bluj wurde in Polen geboren und studierte an der Academy of Music in Krakau bei Olga Popwicz Gesang. Sie besuchte zudem Meisterklassen bei Neil Shicoff, Piotr Beczala, Helmut Deutsch, Marek Rzepka, Paola Larini u.a. Ab der Spielzeit 2016/17 war sie Mitglied der Opera Academy an der Polish National Opera in Warschau und 2017 zudem Stipendiatin der Eugenia Jütting Stiftung. Sie war in verschiedenen Produktionen der Polish National Opera zu erleben, u.a. in About the Kingdom of Day and Night and Magic Instruments, als Nonne in Der feurige Engel, eine Produktion, mit der sie auch am Festival d’Aix-en-Provence gastierte sowie in einem Liederabend mit Helmut Deutsch. Zu ihrem Repertoire gehören ausserdem Erste Dame (Die Zauberflöte) und die zweite Frau in Dido und Aeneas. Von 2018-2020 war sie Mitglied des Internationalen Opernstudios und war hier in Macbeth, Rigoletto und Sweeney Todd zu erleben sowie als Berta in der IOS-Produktion von Il barbiere di Siviglia am Theater Winterthur. In der Spielzeit 2019/20 sang sie u.a. in La traviata, Belshazzar, Iphigénie en Tauride und Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse.

Katia Ledoux, Femme Grecque
Katia Ledoux
Katia Ledoux wurde in Paris geboren und wuchs in Österreich auf. Sie studierte Gesang in Wien und Graz. 2018 gewann sie den Pressepreis bei der «International Vocal Competition» in ’s-Hertogenbosch. 2019 war sie Preisträgerin der «Belvedere Competition» und gewann den ersten Preis beim «Nordfriesischen Liedpreis». 2022 war sie Preisträgerin beim Viñas-Wettbewerb. 2017 debütierte sie an der Oper Graz als Mutter in Amahl and the Night Visitors von Gian Carlo Menotti. 2019 gab sie ihr Debüt als Geneviève in Pelléas et Mélisande an der Oper Amsterdam mit dem Concertgebouw- Orchester. Von 2019 bis 2021 gehörte sie zum Internationalen Opernstudio des Opernhauses Zürich. Seither sang sie u. a. Junon (Platée) und Gertrude (Roméo et Juliette) am Opernhaus Zürich, Bersi (Andrea Chénier) am Royal Opera House London, Ježibaba (Rusalka) an der Staatsoper Stuttgart, Proserpina in Trojahns Eurydice – Die Liebenden, blind und Makuba in der Uraufführung von Muyangas How anansi Freed the Stories of the World an der Oper Amsterdam sowie Carmen, L’opinion publique (Orphée aus enfers), Tisbe (Cenerentola), Marta (Iolanta), Dritte Dame (Die Zauberflöte) und Orlofsky (Die Fledermaus) an der Volksoper Wien. Zuletzt war sie als Messagiera in Romeo Castelluccis Inszenierung von Le lacrime di Eros mit Raphaël Pichon an der Oper Amsterdam zu erleben.















