Das Rheingold
Richard Wagner (1813-1883)
Vorabend zum Bühnenfestspiel «Der Ring des Nibelungen»
Libretto von Richard Wagner
In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 2 Std. 30 Min. Keine Pause. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Gut zu wissen
Erleben Sie den «Ring» als kostenloses (Live-)Streaming! Weitere Informationen
Alle Informationen zu den Ring-Zyklen, dem Vorverkauf und dem dazugehörigen Rahmenprogramm gibt es hier.
Interview

Richard Wagner hat den Ring des Nibelungen zum grössten Teil in Zürich geschrieben. Hat dieser Fakt für dich eine Bedeutung, wenn du die Tetralogie nun in Zürich inszenierst?
Es ist schon ein besonderes Gefühl, an dem Ort zu sein und jeden Tag am Haus Zeltweg 11 vorbeizufahren, wo dieses gewaltige Werk entstand. In unserer Arbeit kehrt der Ring sozusagen an seinen Ursprung zurück. Und dieser Vorgang passt perfekt zum Ansatz der Inszenierung.
Wie ist das zu verstehen?
Wir wollen in der Inszenierung auf andere Weise zum Ursprung zurückkehren, also ausgehend von Text und Musik, wie sie Wagner geschrieben hat, die Geschichte so buntscheckig und phantastisch erzählen, wie sie ist. Damit meine ich selbstverständlich nicht, was oft als «werktreue» Inszenierung bezeichnet wird, also eine, die jede Einzelheit so bringt, wie sie der Meister angeblich gemeint hat. Wir leben heute und machen heutiges Theater, anders geht es ja gar nicht. Der entscheidende Punkt ist, dass unsere Arbeit nicht die Deutung der Vorgänge bringen will, sondern die Vorgänge selbst, so spielerisch, sinnlich, emotional, traurig, lustig, überraschend und unterhaltsam wie möglich. Um es an einem Beispiel zu erläutern: Wir zeigen nicht, was der Riesenwurm unserer Meinung nach bedeutet, sondern wir zeigen den Riesenwurm. Ich möchte dem Zuschauer keine fertige Deutung servieren, die er auf Treu und Glauben zu schlucken hat, sondern ihn einladen, seine eigene Deutung des Gesehenen zu finden.
Auch für dich persönlich ist diese Inszenierung in gewisser Weise eine Rückkehr zum Ursprung…
Ja, tatsächlich steht der Ring am Beginn meiner ernsthaften Beschäftigung mit der Gattung Oper und damit meiner Laufbahn als Regisseur. Als ich den Gedanken fasste, Opernregisseur zu werden, war ich kein grosser Kenner. Ich war hin und wieder in der Oper und eigentlich immer enttäuscht, was, wie ich bald herausfand, an den schlechten Inszenierungen lag, die das Potenzial der Gattung nicht ausschöpften. Mir wurde schnell klar, dass ich mir einen eigenen Zugang zur Oper erarbeiten musste, indem ich mir die Stücke selbst lesend und analysierend vornehme. Und angefangen habe ich mit dem grössten Brocken: dem Ring. Ich habe den Text gründlich studiert und die vier Stücke hörend, mit der Partitur in der Hand, durchgearbeitet. Das war ein faszinierendes Erlebnis.
Worin bestand diese Faszination?
Es war wie Kino. Kopfkino versteht sich. Aus den Dialogtexten, den detaillierten Regieanweisungen und der suggestiven Musik entstand in mir ein deutliches Bild der Wunderwelt, in die Wagner uns entführt, und der Dinge, die dort vorfallen. Dabei habe ich das Werk gar nicht in dem Sinne verstanden, dass ich seine politisch-philosophischen Konnotationen hätte benennen können. Ich kannte einige der klugen Texte, die diese Hintergründe erklären, aber sie interessierten mich nicht, weil sie genau das nicht berührten, was mich so begeisterte. Meine Annäherung an den Gegenstand war also eher naiv als intellektuell. Und das ist bis heute so geblieben.
Die überaus genauen Regieanweisungen, geprägt vom Theaterverständnis und -stil des späten neunzehnten Jahrhunderts, haben dich also nicht abgeschreckt?
Im Gegenteil. Gerade diese Präzision ermöglicht ja das wunderbare Kopfkino, das ich da erlebt habe. Aber natürlich muss für eine Inszenierung das, was sich bei der Lektüre im Kopf abspielt, transformiert werden. Zum Beispiel: Wie Wagner die erste Rheingold-Szene erfunden hat, dieses Geschehen unter Wasser, wo die Rheintöchter in ihrem Element sind, während Alberich ihnen hoffnungslos unterlegen ist – das ist beim Lesen ein wunderbares Bild und eine anmutig-komisch Szene. Aber dieses Bild lässt sich auf der Bühne nicht realisieren. Die Aufgabe ist also, für dieses Bild eine Übersetzung zu finden, die den Möglichkeiten der Bühne entspricht. Aber noch erheblich wichtiger ist es, die Beziehungen zwischen den Figuren so deutlich wie möglich zu zeigen. Denn diese sind der Kern der Sache, sie tragen das theatralische Geschehen und vermitteln seine Bedeutung.
George Bernard Shaw hat eine Analyse der Tetralogie verfasst, die das Werk als allegorische Darstellung der Herausbildung des Kapitalismus deutet. Joachim Herz und Patrice Chéreau haben diesen Ansatz ihren Inszenierungen zugrundegelegt, indem sie der Erzählung das allegorische Gewand sozusagen abstreiften. Du hast einen ganz anderen Weg gewählt…
Das waren mit Sicherheit zwei theatralisch sehr beeindruckende Arbeiten, die der Entwicklung unseres Wagner-Bildes wichtige Impulse gegeben haben. Ich glaube allerdings, dass es ein – sehr produktiver – Irrtum war, davon auszugehen, Wagner habe eine gewisse politische Idee vermitteln wollen, die er in ein mythisches Gewand gekleidet hat, das man einfach entfernen kann. Zwar lässt sich nicht bestreiten, dass Wagner im Ring eine kritische Bestandsaufnahme seiner Gesellschaft unternimmt, aber er greift nicht auf den Mythos zurück, weil er ihm eine attraktive Staffage bietet, sondern weil die mythische Perspektive den Horizont erheblich erweitert. So geht es nicht um die Geschichte einer bestimmten Gesellschaftsformation, sondern um die der Menschheit, ja des Universums insgesamt. Die Tetralogie führt vor, wie der Mensch sich zuerst seiner selbst bewusst wird, sich dadurch von der Natur distanziert und sie beschädigt, die menschliche Gesellschaft auf die Basis des Privateigentums stellt, was zu zerreissenden Spannungen führt, und schliesslich seine eigenen Lebensgrundlagen untergräbt, was in seinen Untergang mündet. Das ist ein ganz allgemein zivilisationskritischer Ansatz, bei dem der Kapitalismus nur die jüngste Phase der Entwicklung bildet. Aber das ist schon die Deutung der Geschichte. Worum es mir geht, ist immer die theatralisch wirkungsvolle Erzählung dessen, was zwischen den Figuren vorgeht. Und dafür ist das bunte Geschehen, das Wagner aufgeschrieben hat, unbedingt ergiebiger als die eher monochrome Deutung nach der Richtschnur einer materialistischen Gesellschaftsanalyse.
Zeigt der Vorabend der Tetralogie also den Anfang der Welt?
Ja und nein. Das Vorspiel deutet unüberhörbar auf die Entstehung der Welt und des Lebens hin. Wenn die Handlung beginnt, sind wir aber schon weiter und die Welt steht unmittelbar vor dem Sündenfall, dem Moment, wo sich die menschlichen Wesen von der Natur lossagen, und dem Moment der Entstehung des Privateigentums. Da ist dieser Goldklumpen, der keinem gehört. Er dient keinem Zweck, ist einfach nur schön und eine Freude für die Rheintöchter. Allerdings hat das Gold ein verhängnisvolles Potenzial: Wer es sich aneignet, kann daraus einen Ring formen, der ihm masslose Macht verleiht. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass er sich von der Liebe lossagt. Alberich nimmt das Gold in Besitz, verflucht die Liebe und versklavt mit der Macht des Rings die Nibelungen, die nun das Gold für ihn aus der Erde graben und so seinen Besitz mehren müssen. Von diesem Moment an breitet sich das Übel unaufhaltsam über die Welt aus: Die Gier nach Besitz und Macht zersetzt alle zwischenmenschlichen Beziehungen, bis das System zusammenbricht. Das ist die Geschichte, die uns die Tetralogie erzählt.
Warum tut Alberich das?
Weil ihm Liebe verweigert wird. Er macht den Rheintöchtern den Hof, aber diese stossen ihn so lange immer wieder vor den Kopf, bis er verzweifelt und bereit ist, die Liebe zu verfluchen, wenn er ja ohnehin keine Chance hat, seine Sehnsucht zu verwirklichen. Also tauscht er Liebe für Macht ein, um sich wenigstens Lust zu erzwingen. Und so unterjocht er die Nibelungen und bereitet sich darauf vor, die Weltherrschaft durch einen Krieg gegen die Götter zu erringen, wenn ihm seine Untertanen genug Gold angehäuft haben.
Sein Gegenspieler ist Wotan, der auf wolkigen Höhen wohnt. Was will der?
Wotan ist der oberste der Götter. Er hat schon erreicht, wovon Alberich träumt: Er hat sich die Welt untertan gemacht. Allerdings nicht mit nackter Gewalt, sondern indem er die rechtlichen Beziehungen durch Verträge geregelt hat. Aber auch er hat dafür mit einem Frevel an sich selbst und an der Natur zahlen müssen: Im Vorspiel der Götterdämmerung erfahren wir, dass er für sein Wissen und den Speer, in dessen Schaft die Verträge eingeschrieben sind, ein Auge geopfert hat. Und dann kam er auf die Idee, sich eine Burg bauen zu lassen, womit die Irrungen und Wirrungen beginnen, die das Stück in Gang halten.
Warum liess er sich diese Burg bauen?
Wotans Streben nach dieser festen Burg zeigt seinen Wunsch, die Herrschaft über die Welt zu verewigen. Dem ständigen Wechsel des Lebens setzt er ein steinernes Monument entgegen, das scheinbar nicht dem Verfall unterworfen ist. Aber noch bevor er einziehen kann, macht ihm die Erdgöttin, die für das steht, was vor allen anderen Dinge da war und das alles jetzige Leben überdauern wird, klar, dass seine Existenz nicht von Dauer ist. Und Wotan wird die Erfahrung machen, dass er sein System umso mehr unterminiert, wie er es zu befestigen bestrebt ist. Walhall ist ein Irrtum von Anfang an, eine Fehlinvestition.
Das Rheingold erzählt, wie es dazu gekommen ist. Und es erzählt vom Zerfall einer Familie. Ist es eine Tragödie oder eine Komödie?
Unzweifelhaft trägt das Stück komödienhafte Züge und entwickelt sich in der Form eines Konversationsstücks. Es dürfte wohl die erste Oper sein, auf die man diesen Begriff anwenden kann. Die Trennung von Rezitativen und Arien ist vollkommen aufgehoben, das ganze Stück entwickelt sich als eine Folge lebendiger und oft ausgesprochen witziger Dialoge – das war damals etwas vollkommen Neues. Und die Familiengeschichte, die da erzählt wird, passt perfekt zu dieser Form: Das Familienoberhaupt gibt eine Villa in Auftrag und verspricht dem Bauunternehmer seine Schwägerin als Bezahlung. Nun dreht sich alles darum, wie der Göttervater sich und seine Familie mit Tricks und Lügen aus dieser Zwickmühle zu befreien versucht, wobei ihm seine zänkische Frau und ihre nicht eben intelligenten Brüder das Leben zusätzlich schwermachen.
Ein Konversationsstück basiert vor allem auf schnellen, schlagfertigen Dialogen. Ist so etwas mit Wagners Musik denn möglich?
Es geht nicht um das messbare Tempo des Dialogs, sondern um den Rhythmus und das Timing. Und in diesen Punkten ist Wagner als mit allen Wassern gewaschener Theaterkenner einfach unschlagbar. Und die Sprache, die er für den Ring entwickelt hat, erweist sich im Zusammenwirken mit der Musik als erstaunlich flexibel. Allerdings müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein, damit diese besondere Qualität der Komposition zum Tragen kommt: Zum einen müssen die Vorgänge zwischen den Figuren sehr präzise inszeniert und gespielt werden, Rede und Gegenrede müssen genau aufeinander abgestimmt und ihre jeweilige Motivation und die Untertexte in jedem Moment klar verständlich sein. Zum anderen muss die musikalische Darstellung genau dieser präzisen Formung der Dialoge folgen, was eine grosse Biegsamkeit im Tempo und in der Dynamik voraussetzt, damit die Sängerinnen und Sänger in die Lage versetzt werden, ihre Partien gleichzeitig mit Freiheit und Präzision zu realisieren. Nur wenn beide Ebenen perfekt aufeinander abgestimmt sind, können sie sich gegenseitig ergänzen und stützen, und nur dann kann das Stück seine urkomische und tief berührende Kraft entfalten. Gianandrea Noseda ist dafür der ideale Partner, und ich bin sehr froh, ihn bei dieser anspruchsvollen Aufgabe an meiner Seite zu wissen.
Das Gespräch führte Werner Hintze
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 92, April 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Pressestimmen
«Dieser Ansatz macht schon jetzt Lust auf die Fortsetzung»
NZZ, 01.05.22«Er hält sich eng an die Vorlage und schafft damit viel Raum für Details und Humor.»
Tages-Anzeiger, 01.05.22«Das ist eine unbedingte Empfehlung.»
Deutschlandfunk, 01.05.22«Homokis kluge und raffinierte Inszenierung, in der sich auf der mobilen Drehbühne ständig ändernden Unendlichkeit der Räume, erzählt dabei die Gesellschaftskomödie des Rheingold mit einer lange so nicht mehr erlebten, verblüffenden Texttreue.»
SWR2, 02.05.22«A final word must go to Noseda who conducted the Philharmonia Zürich brilliantly from the tender pianissimo opening to the many evocative and passionate climaxes throughout. Dramatic music-making at its finest.»
bachtrack, 01.05.22

Richard Wagner in Zürich
Neun Jahre hat Richard Wagner in Zürich gelebt, grosse Teile seines Hauptwerks «Der Ring des Nibelungen» sind hier entstanden, und um ein Haar wäre Zürich Festspielstadt und Uraufführungsort des Rings geworden. In diesem Podcast folgen wir Wagners Spuren durch Zürich – vom Heimplatz in den Zeltweg, vom Aktientheater in die Villa Wesendonck und von der Kaltwasserkur in Albisbrunn ins Nobelhotel Baur au Lac. Zum Podcast
Zwischenspiel, 1. April 2022

Wotan waltet: Der polnische Bass-Bariton Tomasz Konieczny und die Rolle seines Lebens
Tomasz Konieczny ist ein gefragter Wotan auf den grossen Opernbühnen der Welt. Er singt ihn auch in der Zürcher Neuproduktion von Richard Wagners «Ring des Nibelungen». Im Podcast Zwischenspiel sprach er 2022 mit Claus Spahn über die Monster-Partie des scheiternden Göttervaters, auf die er schon von Beginn seiner Karriere an hingearbeitet hat. Zum Podcast
Interview
Herr Schrott, Richard Wagners Rheingold beginnt mit einem berühmten Vorspiel, das mit musikalischen Mitteln die Entstehung einer Welt beschreibt: Zunächst erklingt in den Kontrabässen – quasi aus dem Nichts, an der Grenze der Hörbarkeit – ein Kontra Es, nach vier Takten folgt die Oktave in den Fagotten, und ganz allmählich breitet sich der Klang von den tiefsten Tiefen in die Höhe aus – aus dem Dunkel wird Licht. In Ihrem Buch Erste Erde. Epos beschreiben Sie, dass die verschiedenen Phasen des sogenannten Urknalls unter anderem mit Klängen einhergingen, «etwa 50 Oktaven unter dem tiefsten Ton des Klaviers». Deckt sich also Wagners Fantasie vom Uranfang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen vom Beginn des Universums?
Dazu muss man zunächst wissen: Der Begriff «Urknall» war ursprünglich eine abschätzige Bemerkung eines Gegners dieses Erklärungsmodells. Es gab keinen Knall, es war nichts zu hören, weil es ja keine Luft gab, also kein Medium, in dem sich diese Wellen hätten fortsetzen können. Und Ohren gab es noch viel weniger. Aber es gab eine Schwingungsfrequenz, die, wenn man sie übertragen würde, diese Tiefe gehabt hätte. Die Wissenschaft kann alles zurückrechnen bis zur ersten Mikrosekunde – aber was in der ersten Mikrosekunde passiert ist, das weiss kein Mensch. Insofern ist diese Erklärung über den Ursprung des Universums auch eine Geschichte, ein Mythos. Wir lösen Dinge, um sie zu erklären, ja gern in Geschichten auf, die bekannte Gegensätze präsentieren. In praktisch allen Geschichten geht es darum, dass Gut und Böse miteinander streiten, oder eben hell und dunkel. Egal, womit wir uns beschäftigen, ob mit dem Krieg in der Ukraine oder mit dem Corona-Virus, ohne Narrative können wir die Dinge schlecht denken. Mathematiker sind da eine Ausnahme. Wie die Welt begonnen hat, ist nach wie vor eine Erzählung, die gewisse mythische, vielleicht sogar mystische Dimensionen hat. Aber das gilt nur für die erste Mikrosekunde.
Die Wissenschaft kann also bis heute den Ursprung der Welt nicht erklären?
Nach der ersten Mikrosekunde greifen die Naturgesetze. Mit diesen Gesetzen lässt sich berechnen, wie die Elementarteilchen, die Atome, die Schwerkraft und die Sterne entstehen. Aber wie die Naturgesetze entstanden, weiss niemand.
Dass die Welt tatsächlich aus dem Nichts entstanden ist, scheint kaum vorstellbar, weil wir uns das Nichts nicht vorstellen können…
Aus physikalischer Dimension ist das Nichts sehr lebendig – als ein Potential, das mit der Planckschen Konstante zu tun hat.
Bleibt die Frage: Was war vor dem Ursprung der Welt?
Die beste Antwort, die ich darauf je erhalten habe, war ein Bild, das mich seitdem zur Ruhe stellt: Die Frage danach, was vor dem Urknall war, ähnelt der Frage: Was ist südlicher als der Südpol? Wenn ich den Globus anschaue, den ich hier in meinem Arbeitszimmer neben mir stehen habe, und diese Kurve sehe – da zeigt sich: Da ist einfach nichts. Aber das sind Probleme, die damit zu tun haben, dass wir gewohnt sind, in Räumen, also in drei Dimensionen zu denken, und dass uns selbst das Denken in vier Dimensionen schwerfällt, obwohl uns das ja dauernd belastet, denn die Zeit ist ein ebenso unerbittlicher wie offensichtlicher Feind des Lebens. Wozu gibt’s sonst Feuchtigkeitscremes? Insofern sind wir nicht einmal in der Lage, das, was uns bestimmt, zu integrieren und in vier Dimensionen zu denken. Da gehen uns, wie ich sagen würde, einfach die Narrative aus. Das erzählbar zu machen, die richtigen Bilder dafür zu finden, ist eine poetische Arbeit, die weitgehend noch getan werden muss.
Richard Wagner leistet in seinem Ring des Nibelungen dazu einen Beitrag, etwa mit seinem Bild von der Weltesche, dem Ur-Baum, einer Metapher für die unberührte Natur. Von dieser Weltesche, so erfahren wir in der Götterdämmerung, hat sich Wotan einen Ast für seinen Speer abgeschnitten, in den er der «Verträge Runen», also die Gesetze der Zivilisation, geschnitzt hat.
Ja, aber auch andere alte Mythen sind da natürlich toll. Mythen, die von Göttern erzählen, die die Welt erschaffen, oder die Schöpfungsgeschichte bei Hesiod, die von einer Welt erzählt, die aus einem tiefen, dunklen, feuchten Abgrund kommt.
Schon wieder die Dunkelheit. In Ihrem Buch berichten Sie von einem Schöpfungsmythos der Maori, in dem zuerst das Dunkel ist und daraus das Licht entsteht, ganz ähnlich der biblischen Genesis. Gibt es also in den uns bekannten Schöpfungsmythen Vorstellungen, die sich ähneln oder verallgemeinern lassen?
Schöpfungsmythen gibt es wie Sand am Meer, weil sich diese Mythen immer von anderen Dingen ableiten. Meistens ist da eine Leitmetapher, die benutzt wird, um zu erklären, wie Erde und Himmel, Götter und Menschen entstanden sind. Das hängt immer vom jeweiligen Umfeld ab. Im Pazifik zum Beispiel stellen sich die Menschen vor, dass die Welt aus einem Vogelei entstand. Woher der Vogel kam, ist dabei unklar; das ist so ähnlich wie die Frage: Was war vor dem Urknall? Es wird beschrieben, dass es in dem Ei dunkel war, dass dort drin ein kleiner Fötus sitzt und so weiter. Das war den Menschen vertraut. Woanders erzählt der Schöpfungsmythos von einer Pflanze, bei der die Menschen durch einen Halm schlüpfen wie die Erbsen aus einer Schote. Es ist immer ein Extrapolieren der Umwelt, in der man aufwächst.
Welche Schöpfungsmythen kennen Sie noch?
Die Buschleute müssen in der Savanne überleben, ihr Umfeld sind Tiere, die sie jagen, Wurzeln, die sie ausgraben – viel mehr ist da nicht. Sich in dieser Umgebung zu überlegen: Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? bezieht sich auf die Umwelt. Entsprechend stellen sich die Menschen in der Savanne die Evolution so vor, dass sie einmal Tiere waren und diese Tiere irgendwann statt Hufen Hände bekamen und daraus der Mensch entstand. Für die Entstehung der Sonne gibt es eine besonders schöne Geschichte: Es gab einmal ein Wesen, das hatte Feuer unter den Achseln, und immer, wenn es die Arme hob, kam dieses Feuer heraus. Dieses Wesen hatte es gut, denn am Anfang der Welt war alles dunkel. Leider war das Wesen unfreundlich, misanthropisch, egoistisch und gab nichts von seinem Feuer und seiner Wärme ab. Ein paar Kinder haben gewartet, bis das Wesen geschlafen hat und es dann an den Händen und Füssen genommen und in den Himmel geworfen. Seitdem hatten es alle hell und warm. Die Vorstellung dahinter ist, dass Achselhaare aussehen wie Sonnenstrahlen. Solche Erklärungsversuche beweisen die gleiche kreative Intelligenz wie die heutige Wissenschaft. Je nachdem, welche Dinge für mich eine Bedeutung haben, erkläre ich mir die Welt so oder anders.
Also könnte man sagen, dass die verschiedenen Schöpfungsmythen über die Entstehung der Welt vor allem etwas aussagen über die Menschen und die Kultur, aus der sie kommen?
Man sollte jedenfalls nicht versucht sein zu glauben, dass ein Mythos irgendwas von der Wissenschaft vorwegnimmt. Wenn es Parallelen gibt zwischen dem Schöpfungsmythos der Maori, der auf dem Gegensatz von Hell und Dunkel gründet, und dem biblischen Schöpfungsmythos mit dem Satz «Es werde Licht», dann verrät das eher etwas darüber, dass es einen ähnlich sozialisierten Fundus von gedanklichen Mustern gibt. Der Schöpfungsmythos der Maori ist deshalb besonders interessant, weil es der letzte Mythos ist, der 1850 noch entstanden ist, und zwar als Gegenkonzeption zur Bibel, die die englischen Missionare mitbrachten und die ja mit der Genesis eine ganz gute Geschichte enthält. Das Gedankengut der Maori ist zudem beeinflusst aus dem indischen Raum, und die Entstehung der Götter aus dem Nichts findet man dort vorgebildet.
Götter aus dem Nichts? Sind diese dann ähnlich allwissende Weltschöpfer wie der christliche Gott?
In den frühen Schöpfungsmythen taucht nichts auf, was einem Gott entsprechen würde. Weder bei den Eskimos noch bei den Buschleuten, den Maya oder Inka gibt es einen allmächtigen Gott, der über allem steht. Man stellt sich eher Kulturheroen vor, die die Welt gestalten, Demiurgen also, Architekten der Welt. In den frühen Schöpfungsmythen sind es Superheroes mit übernatürlichen Kräften, die Himmel, Erde, Sonne und Mond bauen. Wie in amerikanischen Filmen streiten sie untereinander, sind hinterfotzig, abgedreht, problembelastet; das einzige, was sie vom Sterben abhält, ist, dass sie in den Himmel ziehen und seither von dort auf die Welt herabschauen. Die Religion, wie wir sie kennen, ist ja eine Entwicklung der Sesshaftigkeit und nicht älter als zehntausend Jahre. Nichts an alten Höhlenmalereien oder Mythen weist darauf hin, dass es vorher schon so etwas gegeben hätte wie eine Götterverehrung. Klar, man versuchte, sich gewisse Mächte mit Opfern günstig zu stimmen. Aber das, was wir heute unter Gott verstehen – also ein Allah oder ein Herrgott –, darüber hätte man damals gelacht.
Schöpfungsmythen sind also immer auch der Versuch, zu verstehen…
Solche Erklärungsmuster sind ganz wesentlich, weil sie Identität stiften. Eins der Erfolgsgeheimnisse des Homo Sapiens war, dass er Erklärungsmuster hatte dafür, was der Himmel ist, wie der Tod entstand, was nach dem Tod passiert, wo man herkommt, wie die Welt funktioniert. Das war bei der Entstehung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert nicht anders. Für das Nachdenken darüber, was – zum Beispiel – das Deutsche ausmacht und wie es zu einer grösseren Organisation kommen kann, ist das Mythische ähnlich wichtig wie die Sprache, die Schulbildung oder das Militär, damit man sagen kann: Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit.
Wenn man von Schöpfungsmythen als Erklärungsmustern spricht, dann fragt man sich ja vielleicht nicht nur, wie die Welt entstanden ist, sondern auch, wie sie möglicherweise einmal enden wird; auch Richard Wagners Welterfindung geht in der Götterdämmerung, dem letzten Teil seiner Ring-Tetralogie, unter. Inwiefern ist den Mythen vom Anfang auch ein Ende eingeschrieben?
Das ist eher die Ausnahme, und ich empfinde es auch fast als Perversion. Das Ende vorwegzunehmen, zeigt eine apokalyptische Geisteshaltung. Ein wichtiges Element in manchen Mythen, besonders bei den Griechen, ist allerdings die Vorstellung, dass am Anfang alles besser war. Am Anfang herrschten paradiesische Zustände, so ist es ja auch in der Bibel. Die griechische und die jüdischchristliche Kultur waren sehr eng miteinander verwandt. Eschatologie, also die Lehre von den Letzten Dingen, spielte darin eine wichtige Rolle. Man hat eigentlich immer auf den Weltuntergang gewartet. Auch die jüdischen Propheten haben immer wieder die Weltzerstörung in den Vordergrund gerückt. Und wenn man sich einmal darauf versteift, überall Weltuntergänge zu sehen, dann bleibt man darin gefangen. Aber das scheint mir, wie gesagt, eine semitischgriechische Spezialität zu sein. Mir ist jedenfalls kein anderes Beispiel dafür bekannt.
Auch im Rheingold war am Anfang alles besser: Wagners Musikdrama beginnt mit einem paradiesischen Zustand, der gleich zu Beginn zerstört wird. In der Tiefe des Rheins spielen drei Rheintöchter unschuldig mit einem Goldklumpen, und es könnte immer so weitergehen, wenn nicht Alberich das Gold stehlen und daraus den Ring schmieden würde. Auch Göttervater Wotan zerstört einen paradiesischen Zustand, indem er die Weltesche beschädigt. Beide Erzählungen nehmen im Grunde das Ende, den Weltuntergang, vorweg.
Das erinnert im Kontext der Zeit, in der Wagners Ring komponiert wurde, zunächst natürlich vor allem an Karl Marx – das Kapital und die Ausbeutung und der Wucher sind schuld am Unglück der Menschen. Interessant ist, dass man die Vorstellung einer Erbsünde nur in der christlichjüdischen Kultur findet. Die biblische Geschichte von der Sintflut ist eine Kopie der mesopotamischen Sintflut-Geschichte. Im Original schicken die Götter den Menschen die Sintflut, weil die Menschen in den Städten so laut miteinander kopulieren, dass die Götter sich gestört fühlen. Die Schreiber des Alten Testaments machen daraus eine Sünde, die im Original nirgends vorkommt. Woher dieses plötzliche Sündenbewusstsein kommt, würde mich selbst sehr interessieren; ich weiss darauf keine Antwort. Vermutlich ging es um die Frage nach der Kollektivschuld: Was haben wir als Volk verbrochen, dass die Babylonier uns verschleppen und gefangen nehmen? Im weltweiten kulturgeschichtlichen Vergleich sind diese Motive jedenfalls eigenartig. Dieses Opferbewusstsein, dieses Schuldbewusstsein, das mag uns normal erscheinen, ist es aber keineswegs.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 92, April 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
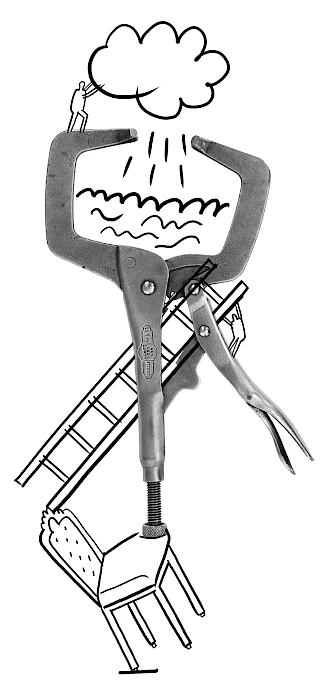
Die Nuggets entstehen in der Regel durch das Einschmelzen eines Goldschatzes durch Drachenfeuer. Doch auch wenn man keinen Drachen zur Verfügung hat, kann man Goldnuggets sehr gut selbst herstellen – denn das Rheingold macht auch auf der heimischen Fensterbank eine gute Figur. Sie brauchen lediglich einen Klumpen Ton, einen Eimer Gips und einen Eimer HATOvit. Dazu eine Dose Hartschaum, einen Flussstein, etwas Gewebefüller, Gummimilch, Folienkleber, Flammschutzmittel, Gold-Spray, Vergoldungsmilch, 10 Blatt Schlagmetall «Gold» und etwas Schelllack in Orange-Gold. Vielleicht haben Sie das eine oder andere Produkt gerade nicht da – aber nach einer kurzen Recherche im Internet sollte die Beschaffung kein Problem sein. Zunächst formen Sie aus dem Tonklumpen Ihren individuellen Nugget: Die Vorlage finden Sie nach einer Bildersuche «Goldnugget» im Internet. Den danach geformten Klumpen umhüllen Sie mit einer 12 cm dicken Gipsschicht, lassen aber an der Unterseite den Gips weg, damit Sie später den Ton aus der Form bekommen. Nun lassen Sie das Gebilde zwei Tage lang trocknen. Pulen Sie dann den Ton aus der Gipsform und füllen das HATOvit bis zum Rand hinein. Nach 15 Minuten schütten Sie die Form wieder aus und warten eine Stunde. In der Innenseite hat sich eine ca. 1mm starke HATOvit Haut gebildet, die von innen den Gips überzieht. Jetzt nehmen Sie den Schaumspray und sprühen den Hartschaum in die mit HATOvit überzogene Gipsform. Warten Sie maximal 30 Minuten. Nun ist der Hartschaum angetrocknet, aber noch flexibel. Vorsichtig lösen Sie die HATOvit-Haut mitsamt dem Hartschaum aus der Gipsform und drücken den Flussstein in den noch feuchten Hartschaum und lassen das Ganze durchtrocknen. Bestreichen Sie das Gebilde zunächst mit Gewebefüller und anschliessend mit in Gummimilch gemischtem Flammschutzmittel, damit das Gebilde bei Kontakt mit Feuer nicht sofort in Flammen aufgeht. Mit dem Farbspray sprayen Sie das Gebilde goldig an. Jetzt sieht es nach einem mattgoldigen Stein aus. Aber der Zauber kommt erst noch: Nach dem Trocknen des Goldsprays malen Sie das Nugget mit Vergoldungsmilch an. Das ist eine Flüssigkeit, die nach ca. 30 Minuten angetrocknet ist und dann eine klebrige Schicht bildet. Auf diese klebrige Schicht drücken Sie mit einem Pinsel die hauchdünnen Goldblätter aus Schlagmetall. Das Metall ist so dünn, dass es durch die weichen Borsten in jede Vertiefung gedrückt wird und alle Formen des Nuggets annimmt. Das Blattvergolden dauert ca. 30 Minuten, und dann haben Sie eine wirklich goldglänzend schöne Oberfläche. Aber wehe, wenn Sie nun abbrechen: Innert weniger Tage würde das Schlagmetall oxidieren und eine grünlichbläuliche Farbe annehmen. Dazu lassen Sie es nicht kommen, sondern überziehen mit einem Pinsel das ganze Nugget mit Schelllack im Farbton Orange-Gold. Durch diesen Lack bekommt das Nugget nochmals eine besondere Farbtiefe und ist von dem in Drachenfeuer geschmolzenen Nugget nicht mehr zu unterscheiden. Das Ganze 24 Stunden trocknen lassen und fertig ist ein Rheingoldnugget. Falls sich das nach viel Arbeit anhört: Für das Rheingold im Bühnenbild wurden mehr als 10’000 Blätter Schlagmetall verwendet. Es ist ein wahrer Schatz auf der Bühne.
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 92, April 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Die geniale Stelle
«Das Wort ‹Familienbande› hat einen Beigeschmack von Wahrheit.» Wohl jeder hat sich schon in Situationen befunden, in denen er zu diesem Aphorismus Karl Kraus’ finster genickt hätte. Aber was soll erst Freia sagen, die zarte Göttin der Liebe, die erleben muss, wie das Familienoberhaupt sie ohne viel Nachdenken an zwei Bauunternehmer verschachert? Das ist nämlich der Preis, den Wotan den beiden Riesen zu zahlen versprach, wenn sie ihm, der sich zum obersten Gott und Hüter ihrer moralischen Ordnung aufgeworfen hat, eine repräsentative Villa bauen. Da sie nun kommen, ihren Lohn zu verlangen, lassen alle Freia in ihrer Angst allein. (Vergessen wir nicht: Wotan wird erst dann aktiv, als er am eigenen Leibe erfährt, dass der Verlust der goldenen Äpfel, die sie in ihrem Garten hegt, unausweichlich zum Tod der Götter führt.) Echtes Mitgefühl erlebt sie aus einer ganz unerwarteten Richtung: Der Riese Fasolt ist es, der Wotan schwere und sehr grundsätzliche Vorwürfe macht, der deutlich ausspricht, wie falsch es ist, dass der Göttervater «Türme von Stein» höher schätzt als «Weibes Wonne und Wert». Fasolt, das schwerfällige und scheinbar so täppische Monstrum, ist der einzige in dieser ganzen Versammlung skurriler Gestalten, der echte Empfindungen hat, was unüberhörbar wird, wenn er von seiner Hoffnung auf das Liebesglück an der Seite einer Frau spricht. Und Wagners kommentierendes Orchester lässt uns wissen, dass von allen Anwesenden Freia allein versteht, was in diesem Mann vorgeht und wie sehr er Recht hat: Wenn Fasolt seine Anklage gegen Wotan beendet hat, spielen die Violinen ganz unerwartet das der Liebesgöttin zugeordnete Motiv, allerdings in einer nur einmal, nämlich an dieser Stelle erscheinenden Variante. In seiner Grundform besteht Freias Motiv aus einem viertönigen, chromatischen Anstieg, der gestisch ein zärtliches Streicheln evoziert, und einem unmittelbar folgenden jubelnden Aufschwung um eine Oktave. So klar und deutlich spricht dieses Motiv, dass jeder Hörer intuitiv weiss: Was hier musikalisch geschildert wird, ist Liebe, wirkliche, sinnliche Liebe, das überströmende Glück der physischen Nähe des geliebten Wesens. Freia versteht, dass dieser Riese sie und die Liebe, die ihr Leben ist, im tiefsten Inneren erfasst hat. Und ihre spontane emotionale Hinwendung zu ihm drückt sich darin aus, dass ihr Motiv nun (und nur dieses eine Mal) doppelt so weit, also um mehr als zwei Oktaven ausschwingt. Freilich folgt dem Aufschwung sofort der Absturz: So aufrichtig die Liebe des Riesen sein mag, so unmöglich ist sie. Das Bild des weinenden King Kong und der zärtlich geliebten Frau auf seiner riesigen Hand drängt sich geradezu auf. Wie soll diese Liebe je Erfüllung finden? Aber ehe die Frage noch gestellt ist, hat die Welt sie schon entschieden – das zärtliche Monster stirbt im Kugelhagel, wie Fasolt von seinem goldgierigen Bruder erschlagen wird: Wer liebt, ist schwach, und der Schwache fällt der Gewalt zum Opfer. Wagners ganze Sympathie aber gilt den wirklich Liebenden, die rückhaltlos lieben und alles für die Liebe hingeben, auch dann, wenn es nicht die kleinste Hoffnung auf Erfüllung gibt. Denn wenn sie auch scheitern – das ist der Kerngedanke der Tetralogie, den Wagner hier in drei Takte zusammendrängt –, tragen sie doch den Keim einer besseren Welt in sich, einer Welt, die sich vielleicht einmal verwirklichen wird. Im Universum des Wagnerschen Werkes erscheinen immer wieder diese liebenden, darum schwachen, betrogenen, unterworfenen Wesen, die in schrecklicher Einsamkeit zugrunde gehen. Sie alle hat er wohl mitgemeint, als er am letzten Abend seines Lebens über die Rheintöchter sagt: «Ich bin ihnen gut, diesen untergeordneten Wesen der Tiefe, diesen sehnsüchtigen.»
Text von Werner Hintze.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 92, April 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Das Rheingold
Synopsis
Das Rheingold
1. Szene: In der Tiefe des Rheins
Der Nibelung Alberich steigt aus Nibelheims unterirdischen Klüften herauf und trifft auf die schönen und verführerischen Rheintöchter. Sie weisen sein Liebeswerben zurück und verhöhnen ihn als hässlichen Zwerg.
Der Abgewiesene entdeckt das in der Morgensonne aufleuchtende Rheingold. Von den Rheintöchtern erfährt er, was es damit auf sich hat: Wer für immer der Liebe entsagt, kann den Zauberspruch finden, der das Metall zu einem Ring formt, der masslose Macht verleiht. Verbittert über seinen Misserfolg bei den Nixen verflucht er die Liebe und eignet sich das Gold an.
2. Szene: Auf wolkigen Höhen
Die Götter warten darauf, dass sie in die neue Burg einziehen können, mit deren Bau der Göttervater Wotan die Riesen Fasolt und Fafner beauftragt hat. Seine Gattin Fricka macht ihm schwere Vorwürfe, weil er den Riesen als Lohn ihre Schwester, die Liebesgöttin Freia, versprochen hat. Wotan hofft auf den Feuergott Loge, der einen für die Riesen akzeptablen Ersatz finden soll.
Doch auch der vermag keinen Ersatz für ein liebendes Weib aufzuzeigen. Überhaupt habe er die ganze Welt durchsucht und nur einen gefunden, der bereit war, auf die Liebe zu verzichten: Er berichtet von Alberich, dem Raub des Rheingolds und wie er nun der nun durch die Macht des neu geschmiedeten Ringes das gesamte Volk der Nibelungen zwingt, ihm einen gewaltigen Goldschatz aus der Erde zu fördern. Die Riesen erklären sich bereit, für Alberichs Gold auf Freia zu verzichten und nehmen sie bis zur Übergabe als Pfand mit auf ihre Burg. Kaum ist Freia fort, verfallen und altern die Götter. Loge kann das erklären: Die Götter haben heute nicht von den goldenen Äpfeln gegessen, die Freia in ihrem Garten hegt. Diese Früchte halten sie jung und kräftig. Da nun Freia verpfändet ist, müssen sie dem Tod ins Auge blicken. Das erst gibt den Ausschlag. Um dem abzuhelfen, beschliesst Wotan, gemeinsam mit Loge nach Nibelheim zu fahren und Alberichs Gold zu entwenden.
3. Szene: In Nibelheim
Alberich hat seinen Bruder Mime gezwungen, ihm einen Tarnhelm herzustellen, um so die Nibelungen noch besser knechten zu können. Voller Stolz präsentiert er Wotan und Loge seinen Goldschatz und erzählt ihnen, was er damit zu tun gedenkt: Er wird ihn dereinst verwenden, um ein Heer auszurüsten, mit dem er die Götter stürzen und die Herrschaft über die Welt erringen will. Mit prahlerischer Geste zeigt er auch den Tarnhelm vor, der ihn, wie er glaubt, gegen alle feindlichen Angriffe sichert. Da Loge sich ungläubig stellt, verwandelt sich der Nibelung erst in einen riesigen Drachen und dann in eine winzige Kröte. Zu spät entdeckt er die Falle: Die beiden Götter greifen die Kröte und entführen Alberich in die Oberwelt.
4. Szene: Auf wolkigen Höhen
Wotan zwingt Alberich, seinen Schatz herbeibringen zu lassen, und entreisst ihm Tarnhelm und Ring. Der freigelassene Alberich belegt seinen Ring mit einem Fluch: Wer immer ihn besitzt, dem soll er den Tod bringen. Die Riesen kommen zurück, um Freia gegen das Gold einzulösen oder sie für immer mitzunehmen. Sie verlangen, dass das Gold so aufgehäuft wird, dass es Freia ganz verdeckt. Um eine Ritze zu verstopfen, durch die Fafner Freias Haar gesehen hat, muss Wotan auch den Tarnhelm hergeben. An einer anderen Stelle erspäht Fasolt Freias Auge, und Fafner verlangt den Ring, um auch diesen Spalt zu verschliessen. Wotan weigert sich entschieden. Erst als die geheimnisvolle Urmutter der Welt, Erda, erscheint und ihn eindringlich vor dem Unheil warnt, das mit dem Ring verbunden ist, gibt er nach. Im Streit um die Beute erschlägt Fafner seinen Bruder. Die Götter können nun endlich die Burg in Besitz nehmen, der Wotan den Namen »Walhall« gibt. Die Klage der Rheintöchter um das verlorene Gold überhören sie geflissentlich. Mit einem sarkastischen Kommentar zieht sich Loge zurück.



























