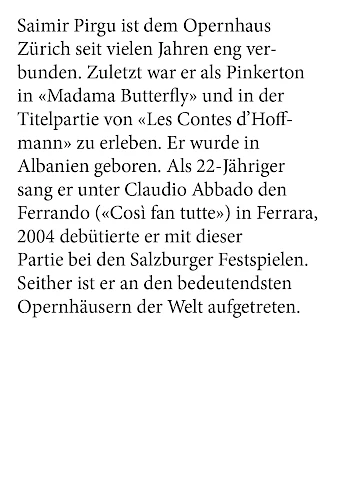Carmen
Georges Bizet (1838-1875)
Opéra-Comique in vier Akten
Libretto von Henri Meilhac und Ludovic Halévy
nach der Novelle «Carmen» von Prosper Mérimée
In französischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer ca. 3 Std. inkl. Pause nach ca. 1 Std. 35 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Die Einführungsmatinee findet am 24 Mär 2024 statt. Eine Koproduktion mit der Opéra Comique, Paris.
Partnerin Opernhaus Zürich 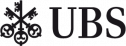
Gut zu wissen
Opera Vision streamt die Dernière von Carmen am Samstag, 15. Juni 2024 live aus dem Opernhaus und stellt sie im Anschluss daran als Video-on-Demand zur Verfügung.
Interview

Eine Frau liebt die Freiheit über alles
Andreas Homoki inszeniert eine neue «Carmen». Seine Regiearbeit nimmt Bezug auf den Uraufführungsort von Bizets berühmter Oper, die Opéra Comique in Paris. Genau dort hatte Homokis Inszenierung vor einem Jahr Premiere. Jetzt kommt sie nach Zürich. Ein Gespräch über den faszinierenden Mythos der starken, selbstbestimmten Frau.
Andreas, du inszenierst mit Carmen die populärste, weltweit am meisten aufgeführte Oper. Warum?
Ganz einfach: Ich liebe dieses Stück. Es ist zurecht die bis heute erfolgreichste Oper der Geschichte. Die Musik ist fantastisch, und dazu kommt diese faszinierende Frauenfigur Carmen – eine starke und ungebundene Frau, die sich vom gängigen bürgerlichen Frauenbild des 19. Jahrhunderts so sehr abhebt. Carmen bringt den braven Soldaten José dazu, Schmuggler zu werden und als Mörder zu enden. Mich persönlich begeistert zudem die riesige Bandbreite an musikalischen Genres in dieser Oper. Carmen ist eine Opéra-comique, was aber nicht bedeutet, dass es eine komische Oper wäre, sondern sie steht in der Tradition eines leichteren Genres, aus dem sich auch die französische Operette eines Offenbach entwickelt hat. Bizets Carmen hat keine durchkomponierte Form, sondern Musik nummern, die sich abwechseln mit gesprochenem Text. Im weitesten Sinne hat das etwas von einem Vaudeville. Diese heterogene, offene Form, kombiniert mit dieser leidenschaftlichen Tragödie, finde ich sehr reizvoll. Hätte Janáček die Novelle von Prosper Mérimée vertont, auf der Carmen basiert, wäre definitiv etwas ganz anderes dabei herausgekommen. Bizets Oper aber ist wie eine Popcorn-Maschine, im besten Sinne.
Carmen ist eines der Stücke, in das viele Klischeevorstellungen eingewoben sind. Das rote Kleid der Protagonistin, das Spanienbild – Bizet selbst war nie in Spanien. Wie gehst du mit diesen Klischees um?
Das Stück hat viele Fallstricke. Spanien, wie man es von Kitschpostkarten mit Flamencotänzerinnen und aufgeklebtem Stoff in Glitzer kennt, will ich so natürlich nicht auf der Bühne sehen. Das ist eine kommerzialisierte Verkitschung und Verfremdung des spanischen Kolorits. Spanien ist als Farbe für dieses Stück aber dennoch wichtig, allerdings darf man nicht versuchen, Spanien als Örtlichkeit naturalistisch auf die Bühne zu bringen.
Was bedeutet das für deine Inszenierung?
Bizets Carmen ist eben kein naturalistischer Stoff, sondern von der Form her ausgesprochen heterogen. Darin unterscheidet sich die Oper auch fundamental von der Novelle von Mérimée. Wollte man versuchen, aus Angst vor der Kitschpostkarte zum «harten» Realismus der Vorlage zurückzukehren, müssten die Vaudevillehaften Nummern unweigerlich lächerlich wirken. Alle Versuche, Milieus, wie das der Arbeiterinnen der Zigarrenfabrik oder der Schmuggler, in einen realistischen, gesellschaftlichen Rahmen zu verorten, scheitern an der Form. Deshalb zeigen wir auf der Bühne zunächst nichts anderes als eine leere Bühne, die Bühne des Uraufführungsortes, der Pariser Opéra Comique. Wir erwecken die Geister dieser Oper, die dort geboren wurden, zum Leben. Unsere Inszenierung ist eine Hommage an die Opéra Comique, an die Reise, die diese Oper seither angetreten hat, und an den Mythos Carmen.
Zu Beginn der Oper schauen wir dem Chor der Soldaten zu, wie er Passanten beobachtet, die über den Platz drängen. Wir schauen also Zuschauenden beim Zuschauen zu.
Es gibt immer wieder Situationen, in denen Protagonisten in einer Öffentlichkeit erscheinen, sei es Carmen oder Escamillo, denen die Leute zujubeln. Ganz oft hat man das Gefühl einer Showbühne: Wenn Carmen ihre Habanera singt, beim Schmugglerquintett, oder bei Escamillos Auftrittslied.
Die Figur der Carmen ist schillernd und seit der Uraufführung den widersprüchlichsten Deutungsversuchen ausgesetzt gewesen: Vom Bürgerschreck der Uraufführung, über die gefährliche Verführerin bis zur emanzipierten Frau, sie ist eine Wanderin zwischen den Welten, ein rebellischer Vogel. Wer ist Carmen für dich? Ist sie eine moderne Figur?
Ja, sicher. Carmen ist eine komplexe Frauenfigur und hat bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. Sie vertritt eine absolut radikale Haltung, was ihre Selbstverwirklichung, insbesondere ihre erotische Selbstverwirklichung angeht. Carmen behauptet ihren Willen, ohne Kompromisse einzugehen. Sie agiert intuitiv und absolut ehrlich. Für Carmen ist alles, was sie reglementiert und einengt, unerträglich. Das sind natürlich auch Dinge, die sich zuweilen gegen das gesellschaftliche Zusammenleben richten und etwas Zersetzendes haben können. Man kann das durchaus kritisch sehen, denn Gesellschaft bedeutet auch, dass es Regeln braucht. Gibt es keine Regeln, muss man eben bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Carmen tut das in letzter Konsequenz bis in den Tod.
Sie bewegt sich ausserhalb des Systems,«là bas, là bas»…
Bizets Oper ist letztlich ein Stück über den Gegensatz zwischen einem bürgerlichen, geregelten Leben mit seinen einengenden Aspekten und dem anarchischen Freiheitsdrang auf der anderen Seite. Dieser Wunsch nach Freiheit ist zunächst einmal positiv besetzt. Aber dadurch, dass die bürgerliche, dominierende Welt dies nicht zulässt, wird dieses Freiheitsstreben in die Kriminalität, in die Illegalität gedrängt.
Was findet eine Frau wie Carmen an einem so braven und aufgeräumten Soldaten wie José?
José ist durchaus ein interessanter Typ. Als Carmen ihn zum ersten Mal sieht, gefällt er ihr einfach. Sie wirft ihm eine Blume zu, zunächst nicht aus einem absichtsvollen Begehren heraus, sondern eher aus Provokation und Lust am Spiel. Damit könnte die Geschichte bereits zu Ende sein. Doch dann geschieht dieser Zwischenfall mit dem Messerkampf in der Fabrik – das ist von den Autoren absolut genial erfunden –, José muss Carmen festnehmen, und jetzt macht sie ihm schöne Augen, damit er sie freilässt. Es berührt sie, dass er es tatsächlich tut und dafür degradiert und ins Gefängnis gesteckt wird. Eine Art Liebe auf den zweiten Blick, würde ich sagen.
Woran scheitert die Beziehung von Carmen und José letztlich?
Ihre Lebensentwürfe sind vollkommen unvereinbar. schon bei ihrem ersten Wiedersehen stellt sich Ernüchterung ein. Als Carmen verführerisch für ihn tanzt, erklingt das Trompetensignal aus der Kaserne, und José erklärt, dass er zurück muss. Damit ist die Sache für Carmen eigentlich gelaufen. Dann kommt diese genial platzierte Blumenarie, in der ihr José bekräftigt, wie wichtig sie für ihn ist. Das berührt Carmen, aber sie fordert von ihm, sein altes Leben aufzugeben. José schwankt, entscheidet sich zuletzt jedoch dagegen. Dummerweise erscheint dann sein Vorgesetzter und alles fliegt ihm um die Ohren: José ist ein cholerischer Mensch, es folgen Befehlsverweigerung und Gefangennahme des Chefs mit Waffen – der «Point of no Return» für José. Kürzlich habe ich den Film Baader-Meinhof-Komplex gesehen. Ulrike Meinhof, die als Journalistin mit einem einzigen spontanen Sprung aus dem Fenster ihre gesicherte bürgerliche Existenz unwiederbringlich hinter sich lässt und in den Untergrund wechselt – das hat eine ganz ähnliche Dynamik wie Josés Absturz. Diese Fallhöhe gibt es in der Novelle von Mérimée nicht. Don José ist bei ihm von Anfang an ein gewalttätiger Typ.
Als Gegenpart zu Carmen haben Bizets Autoren die Figur der Micaëla erfunden. Was verkörpert sie für José? Für welche Werte steht sie ein?
Micaëla lebt in dieser geregelten Welt, so wie wir alle auch. Sie verkörpert ein typisches Frauenschicksal im 19. Jahrhundert mit seinen begrenzten Möglichkeiten. Was mich an ihr beeindruckt ist ihre Liebe zu José, die Unbedingtheit und der Mut, mit dem sie sich dafür einsetzt. José ist davon am Anfang überfordert, aber ich bin überzeugt: Die beiden hätten ohne den Zwischenfall in der Fabrik miteinander durchaus eine Chance gehabt. Erst im dritten Akt, bei dem ihr klar wird, dass José nicht mehr der Gleiche ist wie früher, dass er unvermeidlich auf einen Abgrund zusteuert, gibt sie ihn auf. Als bewusste Entscheidung und aus persönlicher Stärke. Um Micaëla mache ich mir keine Sorgen: Sie wird José vergessen und einen anderen Mann kennenlernen. Da wird nichts nachhängen.
Micaëla ist auch das Sprachrohr für Josés Mutter, die selber nie auftaucht im Stück.
Das ist die Welt, aus der José kommt. Er hat ihr viel zu verdanken. Seine Mutter hat ihn alleine und unter schwierigen Bedingungen aufgezogen und ihm immerhin ermöglicht, in der Hauptstadt Sevilla eine Offizierslaufbahn anzutreten. Die Mutter ist die Verwurzelung Josés, der Gegenpol zu seinen zehrenden, gefährlichen Leidenschaften, die ihn in den Katastrophenmodus schleudern.
«Prends garde à toi!» (Pass auf!), diesen Ausdruck hört man unzählige Male in dieser Oper, alles scheint hier Gefahr und Bedrohung zu sein. Einer, der schon von Berufs wegen mit der Gefahr lebt, ist Escamillo, der Torero.
Escamillo ist wie Carmen ein Grenzgänger und riskiert jeden Tag sein Leben. Als Stierkämpfer verkörpert er auf der einen Seite den reinen Machismo, aber gleichzeitig auch Mut, Eleganz, Gewandtheit und Kosmopolitismus. Das ist ein Typ wie ein Rockstar, und José hat dagegen keine Chance. Escamillo ist grosszügig, und er kann es sich auch leisten. Er hat diese vollkommene Unabhängigkeit, dass er sich um nichts kümmern muss. Doch der Preis dafür kann hoch sein: In der Arena ist er allein. Der Stier greift an, es geht etwas schief, ein Pferd fällt um und plötzlich jubeln alle dem Stier zu...
Was sucht Carmen in ihm? Ist für sie die Liebe vielleicht auch Kampf und Krieg?
Ich bin mir nicht sicher, ob Carmen wirklich Liebe sucht, sie ist jemand, der einfach lebt. Sie beobachtet die Welt, nimmt sie auf, äussert frei ihre Meinung und lebt ihr Leben. Sie ist sehr scharf in ihrer Selbstbeobachtung und in der Beobachtung der Beziehung mit José. Sie merkt genau, wenn etwas nicht mehr stimmt und redet sich nichts schön. Carmen ist sofort zur Veränderung bereit, da gibt es kein Beharren auf ihrer Seite.
Trotzdem flieht Carmen am Ende nicht vor José, sondern bleibt, obwohl die Karten ihr zuvor den Tod prophezeit haben und sie auch von ihren Freundinnen vor José gewarnt wird. Warum?
Sie weiss, dass sie das Ende ihrer Beziehung mit José selber klären muss, ein für allemal! Ihre Haltung ist sehr klar. Das macht sie ganz allein, ohne vorher die Polizei gerufen oder Escamillo um Hilfe gebeten zu haben. Carmen weigert sich, die Position des Opfers einzunehmen, und die Freiheit ihrer persönlichen Entscheidung geht ihr über alles. Sie sagt zu José, dass sie niemals nachgeben werde: «Frei wurde ich geboren, und frei werde ich sterben».
Am Ende steht allerdings ein Femizid: Don José kann mit seinen Aggressionen nicht umgehen, er will von Carmen nicht ablassen und tötet sie.
Don José gehört zu jenen Menschen, die eine Vorstellung davon hegen, wie «eine Frau sein sollte». Diese lässt nicht zu, dass Frauen wirklich unabhängig und stärker sein können als Männer. Dies ist der Grund für Don Josés Eifersucht. Doch indem er Carmen bedroht und dann tötet, offenbart er seine eigene Schwäche und liefert den Beweis für sein Scheitern. Carmen stirbt, weil sie stärker war als er. Sie stirbt, aber ihr Mythos wird weiterleben – wie eine Heldin einer griechischen Tragödie. Es ist ein emanzipatorisches Stück, bei dem der Mann nicht gut wegkommt.
Du kommst eigentlich gerade aus der Welt von Wagners Ring. Was bedeutet Carmen für dich in diesem Kontext? Zwischen der Uraufführung des Rings und Bizets Carmen liegt nur ein Jahr.
Das ist in musikhistorischer Hinsicht der ganz grosse Gegensatz im 19. Jahrhundert, auch wenn sogar Bizet zuweilen des Wagnerismus beschuldigt wurde. Wagner war mit der Uraufführung des Rings 1876 in Bayreuth auf dem Höhepunkt seiner weltweiten Akzeptanz. Sein Musiktheater war geprägt von einer ausserordentlich starken konzeptionellen neuen Ästhetik, die Inhalt und Form perfekt miteinander vereint. Das ist ein Monolith. Doch es gibt eben auch noch dieses Andere. Nietzsche, der ein enger Freund von Wagner und auch sehr vertraut war mit Wagners Ästhetik, wandte sich nach der Uraufführung des Rings in Bayreuth dezidiert von Wagner ab und kritisierte ihn in seiner Schrift Der Fall Wagner stark. Er führte als Antithese zu Wagners Musiktheater Bizets Carmen ins Feld, die er sich unzählige Male angehört hat. Für Nietzsche stellte Carmen eine willkommene Alternative zu Wagners inhaltsschwerer Philosophie dar, zu Weltenbrand und Abschiedspathos. In Carmen prallen Figuren und Haltungen aufeinander. Das ist extrem, das ist bodenständig, das ist pralles Theater – eine ganz grosse Vielfalt eben – Drama, Operette, Pathos und Ironie in einem.
Nietzsche sprach in Bezug auf Carmen von einer Kunst, die die Vitalität des Augenblicks feiere. Er meinte, er werde ein besserer Mensch, wenn ihm dieser Bizet zurede …
Ich kann Nietzsche jedenfalls gut verstehen. Sich mit Carmen zu beschäftigen, ist wie frische Luft zwischendurch. Es ist sehr schön, dass wir den kompletten Ring und die Carmen in Zürich fast gleichzeitig spielen und diese grosse Klammer der Opernrezeption des 19. Jahrhunderts unserem Publikum präsentieren können – und dass ich selbst das machen darf.
Das Gespräch führte Kathrin Brunner
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 110, April 2024.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Zwischenspiel, 27.03.24

Music has no borders!
Marina Viotti ist die neue Zürcher Carmen. In Lausanne geboren, wuchs die junge Mezzosopranistin in einer Musikerfamilie auf. Sie studierte zunächst Flöte und widmete sich dem Heavy-Metal-Gesang. Wie und warum sie schliesslich doch noch zum Operngesang fand, erzählt die vielseitige Künstlerin im Podcast. Zum Podcast
Andreas Homoki über «Carmen»
«An dem Stück stimmt einfach alles», meint Andreas Homoki, Regisseur unserer neuen «Carmen». Im Video erklärt er uns, warum diese Oper so beliebt ist, welche Rolle die Pariser Opéra Comique in seiner Inszenierung spielt und wie er seine Hauptdarstellerin gefunden hat.
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
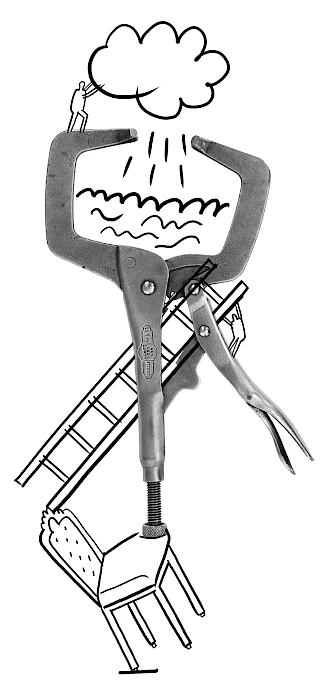
Nach Paris und retour
Die Premiere von Andreas Homokis «Carmen»-Inszenierung fand letztes Jahr an der Opéra Comique in Paris statt. Da die Opéra Comique, mit der wir das Stück koproduzieren, über keine eigenen Werkstätten verfügt, haben wir die Dekoration für beide Spielstätten gebaut, und das war insofern sehr spannend, weil Andreas Homoki und der Bühnenbilder Paul Zoller den Bühnenraum der Opéra Comique als Bühnenbild gewählt haben. Dessen seitliche Wände bestehen aus in dunklen Rot- und Brauntönen gebrannten Ziegelsteinen, die von dunkelgrau lackierten Stahlträgern eingefasst sind. In der ebenfalls geziegelten Rückwand befinden sich fünf markante, über 10 m hohe Stahltore, ebenfalls in dunklem Grau gehalten.
Es hätte also im Grunde genommen für die Aufführungen in der Opéra Comique gar kein Bühnenbild und keinen Bühnenbildner gebraucht. Doch damit Andreas Homoki auch überraschende Auftritte von den Seiten machen und die Handlung zu verschiedenen Zeiten spielen lassen kann, entwarf Paul Zoller ein paar Vorhänge und vier seitlich stehende Wände. Die Wände sollten genau im Stil der echten Wände gebaut werden.
Wir stellten schnell fest, dass die Bemalung der Wände überhaupt nicht einfach ist: Da diese Seitenwände in der Opéra Comique direkt vor der echten Rückwand stehen, mussten sie auch genauso aussehen wie diese echte Ziegelwand mit den Stahlträgern. Paul Zoller hatte zwar Fotos mitgebracht, und uns wurden noch viele weitere von unseren Kollegen aus Paris als Vorlage zugeschickt – aber die halfen hier nicht weiter: Diese Bilder sahen auf jedem Ausdruck und an jedem Bildschirm anders aus, und die Maler:innen hatten anhand der Fotos auch keine eindeutigen Angaben über Oberflächen und den Glanzgrad.
Auch Paul konnte uns hier nicht weiterhelfen. So haben wir in unseren Werkstätten eine kleine tragbare Wand mit Ziegeln aus Styropor und Stahlträgern aus Holz gebaut, und unsere Theatermaler sind damit kurzerhand nach Paris gefahren und haben in der Opéra Comique mit einer Art überdimensionalem Tuschkasten aus verschiedenen Dispersionsfarben diese Musterwand solange farblich behandelt, bis sie genauso aussah wie die Originalwand. Diese diente dann als Malvorlage in unseren Werkstätten für das ganze Bühnenbild: Denn für Paris mussten zwar nur die zusätzlichen seitlichen Wände gebaut werden, für Zürich wiederum bauten wir in den Werkstätten dann die Rückwand aus Paris mit den riesigen Stahltoren 1:1 nach, da unsere eigene Theaterrückwand nur schönes Schwarz zu bieten hat und überhaupt nicht zu den seitlichen Wänden passen würde.
Als im vergangenen Jahr die Premiere in Paris stattfand, sind diese zusätzlichen seitlichen Wände niemandem aufgefallen. Diese fügten sich in die Architektur des Bühnenhauses perfekt ein. Die Werkstätten haben wieder einmal echt gute Arbeit geleistet.
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 110, April 2024.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Fotogalerie
Ich sage es mal so
Stumme Antworten auf grundsätzliche Fragen – mit Saimir Pirgu, der in Georges Bizets «Carmen» den Don José singt.Ich sage es mal so ist eine Interviewform in unserem MAG, in der Künstlerinnen und Künstler des Opernhauses - nach einer Idee des SZ-Magazins - in Form eines Fotoshootings Auskunft über sich geben
Hintergrund
Eine Stadt erwacht aus der Schockstarre
Georges Bizets «Carmen» ist ohne die Stadt nicht denkbar, in der die Oper entstanden ist. Paris befand sich zur Zeit der Uraufführung von «Carmen» an der Opéra Comique in einer traumatischen Umbruchsphase. Volker Hagedorn entwirft ein Panorama der französischen Metropole um 1875.
Blicken wir über die Stadt nach Süden, auf der Anhöhe von Montmartre stehend. Es ist März 1875, der Monat der Uraufführung von Carmen. Hier oben begann vor vier Jahren die Katastrophe, und Georges Bizet hätte sie vielleicht nicht überlebt, wäre er in Paris geblieben, als Nationalgardist und gar noch in seiner Uniform. Vor uns auf dem Hügel standen die 227 Kanonen… Aber dazu kommen wir gleich. Links von uns am Hang ist die Windmühle, die später auch van Gogh gemalt hat. Das flache Satteldach unten im Dächermeer ist die Madeleine, die Kirche, deren Titularorganist schon seit 17 Jahren Camille Saint-Saëns ist. Ein Stück weiter hinten ragt wie ein mastenloses Schiff die ungeheure Masse des neuen Opernhauses, der Opéra Garnier, aus dem Dächermeer. Anfang des Jahres wurde sie eröffnet. Die Salle Favart, das Haus der Opéra Comique, in der Carmen uraufgeführt wurde, können wir von hier aus nicht sehen, und ein paar andere Gebäude könnten wir schon deswegen nicht finden, weil sie vor vier Jahren niederbrannten. Auf den Eiffelturm müssen wir noch vierzehn Jahre warten.
Wer wissen will, was das für eine Stadt ist, in der Carmen ihren Anfang nimmt, von der ersten Konzeption bis zur Uraufführung, kommt um das Trauma nicht herum, das Paris wenige Jahre zuvor erlitten hat, ein beispielloses Gemetzel mit zehntausenden von Toten. Wie alle Grausamkeiten bis heute hat es seine Vorgeschichte. Im Sommer 1870, als Georges Bizet und seine Frau Geneviève Ferien in Barbizon machen, wo Corot und Courbet die Landschaft malen, stolpert Napoleon III. in einen Krieg mit Preussen und seinen Verbündeten, der zur Niederlage Frankreichs, dem Ende des Zweiten Kaiserreichs und zur Belagerung der Stadt Paris führt.
Am 18. September ist der Ring geschlossen, die 1,8-Millionen-Stadt mit ihren elf Bahnhöfen von aller Versorgung abgeschnitten wie auch von der Telegrafie. Im Oktober wird selbst Pferdefleisch zur Delikatesse, im Dezember werden die beiden Elefanten des Zoos geschlachtet, man mariniert inzwischen auch Ratten. Die Deutschen feuern täglich bis zu 400 Geschosse auf die Stadt. Im Januar verschwinden nach den Bäumen des Bois de Boulogne und der Boulevards auch die Ulmen der Champs-Élysées als Brennholz in den Pariser Öfen. Derweil lässt sich, mit teutonischem Feingefühl, ausgerechnet im Spiegelsaal von Versailles Wilhelm I. zum Kaiser des neugründeten deutschen Reichs ausrufen – eine Demütigung, der am 28. Januar der Waffenstillstand folgt, die Kapitulation von Paris, und am 1. März 1871 das Defilee der deutschen Truppen auf den Champs-Élysées. Mit dabei gewesen sein muss Georges Bizet, der als begeisterter Republikaner schon im September der Nationalgarde der neuen, Dritten Republik beitrat. «Wir haben bei dieser traurigen Gelegenheit unsere Pflicht getan. Mit dem ersten Trommelschlag um 8 Uhr morgens nahmen wir unsere Gewehre und formierten uns zum cordon sanitaire um unsere Feinde.» Aber es sind – schon am nächsten Tag verschwinden die Deutschen wieder aus der Stadt – nicht nur diese Feinde, denen sich das folgende Inferno verdankt.
Die Wahlen zur Nationalversammlung haben im Februar 1871 Frankreichs monarchistische Rechte an die Macht gebracht, während die Pariser mehrheitlich republikanisch gesinnt sind und den Waffenstillstand als Verrat sehen. Die Nationalversammlung nimmt ihren Sitz vorerst in Versailles, wo der 73-jährige Regierungschef Adolphe Thiers mit harten Erlässen viele Pariser in die Armut treibt und dazu noch beschliesst, die 227 Kanonen abtransportieren zu lassen, die auf dem Hügel von Montmartre stehen. Kanonen, die aus dem Westen der Stadt von den Parisern – ohne Pferde! – hierher geschleppt wurden, um sie vor der Beschlagnahme durch die Deutschen zu sichern. So, wie sie jetzt stehen, haben sie nur symbolischen Wert. Aber auf den kommt es Thiers an. «Damit», notiert Victor Hugo, «hat er den Funken aufs Pulver geworfen.»
Die Abholung der Kanonen am 18. März scheitert, die Regierungssoldaten fraternisieren mit der aufgebrachten Menge, zwei Generäle werden erschossen, man baut Barrikaden. Bizet ist indessen entsetzt von der Zurückhaltung der Nationalgarden. Seinem Brief vom 20. März zufolge gehört er zu jenen 5.000 von 300.000 Nationalgardisten, die bereit wären, für Ordnung zu sorgen, zugleich begrüsst er den Rückzug der Armee. Die Mehrzahl der Pariser – Arbeiter und Handwerker – wählt am 26. März eine linke Stadtregierung, die von nun an praktisch gegen Versailles regiert. In der «Commune», so heisst das Gemeinwesen nun, werden zur Linderung der Not vorübergehend die Mieten aufgehoben, es soll kostenlosen Grundschulunterricht geben, eine Berufsschule für Mädchen eröffnet werden, die Gleichberechtigung der Frauen wird diskutiert. Grossbürger und Unternehmer verlassen die Stadt, auch die Bizets. So bleibt ihnen die «blutige Woche» erspart. Mit 100.000 zusätzlichen Soldaten, die Bismarck rechtzeitig aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat, gelingt den Versailler Truppen am 21. Mai der Durchbruch in die Stadt. Paris ist umgeben von jenem Mauerring, den Thiers selbst als Ministerpräsident der Julimonarchie bis 1844 errichten liess und innerhalb dessen die Ringeisenbahn verläuft. Dann beginnt, Barrikade um Barrikade, ein Kampf um Paris, der auf Seiten der Eroberer in ein Gemetzel umschlägt. Gefangene Nationalgardisten werden von den Regierungssoldaten erschossen, mit Säbeln zerhackt, totgeschlagen. Bald wird jeder umgebracht, der irgendwie auffällt. In ihrer Verzweiflung ermorden die Kommunarden 85 Geiseln, darunter den Erzbischof von Paris.
Die Vergeltung ist umso schlimmer. Es kommt zu Massenhinrichtungen, nach Schätzungen sind es bis zu 30.000 Tote. Manche Strassen sind wegen der Leichenberge unpassierbar. Der Gestank der Verwesung mischt sich mit dem Rauch der Brände. Um die Angreifer zu stoppen, haben die Kommunarden ganze Häuserzeilen eingeäschert, viele prominente Gebäude fallen der Zerstörungswut beider Seiten zum Opfer oder dem Artilleriebeschuss. «Der letzte Kanonenschuss ist am gestrigen Sonntag abgefeuert worden, um halb drei», schreibt Bizet am 29. Mai an seine Schwiegermutter in Bordeaux, Hannah Léonie Halévy, im selben Brief kritisiert er Presseberichte über Gräueltaten der Kommunarden als Erfindung einer «abscheulichen Brut von Journalisten». Er und Geneviève befinden sich noch in Le Vésinet, zwölf Kilometer westlich von Paris, wo der Vater des Komponisten zwei kleine Sommerhäuser besitzt. Am selben Tag notiert Émile Zola in Paris: «Man befürchtet Pest und Cholera, selbst wenn all diese Leichen auf den bereits bestehenden Friedhöfen beerdigt würden. Man sagte mir sogar, dass an mehreren Stellen auf den Boulevards und in allen Avenuen, die man aufreissen konnte, Tote begraben wurden. Ich weiss nicht, ob diese Leichen dort bleiben werden, unter den Füssen der Spaziergänger, deren fröhliche Stimmen sie an den öffentlichen Feiertagen über ihren Köpfen hören würden.»
Indessen geht die Vergeltung weiter: 43.000 Männer, Frauen und Kinder werden inhaftiert, tausende verurteilt (der Vater von Claude Debussy bleibt bis 1875 im Gefängnis) und in entfernteste Kolonien deportiert. Bizet stellt erleichtert fest: «Unser Haus hat eine Menge Kugeln abbekommen, aber unsere Wohnung ist völlig unversehrt.» Sehr fröhlich sind die Pariser nicht im Sommer nach dem Blutbad, wie Gustave Flaubert beobachtet: «Die eine Hälfte der Bevölkerung hat Lust, die andere zu erwürgen, welche denselben Wunsch hegt. Das ist klar in den Augen der Passanten zu lesen.» Bizet, der nichts so fürchtet wie eine katholische Monarchie, klammert sich «mit der Energie der Verzweiflung» an Adolphe Thiers, diesen «energischen kleinen alten Mann. Er allein kann zugleich die Kommunarden und die Reaktionäre scheitern lassen.» Tatsächlich wird Thiers erster Präsident der Dritten Republik, während in Paris die «Normalität» in einem Tempo wiederhergestellt wird, als habe man nur einen bedauerlichen Zwischenfall hinter sich. Für Kontinuität bürgt schon der unter Napoleon III. begonnene Umbau der Stadt nach den Plänen Haussmanns, der nun fortgesetzt wird, ergänzt durch Reparatur, Abriss oder Neuerrichtung der niedergebrannten Gebäude. Während Kohorten von englischen Touristen anreisen, um die Ruinen zu bestaunen, fasst der New Paris Guide das Geschehen ganz im Sinne der regierungstreuen «Geschichtssschreibung» zusammen: «Paris hat schwer gelitten durch die überwältigenden Ereignisse von 1870 und mehr noch durch die Grausamkeiten der Commune. Dennoch hat die Stadt in unglaublich kurzer Zeit ihre Verluste wieder wettgemacht.»
Ganz so einfach ist es für Georges Bizet nicht. Die Opéra Comique beauftragt ihn nicht, wie vor dem Krieg geplant, mit einer abendfüllenden Oper – es wäre seine dritte nach den Perlenfischern und der Schönen von Perth, beides keine Erfolge für einen, der als Wunderkind begann und als Komponist alle verfügbaren Preise abräumte, und man einigt sich auf den Einakter Djamileh. Das Stück knüpft an den seit Jahrzehnten beliebten Orientalismus an, lässt eine Sklavin in Liebe zu ihrem Gebieter entbrennen und bringt es bis 1875 doch nur auf elf Vorstellungen. Bizet verdient sein Geld mit Arrangements, Gelegenheitskompositionen und Kurzzeitjobs und erhält seine nächste Bühnenchance als Zulieferer für ein Theaterstück von Alphonse Daudet.
Obwohl man auch hier auf Exotismus setzt – für Pariser ist die Provence als Schauplatz «fast so fremdartig wie Spanien und Ägypten» (Winton Dean) – wird L’Arlesienne im Oktober 1872 ein Fiasko, und Daudet schreibt fortan nur noch Romane. Die Bühnenmusik aber, die Bizet für das 26-köpfige Orchesterchen des Théâtre du Vaudeville komponiert hat, lässt so aufhorchen, dass Jules Pasdeloup die Stücke, zur Suite verbunden, im Cirque d’Hiver mit grossem Orchester realisiert – dieser Kuppelbau im 11. Arrondissement hat 3.900 Plätze. Es folgen weitere Aufführungen, die einschlagen. Es ist, als habe der 33-jährige Komponist einen neuen, unmittelbaren Ton gerade deswegen gefunden, weil er frei von dem Druck war, ein Meisterwerk schaffen zu müssen.
Für diesen neuen Sound haben die beiden Manager der Opéra Comique einen Sinn, so verschieden sie sind. Adolphe de Leuven, 72 Jahre alt, leitet das Haus schon seit 1862, seit 1870 ist der halb so alte Camille du Locle an seiner Seite, und nun wollen sie es doch mit einer grossen Oper von Bizet riskieren. Dabei spielen wie immer und überall und besonders in Paris Beziehungen eine Rolle. Als Librettisten schlägt du Locle seinen Freund Ludovic Halévy vor, der zugleich der Neffe von Bizets Schwiegervater und Kompositionslehrer Fromental Halévy ist und der vor allem, zusammen mit Henri Meilhac, das erfolgreichste Autorenduo des Operettenkönigs Jacques Offenbach bildet – von La Belle Hélène über La Grande-Duchesse de Gérolstein bis zu La Périchole. Gerade haben sie La Vie parisienne von 1866 wieder aufgewärmt, aber es zeichnet sich 1872 schon ab, was Halévy drei Jahre später diagnostiziert: «Offenbach, Meilhac und ich – wir sind am Ende, das ist die Wahrheit… Es fällt uns nichts mehr ein.» Offenbachs grosse Zeit ist mit dem Kaiserreich dahingegangen. Es fehlt mit Napoleon III. das schillernde Zentrum der Macht, das die Spottlust inspiriert, und der Pariser Sinn für Ironie lässt sich nach dem Blutbad nicht neu aufbauen wie das niedergebrannte Rathaus. Es reizt die beiden Autoren, mit Bizet, einem fähigen Komponisten aus ihrer eigenen Generation, den 1830ern, etwas Neues auf die Beine zu stellen. Aber was?
In der Liebe der Pariser zu exotischen Schauplätzen hat Spanien schon seit langem einen Platz, aber Mitte der 1870er, so Orlando Figes, «erreichte das französische kulturelle Interesse an Spanien seinen Höhepunkt», nicht zuletzt als Abwendung von den Deutschen. Und in der Mitte des musikalischen Interesses am südwestlichen Nachbarland befindet sich der Salon von Pauline Viardot in der rue de Douai 50, wenige Schritte von der Nummer 22 entfernt, in der Georges und Geneviève Bizet wohnen und wo im Sommer 1872 ihr Sohn Jacques zur Welt gekommen ist; im selben Haus wohnt auch Ludovic Halévy, der künftige Carmen-Librettist. Auch bei den Viardots erwies sich alles als unbeschädigt, als sie aus London zurückkehrten, wo sie die Ereignisse abgewartet hatten. Im Dachgeschoss ihres zweistöckigen Baus erhielt nun Iwan Turgenew zwei Zimmer, der russische Romancier, der mit Pauline und ihrem um 20 Jahre älteren Ehemann Louis schon lange in einer ménage à trois lebt. Auch Bizet besucht die Donnerstagabende, an denen Pauline, geborene García, Tochter spanischer Sänger, Mezzosopranistin, Komponistin, Kosmopolitin, nahezu allen in Paris tätigen Komponisten seit Rossini verbunden, neue oder rare Musik aufführen lässt und selbst singt. Was bei ihr an spanischer Folklore wie auch Kunstmusik zu hören ist, inspiriert Édouard Lalo und Camille Saint-Saëns; Bizet ist besonders von einer Habanera beeindruckt, «El arreglito», aus der er Carmens Arie «L’amourest un oiseau rebelle» machen wird. Aber wie kommt er auf Carmen, die Novelle von Prosper Mérimée, die seit 1847 in mehreren Auflagen erfolgreich war? Ludovic Halévy erinnert sich, Bizet sei selbst darauf gekommen. Doch von Émile Zola wissen wir, dass Turgenew seinen Kollegen Mérimée bewunderte und ihn sogar gegen Flauberts Geringschätzung verteidigte. Gut möglich, dass er Bizet den Tipp gab.
«Carmen! Die Carmen von Mérimée! Die von ihrem Geliebten ermordet wird? Und dieses Milieu der Diebe, der Zigeunerinnen, der Zigarettenarbeiterinnen! An der Opéra Comique, dem Theater der Familien!» Adolphe de Leuven, der ältere der beiden Theaterchefs, ist entsetzt, als Librettist Halévy mit seinem Vorschlag kommt. An jedem Abend, erklärt er ihm, seien fünf bis sechs Logen reserviert für Treffen junger Damen und Herren, die eine Ehe erwägen. Die Hälfte aller Logen verfügt über einen eigenen kleinen Salon fürs Private zwischen den Akten, die kosten acht Francs (was etwa 50 Euro entspricht), sämtliche Logen sind wie zu Kaisers Zeiten mit einer Klingelschnur versehen, damit man sich Erfrischungen bringen lassen kann. Wie eh und je dürfen im Parkett nur Herren sitzen. Und in so einem Haus soll nun die Titelheldin von ihrem Ex-Lover abgestochen werden, anstatt wenigstens den üblichen gewaltfreien Opfertod zu erleiden, so wie Juliette oder Violetta!
Der jüngere Opernchef Camille du Locle ist risikofreudiger, setzt sich durch und leitet ab 1873 das Haus allein. Er will die Lücke ausnutzen, die das Théâtre Lyrique hinterlassen hat, das Opernhaus nahe dem Hôtel de Ville, das bei den Kämpfen im März 1871 ebenfalls in Flammen aufging und zuvor mit gewagten Novitäten auffiel, von Berlioz’ Troyens über Gounods Roméo et Juliette bis zu Bizets Perlenfischern. Für die Musikgeschichte ist es fast ein Glück, dass in einer Oktobernacht 1873 gleich das nächste Opernhaus abbrennt, die prestigeträchtige Salle Le Peletier, zuständig für Grand Opéra, historische Stoffe, Staatsbesuche. Ursache des Brandes ist möglicherweise die einst so innovative Gasbeleuchtung. Eine Folge ist, dass Georges Bizet die Arbeit an einer Oper abbricht, mit der ihn dieses Haus beauftragt hatte und die seiner Arbeit an Carmen im Weg war – wobei er Don Rodrigue wichtiger fand.
Noch ein Ausfall, der zum Glücksfall wird: Die ursprünglich vorgesehene Marie Roze lehnt die Partie einer Titelheldin ab, die am Ende ermordet wird, und so wird schon Ende 1873 Célestine Galli-Marié verpflichtet, 35 Jahre alt, ein Liebling des Pariser Publikums und in ihrer Abenteuerlust der Carmen so ähnlich, dass der Komponist ihr während der Arbeit wohl ähnlich nahe kommt wie zu gleicher Zeit seine Frau dem schillernden Klaviervirtuosen Élie-Miriam Delaborde, dem Sohn des eigensinnigen Chopin-Vertrauten Charles Valentin Alkan. Aber auch die Entschlossenheit Carmens bringt ihre Darstellerin mit. Als Opernchef du Locle auf den letzten Metern doch noch kalte Füsse bekommt und auf einem unblutigen Schluss besteht, droht Galli-Marié – gemeinsam mit dem Sänger des Don José –, die ganze Produktion platzen zu lassen. Das wirkt.
Das offizielle Opernhauptereignis des Jahres 1875 findet am 5. Januar statt. Im prachtvollen Palais Garnier, nach vierzehn Jahren Bauzeit fertiggestellt, drängen sich «die Begünstigten und Begüterten, für die dieser Palast geschaffen war». Eine einfache Loge kostet an diesem Abend 120 Francs. In der Hofloge, ursprünglich für Napoleon III. bestimmt, nimmt Marschall Mac-Mahon Platz, als Präsident der Dritten Republik Nachfolger von Adolphe Thiers. Er ist jener Monarchist, der 1871 die Truppen von Versailles bei der Vernichtung der Commune befehligt hatte. Man wohnt einem Galaabend mit bewährten Szenen aus Werken von Meyerbeer und Delibes bei. Das wahre Opernereignis zwei Monate später, am 3. März in der Opéra Comique, ist zuerst ein Flop, wenngleich ein prominent besuchter. Natürlich sind die Viardots und Turgenew gekommen, aber auch Jacques Offenbach und seine Stardarstellerin Hortense Schneider, die Komponisten Gounod und Massenet, Alexandre Dumas der Jüngere und noch zwei Dutzend Kulturzelebritäten. Im ersten Akt von Carmen sind die Leute noch begeistert, im vierten Akt herrscht eisige Ablehnung, so erinnert sich Ludovic Halévy, der den traurigen Komponisten nach Hause begleitet, 20 Minuten bis zur rue de Douai, zu Fuss und schweigend.
«Der krankhafte Zustand dieser Unglücklichen, die ohne Unterlass und ohne Gnade der Glut des Fleisches ausgesetzt ist, ist ein glücklicherweise sehr seltener Fall, der eher die Sorge der Ärzte weckt als das Interesse ehrbarer Zuschauer, die mit ihren Frauen und Töchtern in die Opéra Comique gekommen sind.» Was am 8. März 1875 in Le siècle zu lesen ist, wo der 54-jährige Oscar Commetant den Komponisten auf bedauerlichem Irrweg sieht, das entspricht dem Mainstream der bürgerlichen Presse – aber es hält die Leute keineswegs vom Besuch der neuen Oper ab. Carmen füllt das Haus, und schon bis Ende Mai gibt es 33 Vorstellungen. Dann erleidet der 36-jährige Georges Bizet, der sich von Probenstress und Enttäuschung nicht erholt hat, in seinem Sommerhaus in Bougival, dort, wo er Carmen vollendete, einen tödlichen Herzanfall.
Keine zwei Wochen später wird der Grundstein für Sacré-Cœur gelegt, für dieses Monument eines katholischen, reaktionären Frankreich, und zwar genau dort, wo der Aufstand der Pariser am 18. März 1871 begann, als die 227 Kanonen abgeholt werden sollten. Und genau dort, wo im Mai jenes Jahres «neunundvierzig Menschen, darunter drei Frauen und vier Kinder, zusammengetrieben und am Todesort der beiden Generäle kniend erschossen» wurden. In langen Jahrzehnten wächst dann dieser gewaltige Zuckerstöpsel auf einem Meer von Blut in die Höhe. Weitaus schneller aber wächst der Ruhm von Carmen, dieser Oper, die fern der besseren Gesellschaft spielt und keinen in die Illusion entlässt, es sei doch noch alles gut gegangen. Eine Oper, die in all ihrer Intensität nur in diesen Jahren nach 1871 entstehen konnte.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 110, April 2024.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Fragebogen

Natalia Tanasii
Natalia Tanasii singt die Micaëla in unserer Neuproduktion der «Carmen». Von 2017 bis 2019 gehörte sie zum Internationalen Opernstudio in Zürich. Seither sang sie an wichtigen europäischen Bühnen wie den Salzburger Festspielen, La Monnaie oder dem Teatro Real in Madrid. Jüngst verkörperte sie an der Staatsoper Hamburg sowie am Prager Nationaltheater die Mimì in «La bohème».
Worauf freust du dich bei unserer Carmen-Produktion am meisten?
Momentan geniesse ich vor allem den Probenprozess. Für mich bedeutet er genauso viel wie die Vorstellungen vor Publikum. Den Charakter und die Geschichte zu entwickeln, den Blickwinkel zu verändern, den musikalischen Rahmen Schritt für Schritt zu erweitern und das Ergebnis dann mit dem Publikum zu teilen, das ist ein komplexer, langer Prozess, der mir aber grossen Spass macht. Natürlich habe ich mich auch darauf gefreut, mit Andreas Homoki zu arbeiten. Ich liebe den detaillierten Ansatz, den er uns vermittelt.
Kannst du dich mit der Rolle der Micaëla identifizieren?
Nun, ich sehe sie jedenfalls keineswegs als langweilige, sondern als mutige Figur. Ich mag sie, und trotz der Tradition, sie als schüchtern und ängstlich zu bezeichnen, denke ich, dass sie im Namen ihrer Liebe handelt und ein klares Ziel hat, nämlich José zu finden und mit ihm zusammenzusein. Aber sie ist nicht blind, und die Veränderungen, die bei ihm später eintreten werden, sind nicht schön.
Welche Erfahrung in deiner Ausbildung war für dich am wichtigsten?
Ich hatte das grosse Glück, in meinem Heimatland Moldawien eine gute Ausbildung zu erhalten, in einem speziellen Musiklyzeum namens «Ciprian Porumbescu», in das ich sogar erst recht spät, mit 13 Jahren, nach einer einfachen Musikschule in meiner Stadt eintrat. Dann die Akademie für Musik, Theater und bildende Kunst in Chişinău. Einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen wird das IOS hier am Opernhaus Zürich haben, das für mich weit mehr war als eine Opernschule, vielmehr eine Schule des Opernlebens.
Welches Buch würdest du niemals weggeben wollen?
Die Bibel.
Mit welchem Künstler, welcher Künstlerin würdest du gerne einmal zu Abend essen, und worüber würdet ihr sprechen?
Wenn ich in der Zeit reisen könnte, würde ich gerne die grosse Sopranistin Mirella Freni treffen und mit ihr nicht nur über die Stimme, sondern auch über das Leben sprechen wollen.
In welche Epoche würdest du gerne reisen?
Ins 19. Jahrhundert, als die schönsten Werke entstanden – aber nicht für lange, denn ich mag den Komfort unserer Zeit sehr!
Welches künstlerische Projekt in der Zukunft, das dir viel bedeutet, bereitest du gerade vor?
Alle kleinen und grossen Projekte sind mir wichtig. Momentan bin ich dabei, meinen ersten Gedichtband fertig zu stellen, der hoffentlich in den nächsten sechs bis acht Monaten erscheinen wird, und als musikalisches Projekt freue ich mich sehr darauf, in einem Jahr die Rolle der Gorislava in Glinkas Ruslan und Ludmila an der Hamburgischen Staatsoper zu singen.
Wie wird die Welt in 100 Jahren aussehen?
Ich hoffe, dass sie immer noch ein Ort für Menschen sein wird, die es verstehen zu lieben, zu beten, den Frieden zu schätzen und freundlich zu bleiben!
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 110, April 2024.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Auf dem Pult

Das Englischhorn, dessen Timbre stark an die Farbe des Violoncellos erinnert, wird in der Musik des 19. Jahrhunderts sehr oft als Schwanengesang oder in besonders dramatischen Momenten eingesetzt: Man denke nur an das grosse Englischhornsolo im dritten Akt von Richard Wagners Tristan und Isolde. Das ist auch die Welt, aus der das markante Schicksalsmotiv in Bizets Oper Carmen entstammt. Das Leitmotiv, das in der Ouvertüre zum ersten Mal erklingt, ist zunächst sehr frei, bis zwei unerbittliche, perkussive Schläge – manchmal im Schlagzeug, manchmal in den Streichern als Pizzicato – den melodischen Fluss unterbrechen. Wenn ich das Motiv auf dem Englischhorn spiele, leitet das Solo ausgerechnet Don Josés sogenannte Blumenarie im zweiten Akt ein («La fleur que tu m’avais jetée»), die eine sehr ambivalente, nostalgische Liebeserklärung an Carmen ist. Don José vergegenwärtigt sich hier rückblickend einen Moment im Gefängnis: Die Blume, die ihm Carmen zuvor geschenkt hat und die er auch im Gefängnis bei sich trägt, ist bereits verwelkt. Don José versucht sich an ihren Duft zu erinnern und damit an Carmen, die ihm zwar wie ein böser Dämon vorkommt, die er aber trotzdem wiedersehen und sich ihrer bemächtigen möchte, wie er sagt. Dass Carmen und Don José nie wirklich zueinanderfinden werden, ist für mich in dieser Arie jedenfalls bereits angelegt. Carmen zu spielen bedeutet für mich sehr viel. Ich lernte die Oper als Kind kennen und war damals besonders von ihrem «spanischen» Kolorit fasziniert. Heute interessieren mich ganz andere Aspekte an Carmen: etwa die Frage, wer denn nun Opfer und wer Täter am Ende ist (heute würde man von einem Femizid sprechen), oder der Freiheitsgedanke von Carmen, die sich, koste es, was wolle, ihre eigenen Gesetze verleiht.
—Clément Noël