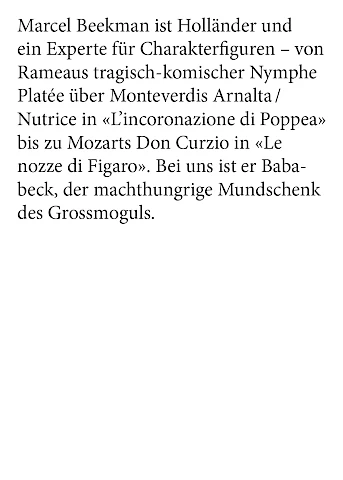Barkouf
Jacques Offenbach (1819-1880)
Opéra-comique in drei Akten
Libretto von Eugène Scribe und Henry Boisseau
In französischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer ca. 2 Std. 55 Min. inkl. Pause nach ca. 1 Std. 20 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Gut zu wissen
Pressestimmen
«Zweieinhalb Stunden unbeschwerte Unterhaltung»
NZZ, 24.10.22«Überbordendes Totaltheater»
SWR2, 24.10.22«Das Opernhaus Zürich bringt ein musikalisch attraktives Werk von Offenbach wie ein buntes und lustiges Märchen wieder auf die Bühne»
SRF1 Regionaljournal, 24.10.22
Interview

Eine dicke, fette Sahnetorte
Im Oktober 2022 hatte «Barkouf» von Jacques Offenbach am Opernhaus Premiere. Regie führte der deutsche Schauspieler und bekennende Operettenfan Max Hopp. Ein Gespräch über ein unbekanntes Meisterwerk, das in einem Moment eine durchgeknallte Revue voller Nonsens ist und im nächsten Moment tiefer Emotionalität Raum gibt
Max, du hattest in der vergangenen Zeit bereits zweimal mit Offenbach zu tun: Als Regisseur von Offenbachs Operette Die Prinzessin von Trapezunt sowie als durchgeknallter Erzähler-Schauspieler John Styx in Barrie Koskys Inszenierung von Orphée aux enfers. Jetzt kommt Barkouf. Ist das Zufall oder Fügung?
Wahrscheinlich beides. Zu Offenbach fühle ich mich generell stark hingezogen. Auch weil das schauspielerische Element bei ihm so wichtig ist. Die Schnittstelle zwischen Musik und Schauspiel – das ist genau der Punkt, wohin auch meine Karriere mich bisher geführt hat. Für Offenbach war die Geschichte seiner Stücke sehr zentral, er komponierte ausgesprochen textorientiert und immer für die jeweiligen theatralen Situationen. Offenbach hat sich in vielen Situationen lieber für die beiden Clowns als für die beiden Tenöre entschieden – damit kann ich natürlich viel anfangen. Mir ist sein Humor sehr nah, genauso aber seine Fähigkeit, tief emotional zu werden, ohne Angst zu haben, zu gefühlig oder zu kitschig zu sein.
Wer war deiner Meinung nach Jacques Offenbach? Was macht seine Persönlichkeit aus?
Offenbach wurde von der Natur, durch Erziehung und Sozialisierung reich beschenkt. Dazu gehört das Jüdische in ihm – der Vater war Kantor –, sein Instrument, das Cello, das bestimmt eine melancholische Seite von ihm förderte, der oft selbstironische jüdische Witz, der sich mit der französischen Mentalität und Lebensweise wunderbar vereinigen liess. Das alles widerspiegelt sich auch in seiner Musik. Und er hatte ein unfassbar gutes Gespür für die Bühne.
Wie würdest du seinen Humor beschreiben?
Es scheint mir ein liebevoller, dem Menschen zugewandter Humor zu sein. Eine Ironie, die nicht im Zynismus endet und sich nie dunkel färbt, aber beissen kann. Spürt man bei Offenbach Zynismus, geht es eher in die Richtung der Satire. Diese «Zugewandtheit» hatte Offenbach auch sich selbst gegenüber. Er hielt durchaus etwas auf sich – aber hatte dabei stets auch ein Augenzwinkern.
Das dem Menschen Zugewandte verbindet ihn ja auch mit Mozart, zumindest hat das Rossini so gesehen, der ihn den «Mozart der Champs-Élysées» nannte... Auch wenn Offenbach garantiert nicht das innere Chaos in sich trug wie Mozart. Aber der Einfallsreichtum ist bei beiden schier unerschöpflich. Die haben auf jede Situation eine Antwort, und zwar immer eine neue.
Karl Kraus sagte einmal über die Offenbach-Operette, sie sei «die Dissonanz der Welt in heiterem Wohllaut».
Grossartig. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dass sich so jemand wie Karl Kraus intensiv mit Offenbach auseinandergesetzt hat, zeigt ja nur allzu deutlich, dass Offenbach nicht irgendein Operettenkönig war. Hätte er Romane geschrieben, wäre er bestimmt ein grossartiger Romancier geworden, der im heiteren Wohlklang die Dinge sehr tief schildert. Bei ihm ist alles dialektisch und doppeldeutig. Nie fühlt sich etwas an wie ein Einfall, sondern vielmehr wie eine Notwendigkeit. Das ist das Schöne: Es ist zwingend. Es steht da, als müsse es so sein.
Was assoziierst du mit dem Namen «Barkouf»? Ich fange mal von hinten an: «kouf» oder «ouf» klingt wie Bellen. «Bar» hat wiederum etwas Orientalisches für mich. Und natürlich englisch «to bark» – Bellen. Aber auch das Französische dringt in Barkouf durch – eine eigenartige Mischung aus Orientalisch und hündisch-Französisch vielleicht und irgendwie genau richtig. Noch nie gehört, aber genau richtig.
Damit ist schon viel über unser Stück erzählt. Barkouf ist der Name des Hundes, der in der indischen Stadt Lahore die Regierungsgeschäfte übernehmen soll. Eingesetzt wurde er vom Grossmogul, der damit sein aufmüpfiges Volk bestrafen will. Kannst du in wenigen Worten sagen, worum es hier geht?
Das ist gar nicht so einfach. «Ein Hund wird als Statthalter eingesetzt» – das wäre zu kurz gegriffen. «Der Mundschenk Bababeck, ein machtgieriger Popanz, will selber an die Macht, indem er den Hund als sein Sprachrohr zu benutzen plant» – auch das ist zu kurz gegriffen. «Maïma, Barkoufs ehemalige Besitzerin, die als ‹Übersetzerin› seiner Befehle eingestellt wird und diese im Sinne des Volkes ummünzt, zettelt so eine Revolution an» – auch das ist zu simpel. Dieses Stück ist so reichhaltig. Ich halte es einerseits für eines der politischsten Werke, die Offenbach je komponiert hat, und andererseits ist es eine durchgeknallte Revue voller Nonsens, die dann wieder Momenten tiefer Emotionalität Raum gibt. Diese Posse ist ein Spiegel, in dem wir unsere eigene Verzerrung lachend geradebiegen können. Dann ist da noch dieses wunderbare Frauenbild, das in diesem Stück gezeichnet wird. Völlig neu und unüblich für die damalige Zeit und noch nie so kraftvoll und eindeutig im Musiktheater erzählt. Louise Michel, eine Ikone der Pariser Commune und Feministin, wird übrigens erst später auftauchen. Offenbach mochte starke Frauen. Maïma, die Hauptfigur, dieses selbstständige Herzenswesen, macht die Welt schöner und besser und ist mutiger als alle anderen. Offenbach und sein Autor Eugène Scribe sind somit Wegbereiter der Emanzipation im Musiktheater der damaligen Zeit. Sie leiten mit Barkouf eine neue Ära ein.
Gibt es für dich eine moralische Botschaft in Barkouf?
Ganz klar: Das Stück hat eine eindeutige Patriarchats- und Herrschaftskritik und die Botschaft, wenn jemand in einer Führungsposition ist, ob Frau, ob Mann, sei es politisch, ökonomisch, als Wirtschaftsboss eines Konzerns oder als Staatsoberhaupt eines Landes – wenn man also für Menschen Verantwortung trägt –, dann geht das nur, wenn sich der- oder diejenige auch mit den Menschen verbunden fühlt. Wenn man weitab ist von der Lebenswirklichkeit der Mitmenschen, auch emotional, kann man nicht herrschen, auch nicht demokratisch.
Und wofür steht der Hund in diesem Stück?
Der Hund Barkouf, der zum Gouverneur ernannt wird, war in der damaligen Zeit des Zweiten Kaiserreichs eine ungeheure Provokation. Die Zensur verbot das Stück mit der Begründung, es sei eine «fortwährende Verspottung jeglicher staatlichen Autorität». Was als launische Bestrafungsmassnahme vom Grossmogul gedacht war, der sein aufmüpfiges Volk mit der Inthronisierung eines Hundes demütigen will, verkehrt sich in sein Gegenteil. Denn der Hund wird vom Volk geliebt. Mehr noch, er wird gefeiert als der beste Herrscher, den das Volk je hatte. Die philosophische Ebene, die das Stück mit dieser Setzung erreicht, mündet in der unausgesprochenen, aber deutlich zu vernehmenden Frage: Wer ist das Tier auf dem «Thron»? Ein Hund, der mit feinem Gespür nur diejenigen an sich heranlässt, die auch ein reines Herz haben, und alle anderen wegbeisst? Oder steht er für die Männer, die willkürlich Angst und Schrecken verbreiten, um ihre Autorität und Macht zu sichern, die sich aufspielen als Herren über Leben und Tod?
Maïma und ihr Geliebter Saëb stehen in diesem Stück für die Liebe, aber auch für die Würde des Menschen ein...
1860, dem Jahr von Barkouf, ist die Französische Revolution schon längst passé und Begriffe wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit im repressiven Zweiten Kaiserreich ein Hohn. Und genau da haut Offenbach im Schulterschluss mit Scribe so eine Geschichte raus. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – diese Begriffe sind im Stück tief verankert.
Angesichts der Weltlage überkommt einen das Schaudern, so aktuell ist Barkouf...
In Barkouf wird Ungeheuerlichkeit durch Satire erzählt, hier hat ein aufgeblasener Fettwanst mit ein paar Soldaten die Macht, dass sich 100 Leute vor ihm niederwerfen. Anstatt dass 100 Leute aufstehen und ihm an die Gurgel springen! Das kennen wir heute immer noch, manchmal genauso offensichtlich oder in ganz subtiler Weise.
Du hast in deiner Inszenierung auf eine Aktualisierung verzichtet.
Mit Absicht. Das Stück ist aktuell genug. Es ist genial theatralisch-intelligent komponiert und äusserst klug in der Art und Form der Erzählung. Ich würde gegen dieses Werk gehen, wenn ich versuchen würde, eine banale Aktualisierung hineinzubringen – im Kostüm, im Bühnenbild –, denn es ist bereits alles geschrieben. Meine Aufgabe ist es, dem Stück den gebührenden Raum zu geben, einen Theaterraum, denn diese Opéra-bouffe ist pralles, pures Theater und entwickelt ihre Kraft und Aktualität durch Theaterspielen. Das Jetzt-Zeit-Momentum sind die Künstlerinnen und Künstler, die das Stück aufführen, und der Erzähler, der uns als Publikum mit der Geschichte verbindet. Es braucht nichts mehr als das Theater selbst, denn das Theater ist ein Ort des Weiterdenkens, auch der moralischen Instanz. Jede Möglichkeit sollte genutzt werden, um uns daran zu erinnern, was Menschsein bedeuten kann.
Trotzdem ist dir das Entertainment wichtig. Auch Offenbach musste mit seinen Stücken seine Kassen füllen.
Sicher. Lachen ist wichtig. Lachen ist Befreiung. Lachen ist Erkenntnis. Humor ist ja ein weitgespannter Begriff, da gibt es viele Geschmäcker. Aber klar ist: Die Unterhaltung und der Witz haben bei Offenbach immer mit Intelligenz zu tun. Karl Kraus hat dazu sehr schön gesagt: Offenbachs Operetten sind ein Gesamtkunstwerk, welches eine Welt als gegeben nimmt, in der sich der Unsinn von selbst versteht.
Kannst du ein Beispiel für diesen intelligenten Humor in Barkouf geben?
Nehmen wir das Auftrittslied von Bababeck, dem grossmäuligen Mundschenk des Grossmoguls. In diesem Couplet singt er davon, sich wieder wie 20 zu fühlen und seinen zweiten Frühling zu erleben. Und dann hört man eine Melodie, die klingt, als ob ein kleines Mädchen mit überschäumendem Gefühl über eine Blumenwiese hüpfen würde! Bababecks Melodie ist also bereits ironisiert. Man hätte so etwas viel plumper komponieren können, damit man auch ja kapiert, ah, das ist ein blöder Typ, der glaubt, er könne jetzt mal bei den Frauen so richtig loslegen. Nein: Bababecks Melodie ist mitreissend, man lacht über ihn, erkennt, wer er ist und wird gleichzeitig bestens unterhalten.
Du hast die gesprochenen Texte selber verfasst und vertraust sie einem Erzähler an. Welcher Gedanke steckt dahinter?
Abgesehen davon, dass wir ein internationales Ensemble haben, das weder Französisch noch Deutsch als Muttersprache spricht, ist meine Erfahrung mit dem Genre Operette, dass die Dialoge immer mit einem bestimmten Tempo gesprochen werden müssen. Rasche Haltungswechsel einer Figur sind schon für Schauspielerinnen und Schauspieler eine Herausforderung. Man muss da sehr souverän über dem Text stehen. Der von Barkouf überlieferte, gesprochene Originaltext ist sehr lang, mitunter langatmig. Witze, die damals funktionierten, funktionieren heute nicht mehr so ohne Weiteres. Was würde wohl so ein genialer Autor wie Eugène Scribe machen, wenn er Barkouf heute erzählen würde? Was wären seine Mittel? Ich habe versucht, einen Text zu schreiben, der unterhält, die Geschichte transportiert und immer wieder durch neue Spielarten der Sprachbehandlung überrascht.
Dein Erzähler ist der Schauspieler André Jung. Warum ist er der Richtige dafür?
Ich kenne André nun schon seit mehr als 25 Jahren. Als ich über einen Erzähler für Barkouf nachdachte, ist er mir sofort als Idealbesetzung in den Sinn gekommen. Er ist ein Mensch mit Wärme und Witz, und er ist in der Lage, mit Sprache so umzugehen, dass man nie den Eindruck hat, er wäre ein besserwissender Schauspieler.
Seit der Uraufführung wurde das Stück erst einmal wieder gezeigt, in Strasbourg und als Übernahme in Köln. Kaum jemand kennt dieses Werk. Wie fühlt sich das an? Hat es einen Einfluss auf die Art deiner Inszenierung?
Es ist ja eine schöne Parallelität, dass man mich als Regisseur auch nicht kennt. Ich finde es jedenfalls ganz gut, mich mit einem unbekannten Stück in Zürich vorzustellen. Natürlich hat man es in solchen Fällen immer etwas einfacher, da es keine Erwartungshaltung im Publikum gibt, ausser die, dass es bitteschön gut sein soll, was da auf der Bühne zu hören und zu sehen ist. Bei einem Stück, das die Leute schon 30 Mal gesehen haben, ist das etwas anderes und mitunter schwieriger, dann wird das Publikum zum vermeintlichen «Fachpublikum». Ich habe grosse Demut vor Offenbach und versuche, Barkouf zum Blühen zu bringen, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende sagen: Warum nur war dieses fantastische Stück 160 Jahre lang verschollen?
Barkouf spielt bei dir ganz original im indischen – damals pakistanischen – Lahore.
Natürlich habe ich mich gemeinsam mit meiner Bühnenbildnerin Marie Caroline Rössle intensiv darüber ausgetauscht, in welcher Welt wir dieses Werk spielen lassen wollen. Und wir waren uns sehr schnell darüber einig, dass wir zwar eine orientalisch angehauchte, aber dennoch eine unbeschriebene Welt, eine Fantasiewelt, eine theatrale Welt brauchen, die uns interpretatorisch nicht einengt – denn man soll nicht sagen können, ah: das kenne ich! Barkouf bewegt sich zwischen einer abgedrehten musikalischen Revue und einem Brechtschen Lehrstück. Caroline und mir ist da die expressionistische, übertriebene Welt aus den 1910/20er-Jahren eingefallen. Wir haben gemerkt, dass es uns Spass macht, das, was im Stück auf satirische Weise verhandelt wird, auch in eine verzerrte Andeutung einer Stadt hineinzukneten. Eine Stadt, die monumental ist und gleichzeitig architektonisch den Anschein erweckt, als würde sie gleich zusammenbrechen – ein System, das kurz vor dem Kollaps steht. Wo alles schräg und schief ist. Auch die fantastischen Kostüme von Ursula Kudrna gehen in diese Überzeichnung. Unsere Inszenierung wird ein Blumenstrauss voll unterschiedlichster Farben und Formen, eine dicke, fette Sahnetorte, aus der man die Finger nicht mehr herausnehmen will.
Das Gespräch führte Kathrin Brunner
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 96, Oktober 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Drei Fragen an Andreas Homoki

Herr Homoki, unsere nächste Premiere ist die französische Operette Barkouf von Jacques Offenbach, das Werk eines sehr bekannten Komponisten, das niemand kennt. Wie ist das möglich?
Das ist eine echte Stückausgrabung, wie sie es heute nur noch selten gibt. Die Operette wurde zu Lebzeiten Offenbachs uraufgeführt, von der Zensur verboten und verschwand 160 Jahre in einem Notenschrank der Offenbach-Erben, bevor sie ein Musikwissenschaftler dort wieder hervorgezogen hat. Das Stück ist vor vier Jahren in Strassburg zum ersten Mal wieder gespielt worden. Wir haben uns das angeschaut, fanden es grossartig und bringen es nun als Schweizerische Erstaufführung und – wenn man die Uraufführung hinzunimmt – als dritte szenische Produktion überhaupt auf die Bühne. Unglaublich daran ist, dass das Stück nicht irgendein Nebenwerk ist, sondern beste französische Operette von einem Blockbuster-Komponisten, der unschlagbar gut war in seinem Metier. Wir präsentieren hier grossen Offenbach mit toller Musik, Chor, Witz, politischem Biss und allem Drum und Dran.
Der Regisseur ist der Deutsche Max Hopp, den man vor allem als Theaterund Filmschauspieler kennt. Wie kam es zu dieser Regiebesetzung?
Ich kenne Max aus meiner Zeit als Intendant der Komischen Oper in Berlin. Er hat eine grosse Affinität zum Musiktheater. Er kam als Schauspieler von der Berliner Volksbühne und war bei uns an der Komischen Oper der Zahlkellner Leopold in Sebastian Baumgartens Inszenierung des Weissen Rössl von Ralph Benatzky. In meiner Produktion von My Fair Lady hat er dann den Professor Higgins gespielt. Irgendwann habe ich mitbekommen, dass er auch inszeniert – und zwar Musiktheater! Ich habe mir Sachen von ihm angeschaut, fand die aussergewöhnlich gut – und so ist die Idee entstanden, ihm diesen Offenbach anzuvertrauen. Max liebt das leichte Genre, beherrscht sein theatralisches Handwerk, hat viel Gespür für die szenische Umsetzung von Musik und ausserdem Humor und Eigensinn. Er ist ein Theatertier durch und durch. Als er uns sein Konzept vor einem Jahr präsentierte, hatte er die Inszenierung schon komplett im Kopf.
In den nächsten Wochen gibt es im Opernbereich noch eine weitere Premiere: Wir spielen die Familienoper Alice im Wunderland.
Genau. Endlich kommt sie raus! Die Produktion war ein Opfer der Pandemie. Alles war gebaut und fertig inszeniert, als wir im November 2020 zehn Tage vor der Premiere die Arbeit wegen Corona abbrechen mussten. Die Künstlerinnen und Künstler sind ohne eine einzige Vorstellung zu spielen auseinandergegangen. Das war furchtbar. Umso glücklicher sind wir, unsere Alice nun zeigen zu können. Es ist ja ein Stück, das wir – gemeinsam mit dem Hongkong Arts Festival – bei dem Komponisten Pierangelo Valtinoni in Auftrag gegeben haben; er hat uns vor sechs Jahren einen tollen Erfolg mit Der Zauberer von Oz beschert. Das war bisher eine der schönsten und beliebtesten Produktionen in unserer inzwischen langen Serie an Familienopern. Der Alice-Stoff nach dem Buch von Lewis Carroll führt in eine surreale Theaterwelt voll von fantastischen Figuren und farbiger Musik. Das ist sehr attraktiv für die grosse Bühne, auf der wir unsere Familienopern ja immer mit dem vollen Theaterzauber präsentieren. Ich freue mich auch persönlich auf Alice im Wunderland, weil ich damals selbst mit Corona in Quarantäne sass und deshalb nicht viel von den Proben mitbekommen habe.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 96, Oktober 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Volker Hagedorn trifft...

Jérémie Rhorer
Mit Jacques Offenbachs «Barkouf» debütierte Jérémie Rhorer 2022 am Opernhaus Zürich. Er dirigierte an Opernhäusern wie der Wiener Staatsoper, der Bayerischen Staatsoper in München, La Monnaie in Brüssel und dem Teatro Real in Madrid. Er ist ausserdem Gründer und Musikdirektor des auf historischen Instrumenten spielenden Orchesters Le Cercle de l’Harmonie, mit dem er u.a. am Théâtre des Champs-Élysées einen Mozart-Zyklus mit «La clemenza di Tito», «Die Entführung aus dem Serail», «Don Giovanni» und «Le nozze di Figaro» aufführte.
Es regnet heftig. Kein Tag, an dem man beschwingt zur Arbeit geht. Genau der richtige Tag für Jacques Offenbach, um seine funkelnde Energie zu entfalten, 142 Jahre nach seinem Ableben in Paris. Man spielt sich erstmal ein im grossen Orchesterprobensaal am Kreuzplatz, Dienstbeginn gegen 10 Uhr vormittags, hinten plaudern die Solisten, es ist ihre erste Probe für Barkouf zusammen mit dem Orchester. Dann nimmt auf seinem Schemel vor den Musikern Jérémie Rhorer Platz, 49 Jahre alt, nicht gross, beiges Jackett, sparsame Gesten. Er gibt den Einsatz zur ersten Nummer, und plötzlich wandelt sich die Atmosphäre. Diese Rhythmen, diese Schnitte und Farben, diese kleinen Verrücktheiten! Eine unverregnete Heiterkeit breitet sich aus. Ab und zu eine Unterbrechung, eine Korrektur: Betonungen werden verschoben, die Silben im Tenor brauchen mehr staccato. Um die ersten Geigen leiser zu haben, genügt eine kurze Armbewegung links. Klarheit entsteht und noch mehr von dieser Heiterkeit, die nicht banal ist, sondern voller Leben. Die Sänger werden übermütiger, immer mehr von den Gesten, den Charakteren, die sie mit Klavier und Regie erprobt haben, brechen aus. Man könnte meinen, Offenbach irgendwo amüsiert lächeln zu sehen, vielleicht auch noch nachdenken: Ist das gut, Fagott zum Pizzicato? Ja, sogar sehr gut. Der Zuhörer am Saalrand verspürt erste Suchtsymptome. Bitte noch eine Nummer, noch ein Duo, Trio, Quintett
Damals bei der Uraufführung in Paris war nach sieben Vorstellungen Schluss, Anfang Januar 1861. «Schwer zu verstehen, warum», sagt Jérémie Rhorer, als wir nach der Probe durch etwas weniger Regen zu Starbucks hinübergehen, «auch wenn Barkouf durch die Kritik von Hector Berlioz wirklich zerstört wurde.» Er schwärmt von den Farben, der grossen Palette, mit der Offenbach zwei verschiedene Welten deutlich mache, den machiavellistischen Zynismus der Politiker, «von der Groteske switcht er zum Tieferen, zum sanften Charakter etwa von Maïma. Er hat dieses Talent, wie Bizet und später Bernstein und viele Jazzmusiker, direkt zum Ohr zu kommen.» Und das besondere Talent zur Komik solle man nicht unterschätzen. «Es ist eines der kostbarsten Talente, die Freude auszudrücken. Das Leben, das Lachen. Für eine Ideologie ist Lachen das gefährlichste.»
Er erwähnt Umberto Ecos Der Name der Rose. Das verbotene Buch in diesem Roman, das vom finsteren Bibliothekar vergiftet wird und durch dessen Lektüre dann die Mönche sterben, ist das Buch von Aristoteles, in dem die Komödie behandelt wird, er tritt für Freude und Lachen ein. «Auch Mozart und Haydn konnten das Komische sehr gut», meint Rhorer, «aber man muss sich bei Offenbach hüten, es überzuinterpretieren. Humor braucht subtile Balance. Zuviel ist nicht mehr komisch. Der Dirigent muss auch die Eleganz des Komponierten garantieren, auf Artikulation und Präzision bestehen.» Das alles sagt er nachdenklich, bedachtsam seine Worte auf Englisch wählend. Er ist selbst ein Komponist, den um so mehr das Handwerkliche interessiert, die Mittel, die eingesetzt werden. «Je tiefer ich in das Stück einstieg, desto mehr war ich vom Handwerk beeindruckt. Offenbach weiss, was er tut. Es klingt fruchtig, spirituoso, es ist schmackhaft. Es gibt keine schwachen Stellen.»
Berlioz, meint er, habe sich vielleicht gerade an Offenbachs Souveränität im Umgang mit der Harmonik gestört, den er als laienhaft abtat. «Berlioz selbst hatte, ehrlich gesagt, für Harmonik kein offensichtliches Talent. Ich glaube, er wusste selbst, dass es eine seiner Schwächen war. Aber er hat mit seiner Kritik Offenbach fast ein bisschen aus der Gesellschaft gestossen, und leider wusste er, was er tat. Dieses Machtausüben zwischen Musikern ist in Frankreich eine Konstante, von Lully, der Kollegen bekämpfte, bis zu Pierre Boulez.» Den Einfluss des grossen Serialisten hat Rhorer noch im Conservatoire der 1990er bemerkt, als er Komposition studierte. «Ich wollte über Tschaikowski, Puccini, Prokofjew sprechen, die wurden nicht in Erwägung gezogen. Und die Tendenzen in der zeitgenössischen Musik fand ich deprimierend, ideologisch.» Mir fällt dazu Steve Reich ein, der sich im New York der 1960er vor die Alternative gestellt sah, entweder so zu komponieren wie Boulez oder wie Cage, wenn er nicht ausgelacht werden wollte, und seinen eigenen Weg fand. «Erstaunlich, dass Sie das sagen! Tatsächlich hat mich Reich gerettet, seine Musik öffnete eine Welt. Aus irgendeinem Grund war er trotz der Neotonalität am Konservatorium akzeptiert, ich durfte mich in der Analyse mit ihm beschäftigen.» Boulez aber bleibt für Jérémie Rhorer «eine dunkle Figur», geradezu der Gegenpol zum zutiefst bewunderten Leonard Bernstein. Ein Filmmitschnitt von Mahlers Dritter wurde ihm zur Offenbarung. «Er lässt sie neu entstehen. Bei ihm ist jeder willkommen zur Feier der Menschlichkeit!»
Für das Anti-Elitäre hat der zurückhaltende Rhorer vielleicht um so mehr Sinn, als er keineswegs auf den lichten Höhen des Bildungsbürgertums zur Welt kam. Der Grundschüler im Pariser Vorort Ivry-sur-Seine wollte Tennisspieler werden, «aber alle Kursplätze an dem Mittwochnachmittag, der es sein musste, waren belegt.» Also schickte ihn seine Mutter in die Musikschule, wo er sich die Flöte aussuchte. Aber der Unterricht war von zweifelhafter Qualität, er wollte da weg. Eine Anzeige wies den Weg: Bei der Maîtrise de Radio France, dem Kinderchor des Rundfunks, konnte man sich bewerben. Jérémie sang vor und wurde angenommen. Dann kam der Tag, als Colin Davis den Chor dirigierte.
«Ich sah ihm zu, und das war’s. Wie er mit seinen Gesten die Musik erhob, den Klang modellierte… Die Schönheit des Ausdrucks war so offensichtlich. Da war ich zehn.» Von dem Tag an wollte Jérémie ein Dirigent werden. «Aber haben Sie nicht als Cembalist begonnen?» «Das war ein Weg, um da hinzukommen. In Paris gab es einen Dirigenten, Emil Tchakarov, der sagte mir, dirigieren kannst du nicht lernen. Er hatte es in Bulgarien gelernt, indem er grosses Repertoire für fünfzehn Musiker transkribierte, die er dann dirigierte. Er sagte, bau dir dein eigenes Orchester. Ich sammelte zuerst sechs Musiker, um Mozarts Adagio und Fuge zu dirigieren, da war ich sechzehn.» Mit 21 Jahren, mittlerweile studierter Cembalist und Komponist, gründete er mit dem Geiger Julien Chauvin das Orchester Le Cercle d’Harmonie, auf historischen Instrumenten spielend, dann ging es steil aufwärts. Die dritte CD nahmen sie schon mit Diana Damrau auf, mit Rhorer am Pult. 2011 debütierte das Ensemble im Londoner Barbican Centre, 2016 bei den Proms. Am Pariser Théâtre des Champs-Élysées produzierten sie die grossen Opern von Mozart. Dessen Don Giovanni dirigierte Rhorer 2017 auch beim Festival in Aix-en-Provence – elektrisierender, klarer hat man die Ouvertüre noch nicht gehört.
Dass er als Gastdirigent von Salzburg bis Edinburgh, von der Wiener Staatsoper bis zur Brüsseler La Monnaie unterwegs ist, bei Gewandhausorchester und Tschechischer Philharmonie, wird man von Rhorer selbst nicht erfahren, ohne nachzufragen. Eher schon, warum Verdi auf dem Stimmton A=432 Hertz bestand. Warum Poulenc depressiv wurde, als er sich mit Zwölftonmusik befasste. Wie unglaublich Tschaikowskis Meisterschaft in der Harmonik ist. Und wie eng es im Orchestergraben der Opéra-Comique zuging, als dort Barkouf uraufgeführt wurde. Keine gewerkschaftlich festgelegten Mindestabstände, «es war gestopft voll! Ein Aspekt, den man im Kopf haben sollte.» Und war es nicht so, vorhin bei der Probe, dass die Musiker auf dem riesigen Podium an der Kreuzstrasse einander näher zu kommen schienen, obwohl sich kein Stuhl bewegte? Ein bisschen Magie ist wohl auch dabei. Wir stehen auf, es regnet draussen nicht mehr, und der Dirigent lächelt. Nicht wegen Jacques Offenbach, sondern weil sein einjähriger Sohn und dessen Mutter ein paar Strassen weiter auf ihn warten. «Wir müssen noch zu Migros, einkaufen…»
Das Gespräch führte Volker Hagedorn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 96, Oktober 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Fragebogen

Brenda Rae
Die amerikanische Sopranistin Brenda Rae war in Zürich bereits als Adèle in «Le Comte Ory» zu hören; nun singt sie die Maïma in Offenbachs «Barkouf». Brenda Rae ist regelmässig an Häusern wie dem Royal Opera House, Covent Garden, der Met in New York oder der Bayerischen Staatsoper zu Gast.
Aus welcher Welt kommen Sie gerade?
Aus der Welt der Zauberflöte bei den Salzburger Festspielen. Ich freue mich, dass ich mich jetzt in die Maïma in Barkouf vertiefen kann, denn obwohl die Königin der Nacht eine sehr aufregende Rolle ist, hat man damit nicht viele Möglichkeiten, eine Figur zu entwickeln, und das ist etwas, das mir in diesem Job grossen Spass macht.
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Ich werde meinen Lehrern in Wisconsin ewig dankbar sein dafür, dass sie mir eine Szene aus Bellinis La sonnambula zugeteilt haben. Ich studierte Musik, hatte mich aber noch nicht für die Oper entschieden; als ich den Belcanto kennenlernte, habe ich mich Hals über Kopf in die Oper verliebt. Die Melodien, die Kreativität, die man für die immer neuen Verzierungen braucht, die Herausforderung, die Koloraturen mit Bedeutung zu füllen... all das hat dazu geführt, dass ich mein Leben der Oper gewidmet habe.
Welche CD hören Sie immer wieder?
Ich höre eigentlich ständig Musik, und ich liebe es, neue Musik zu entdecken. Je nach Stimmung höre ich Indie, House, traditionelle irische Musik oder Klaviermusik von Debussy, und obwohl ich keine Wagner-Kennerin bin, liebe ich das Rheingold-Vorspiel.
Was bringt Sie zum Lachen?
Dafür braucht es nicht viel, denn ich lache sehr gern. Ich bin «nah am Wasser gebaut», eine meiner Lieblingsphrasen auf Deutsch. Ich fühle sehr tief, sowohl Freude als auch Schmerz. Neulich musste ich laut lachen, weil mich die Schönheit der Berge, die Zürich umgeben, so berührt hat.
Welche Persönlichkeit würden Sie gerne einen Tag lang sein und warum?
Ich wollte noch nie jemand anders sein als ich selbst. Wenn ich jemanden auswählen müsste, dann wäre es eine Persönlichkeit, die vollkommen anders ist als ich selbst; von dieser Erfahrung könnte ich sicher etwas lernen.
In welche Zeitepoche würden Sie gerne reisen?
Ich fände es schwierig, in einer Zeit zu leben, in der ich nicht das Recht habe zu wählen, aber trotzdem wäre es faszinierend, Kunst und Kultur im Paris der 20er-Jahre zu erleben.
Welches künstlerische Projekt in der Zukunft, das Ihnen viel bedeutet, bereiten Sie gerade vor?
Ich freue mich sehr darauf, die Ophélie in Ambroise Thomas’ Hamlet an der Pariser Oper zu singen, nicht nur, weil es wunderschöne Musik ist, sondern auch, weil es das erste Mal ist, dass ich dieselbe Figur in zwei verschiedenen Opern singe. Ophelia habe ich in Brett Deans zeitgenössischer Version von Hamlet bereits an der Met gesungen, und ich werde es sehr geniessen, mit einer vollkommen anderen Musik noch tiefer in diese Figur einzudringen.
Wie wird die Welt in 100 Jahren aussehen?
Ich bin ein optimistischer Mensch, und ich möchte gern daran glauben, dass technologische Fortschritte uns helfen werden, den Klimawandel wirksam zu bekämpfen. Ich glaube an den Fortschritt und daran, dass man für das Gute in der Welt kämpfen muss. Ausserdem glaube ich an die Kraft von Live-Musik, und ich bin guter Hoffnung, dass die Oper weiterleben wird!
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 96, Oktober 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Fotogalerie
Ich sage es mal so
Stumme Antworten auf grundsätzliche Fragen – mit Marcel Beekman, der den Bababeck in Jacques Offenbachs Operette «Barkouf» gibtIch sage es mal so ist eine neue Interviewform in unserem MAG, in der Künstlerinnen und Künstler des Opernhauses - nach einer Idee des SZ-Magazins - in Form eines Fotoshootings Auskunft über sich geben
Hintergrund
Ein Hund wird Herrscher
Diese alberne Handlungspointe hat Jacques Offenbach sich für seine Operette «Barkouf» ausgedacht – als Verhöhnung der politischen Verhältnisse seiner Zeit. Warum und wie sein Meisterwerk nach der Pariser Uraufführung spurlos in einem Schrank verschwand und erst 158 Jahre später wieder den Weg auf die Bühnen findet, rekonstruiert Volker Hagedorn in seiner Spurensuche
Jacques Offenbachs gewagteste Oper verschwand nach sieben Aufführungen fast spurlos. Jetzt ist die Zeit für Barkouf gekommen, ein Meisterwerk aus dem Paris des Jahres 1860, das die Operngeschichte hätte verändern können.
In manchen fantastischen Geschichten gibt es diese grossen alten Schränke, die in eine andere Welt führen, eine andere Zeit. Aber nicht nur da. So ein Schrank stand auch in der Rue Jeanne d’Arc in Saint Mandé, östlich von Paris gelegen, als Jean-Christophe Keck erstmals das Haus betreten durfte – das Haus der Lieblingstochter von Jacques Offenbach, Jacqueline, und ihrer Nachfahrin. 20 Jahre lang hatte er immer wieder vergeblich angeklopft. Keck ist Elsässer, er wirkt so gemütlich, wie er beharrlich ist. Dieser Forscher ahnte, dass hier Schätze lagen, Handschriften eines der genialsten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Im Januar 2014 klappte es. Keck betrat ein Haus, in dem sich seit 150 Jahren nichts geändert zu haben schien. Und da war dieser Schrank. Statt einer Hintertür ins Reich der Fantasie enthielt er, in ochsenblutfarbene Regale gezwängt, 20.000 Manuskriptseiten. Darunter einen Fund, eine Partitur von 1860, die Geschichte hätte machen können, wäre diese Oper nicht nach sieben Aufführungen an der Pariser Opéra-Comique abgesetzt worden. Barkouf, ein Hund als Regent, die schärfste musikalische Politsatire des 19. Jahrhunderts. Diesen Hund hatte der frustrierte Komponist so gründlich begraben, dass nur ein Besessener wie Keck die Noten finden konnte. Mittlerweile ist klar, dass es sich um ein Meisterwerk handelt, und dass Offenbach nicht nur den Sprung zur grossen Oper wollte, sondern das Genre gleich erneuern. Experimenteller war er nie.
Aber wie kam es dazu? Wie kam Barkouf zustande, warum ging das Werk unter und verschwand für 158 Jahre aus der Welt, bis 2018 in Strasbourg die erste Neuaufführung stattfand, der nun eine zweite in Zürich folgt? Was war los im Paris des Jahres 1860? Offenbachs eigenes Theater, die «Bouffes-Parisiens», waren bereits eine Institution, nicht wegzudenken, nicht einmal von Baron Haussmann, der in Paris den grössten Stadtumbau aller Zeiten durchzog. Mit diesem Theater unfern der Seine war Jacques Offenbach berühmt geworden, seit er es 1855 gründete. Aber seine Träume, seine Visionen gingen nicht erst 1860, dem Jahr von Barkouf, über das Milieu unterhaltsamer Komik hinaus.
Die grosse Bühne, den Repräsentationsort des Bürgertums, hat er schon bald kennengelernt, nachdem er 1833 mit Vater und Bruder aus Köln nach Paris zog, in die Hauptstadt einer Nation, in der Juden nicht als Menschen zweiter Klasse behandelt wurden, ins Zentrum der europäischen Musikwelt. Schon mit fünfzehn Jahren sitzt der flammend Begabte als Cellist im Orchester der Opéra-Comique in der Salle Favart, spielt Werke von Boieldieu, Auber, Mozart, Rossini und nimmt Unterricht beim Opernkomponisten Fromental Halévy. Und diese Institution behält Offenbach im Sinn, während er als Cellist in Salons und als Komponist mit Tanzmusik reüssiert. Das bleibt auch so nach dem beispiellosen Erfolg seines Orphée aux enfers, der nach der Uraufführung 1858 227 Mal in Folge gespielt wird. Als Genie doppelbödiger Buffonerie ist der 41-Jährige eine Grösse auch über Paris hinaus, als sich im Sommer 1860 der frisch installierte Intendant der Opéra-Comique an ihn wendet. Eine Oper von vier Akten wird gewünscht, der Entwurf eines Librettos liegt vor. Endlich!
Das renommierte Haus, zu der Zeit mit umgerechnet jährlich rund zwei Millionen Euro subventioniert, hat in den 1850ern etwas sein Profil verloren, die Leichtigkeit und Heiterkeit der Sujets. Sogar Giacomo Meyerbeers Étoile du Nord ist dort gespielt worden, eine Grand opéra, mit ein paar gesprochenen Dialogen als Opéracomique maskiert. Der viel gelesene New Paris Guide der Brüder Galignani stellt in der Ausgabe von 1860 fest, man folge an der Opéra-Comique inzwischen «einem elaborierteren, vielleicht auch gelehrten Stil, aber weniger populär». Gut möglich, dass Intendant Alfred Beaumont da in seiner ersten Spielzeit gegensteuern will mit einem wie Offenbach. Auf bewährter Basis freilich: Librettist Eugène Scribe, jetzt 68 Jahre alt, schrieb nicht nur für die Blockbuster von Meyerbeer, von Robert le diable bis zu Le prophète, dazu fast alle Opern von Auber – er beherrscht jedes Genre und eine ganze Textfabrik.
Nach Scribes Plan hat ein junger Autor Le Sultan Barkouf geschrieben, eigentlich für den Komponisten Clapisson und für das innovative Théâtre-Lyrique. Weil dort nichts daraus wird, bekommt Offenbach den kuriosen Text, halb Drama, halb Politsatire. Barkouf heisst der Hund, den ein Willkürherrscher als Gouverneur einsetzen lässt. Damit sollen die aufsässigen Bewohner einer Stadt gedemütigt werden, die exotisch Lahore heisst, aber dem Paris des Zweiten Kaiserreichs kaum ferner ist als Offenbachs Orphée. Der neue Statthalter ist naturgemäss sehr bissig, bis seine frühere Herrin auftaucht, die Marktfrau Maïma. Ihr frisst er aus der Hand, sie wird zur Dolmetscherin ernannt und interpretiert Barkoufs Gebell im Sinne der Opposition. Die Steuern werden gesenkt, Todesurteile kassiert. Am Ende ist zwar der Hund in einer Schlacht gefallen, doch der Mogul muss die neuen Verhältnisse legitimieren.
Das ist nicht unbedingt ein staatsgefährdender Stoff neben Orphée, wo Göttervater Jupiter sich anhören muss, sein Regime sei stumpfsinnig, und nur der «Öffentlichen Meinung» wegen den «schönen Schein» wahrt. Indessen sind solche Stacheln längst zur pikanten Würze eines Kassenschlagers geworden. Kaiser Napoléon III. und Kaiserin Eugénie besuchen im April 1860 höchstpersönlich eine Sondervorstellung im Théâtre-Italien. Dass die politische Wetterlage sich unterdessen wandelt, merkt Offenbach erst später.
Zuerst trifft er bei der Arbeit am Barkouf auf Probleme, die im Theater Alltag sind. Es gibt eine Starsopranistin, Delphine Ugalde, die der Rolle der Maïma nicht ganz gewachsen ist, und so bittet er Scribes Mitarbeiter, einer weiteren Frauenrolle mehr Gewicht zu verleihen, der Apfelsinenverkäuferin Balkis. Scribe tobt, als er von den Änderungen erfährt. «Das hat keine Einheit mehr, keine Linie. Das sind Szenen, das ist kein dramatisches Werk mehr!» Vielleicht spürt er auch, dass Zeiten in der Kunst anbrechen, die nicht mehr seine sind. Um den Spannungsbogen zu retten, arbeitet er selbst die letzten beiden Akte zu einem um. Dass er, Kommandeur der Ehrenlegion, Ärger mit der Zensur bekommen könnte – damit rechnet er wohl nicht. Im selben Sommer ist das Abenteuer ausser Kontrolle geraten, auf das sich Napoléon III. im Vorjahr eingelassen hat, mit 170.000 Soldaten zur Befreiung des Piemont von österreichischer Herrschaft. Inzwischen will ganz Italien die Einigkeit. Am 10. Mai ist der Revolutionär Garibaldi mit tausend Rothemden in Marsala gelandet, am 20. Juli ist ganz Sizilien in seiner Hand, Anfang August auch Neapel, womit das «Königreich beider Sizilien» endet. Nun sieht sich der römische Kirchenstaat bedroht, dem auch Napoléon III. verpflichtet ist. Der 52 Jahre alte Franzosenkaiser, mit einem einigen Italien sympathisierend, agiert halbherzig, als «schwacher Cäsar», der allzu viele Parteien bei Laune halten will. Die Unterstützung der französischen Katholiken bröckelt.
Dieser Regierungschef, der von allem etwas ist, Kapitalist und Sozialist, Katholik und Aufklärer, Liberaler und Autoritärer, gerät von allen Seiten unter Druck. Er reagiert durch vorsichtiges Entgegenkommen. Ein Dekret wird vorbereitet, das dem Corps législatif, bis dahin die Karikatur eines Parlaments, mehr Spielraum verschaffen soll. Umso energischer agiert er in Ostasien, wo sich Frankreich im «Zweiten Opiumkrieg» einer britischen Militäroperation gegen China anschliesst. Anfang Oktober 1860 fällt die vereinte Streitmacht in Peking ein. Bei einer beispiellosen Plünderung werden 3000 Chinesen umgebracht, der kaiserliche Sommerpalast wird niedergebrannt. Während das geschieht, brüten in Paris die Zensoren des Staatsministers über solchen Zeilen einer Bühnenfigur: «Kriecht alle vor mir! So ist’s gut! (...) Ich werde einige Tage in den Königreichen von Kaschmir und Kandahar gebraucht… zwei aufständische Städte, die ich einnehmen und niederbrennen werde… es dauert nicht lange. Ich komme zurück, und wehe dem, der die Autorität des neuen Vizekönigs [der Hund Barkouf] nicht geachtet hat!» Vielleicht motiviert auch die heikle politische Lage mit gewachsenen Empfindlichkeiten den Komponisten, nicht einfach nur komisch zu sein. Er schreibt eine erstaunliche Mischung aus Witz und Melancholie, von traurigem Lächeln springt er zu wahnwitzigem Übermut. Beiläufig wirft er chromatische Modulationen hin, in denen ein Tristan-Akkord nicht auffiele, zugleich Melodien, die man immer wieder hören möchte. Diese Couplets, Duos, Ensembles, Chöre sind subtiler komponiert, enger aufeinander bezogen als in Orphée. Offenbach liefert auch Randbemerkungen wie die der Goncourts, knapp und genau, Blicke auf die Strasse. Seine Doppelbödigkeit hat Risse, in denen Zukunft blitzt.
Aber die Zensoren haben den Text zu beurteilen, nicht die Musik. «Die Autoren (…) haben ohne Zweifel geglaubt, von den Bedenklichkeiten dieses bizarren Sujets und den Anspielungen, von denen es wimmelt, durch die possenhafte Form des Werks und die Verlegung des Schauplatzes nach Indien, das Land der Fabeln und der Fantasie, abzulenken. Der Milderungen bewusst, die aus diesen Umständen resultieren können, kommen wir jedoch nicht umhin, im Hintergrund des Stücks, den ihm innewohnenden Details und deren unvermeidbarer Umsetzung auf der Bühne die fortwährende Verspottung aller staatlichen Autorität in jeglicher Zeit, in jeglichem Land zu erkennen…» Dieses Schreiben vom 10. Oktober 1860 enthält zugleich ein Aufführungsverbot.
Freilich haben da die Proben schon begonnen. Und sie werden auch nicht gestoppt, stattdessen legt man eine entschärfte Fassung vor. Die kosmetischen Eingriffe ändern nichts Wesentliches – der Hund wird vom «Vizekönig» zum «Gouverneur» degradiert, die ganze Oper von der «comique» zur «bouffe». Vom Zensorentrio wird das am 28. November so merklich zähneknirschend durchgewinkt, dass man eine Weisung von ganz oben spürt. Wohl kaum vom Minister, sondern vom Halbbruder des Kaisers, dem Präsidenten des Parlaments. Nur einer wie der Herzog von Morny, Bewunderer Offenbachs und unter Pseudonym auch dessen Librettist, konnte eine so verfahrene Lage retten.
Während man die Uraufführung, zuerst für den 26. November annonciert, weiter und weiter nach hinten schiebt, stellt sich heraus, dass Delphine Ugalde wegen einer Schwangerschaft nicht wird singen können. Am 11. November wird eine neue Maïma bekanntgemacht, drei Wochen später zieht sie sich wegen einer Halsentzündung zurück – oder der Sorge, es könne mit Barkouf Ärger geben. Jacques Offenbach kann sich derweil damit trösten, dass er mit einem Ballett den Sprung ins grösste Opernhaus der Stadt geschafft hat, die Salle Peletier, zur Zeit Académie Impériale de Musique, 1800 Plätze. Hier wird am 26. November Papillon uraufgeführt, ein Ballett in zwei Akten, glänzend besetzt und besucht.
Im selben Haus plagt man sich schon seit Ende September mit Proben zur Oper eines Deutschen, deren Produktion Napoléon III. selbst angeordnet hat – Tannhäuser von Richard Wagner, der sich in Paris inzwischen weitgehend unbeliebt gemacht hat. Dass sogar Wagner noch zum Problem für Barkouf werden könnte, hätte Offenbach sich nicht träumen lassen. Zunächst mal bringt sein Ballett auch den Antisemitismus zum Vorschein, mit dem sich schon Meyerbeer auseinandersetzen musste. Offenbach sei, so Paul Scudo in der Revue des Deux Mondes, «aus der semitischen Rasse geboren (…), deren fatale Prägung er erhalten hat». Man erlebe in Papillon die «Flachheit und Nichtigkeit» einer «Gauklermuse, die auf der bedeutendsten Opernbühne Europas herumtollt». Dieser Jude und Clown, so lässt sich das lesen, soll gefälligst zufrieden sein mit seinem Theaterchen an der Passage Choiseul.
Aber am 24. Dezember 1860 findet sie statt, die première représentation von Barkouf, am Montagabend vor der Mitternachtsmesse, mit der in Frankreich das Weihnachtsfest beginnt. 1500 Plätze hat die Salle Favart, deren Logen sogar über Klingelschnüre verfügen, um Kellner herbeirufen zu können. Der Abend, von Jacques Offenbach selbst dirigiert, wird keineswegs ein Fiasko. Man weiss die aufwändigen Kostüme und Kulissen zu schätzen, und drei Nummern müssen wiederholt werden. Pfiffe hört nur Paul Scudo. Doch nicht nur sein Urteil scheint schon vorher gefällt zu sein. Einer der klügsten Kritiker tut im Journal des Débats den Dreiakter als Stümperei eines Possenreissers ab, dessen Namen er in neun (!) Spalten kein Mal nennt. Hector Berlioz ist als Komponist selbst ein Erneuerer. Doch was Offenbach hier unternimmt, empört ihn.
Elf Takte lang spielen einmal die Geigen in der Ouvertüre rasend schnelle Achtel, g und f, schon das hat Berlioz geärgert, «ein Summen vergleichbar dem von Wespen, die man in ein Glas gesperrt hat». Dass Dur und Moll sich kreuzen, dass von B-Dur direkt in einen G-Dur-Sextakkord gesprungen wird, «all das lässt sich ohne Zweifel machen, aber mit Kunstfertigkeit. Hier wird es mit einer Nachlässigkeit, einem Unkundigsein der Gefahren vorgeführt, das ohne Beispiel ist. Man denkt dabei an das Kind, das einen Knallkörper in den Mund steckt und wie eine Zigarre rauchen will.» Und dann erweitert Berlioz die Perspektive: «Ganz entschieden geht es verrückt zu in den Hirnlein gewisser Musiker. Der Wind, der durch Deutschland weht, macht sie wahnsinnig… Ist die Zeit nahe? Welchem Messias geht der Autor von Barkouf als Johannes der Täufer voraus?»
Diese Anspielung versteht jeder – Berlioz meint Wagner. Auch L’Art musical sieht Offenbach als Teil einer anstehenden deutschen Invasion: «Das neue Werk von M. Offenbach wimmelt von harmonischen Exzentrizitäten, die die missgestimmten Apostel der Zukunftsmusik nicht verleugnen.» Eine «Melange aus Scharlatanerie und Narrheit» sei typisch für «den deutschen Genius», ein «tobender Ozean falscher Noten und nervtötender Modulationen». Das ist das Vokabular, mit dem sich inzwischen die Pariser Presse auf Richard Wagner eingeschossen hat. Unversehens wird Offenbach als deutscher Vasall eines Komponisten angegriffen, dem er nicht ferner sein könnte. Vor allem aber darüber, dass Offenbach niemals seine Bouffes-Parisiens hätte verlassen dürfen, sind sich die Kritiker mit einer Vehemenz einig, auf die der Komponist selbst schon am 30. Dezember 1860 im Figaro antwortet: «Ja, sicher, es ist eine Bouffonerie.» Genau das Leichte, Heitere habe der Opéra-Comique ja zuletzt gefehlt. «Ich verteidige das Genre, dem ich treu bleiben will. Hätte ich es verlassen, dieselben Personen, die jetzt meine Heiterkeit tadeln, hätten gesagt: Voilà, jetzt verirrt er sich ins Lyrische! Ah! Welchen Erfolg er gehabt hätte, wäre er bei seinem bescheidenen Handwerk geblieben.
Wohl wahr, doch er macht er seine Partitur harmloser, als sie ist. Offenbach geht in Richtung der grossen Oper und lässt sie zugleich hinter sich. Die Ambivalenz des Barkouf, Komik und Melancholie, Eingängigkeit und Experiment, scheint auch Begleitumstände zu spiegeln – eine Stadt als Baustelle, ein verunsichertes Regime, Opernkonventionen, die hohl geworden sind. Barkouf weiss zu viel davon, dieser Hund muss begraben werden. Nach der siebten Vorstellung am 16. Januar wird das Stück abgesetzt, trotz passabler Einnahmen. Die «Gendarmen der Ästhetik» (so der Figaro) haben gesiegt.
Vorerst. Für eineinhalb Jahrhunderte in diesem Fall. Wenn nach Strasbourg nun Zürich den Fall Barkouf neu aufrollt, ist seine Aktualität noch gewachsen. Die «Verspottung aller staatlichen Autorität» ist in vielen Ländern heute gefährlicher als im Paris von 1860. Und in Zeiten der Polarisierung ist eine Musik am Platz, die zwischen allen Stühlen komponiert wurde. Wie gut, dass der Schrank in Saint Mandé für einen geöffnet wurde, der dieses Potential erkannte.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 96, Oktober 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Auf dem Pult
Die charmante, leicht melancholische Melodie in der Romanze von Saëb im ersten Akt von Jacques Offenbachs Operette Barkouf ist für nicht weniger als vier Solocelli gesetzt. Vielleicht war Offenbach vom Cellosextett aus Nabucco inspiriert, vergleichbare prominente Cello-Ensemblestellen kennt man später auch von Tosca oder Carmen. Das Cello war jedenfalls Offenbachs Instrument: Seine musikalische Laufbahn begann er als Cellist, im Graben der Opéra-Comique und in den mondänen Pariser Salons, wo er nicht zuletzt durch sein extravagantes Auftreten beeindruckte – man nannte ihn auch den «Liszt des Violoncellos». Es heisst, dass er sich im Orchester der Opéra-Comique mit seinen Pultnachbarn den Spass erlaubte, abwechselnd immer eine Note der gemeinsamen Stimme zu spielen. Dafür bekam er eine gepfefferte Geldbusse. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich so ein Virtuose wie Offenbach beim Repertoire der Opéra-Comique langweilen musste: die technisch wenig herausfordernde Basslinie spielen zu müssen und wochenlang das gleiche Stück... Zum Glück wurden für uns heutige Cellisten seit der Zeit Offenbachs sehr viel anspruchsvollere Cellopartien in der Opernliteratur geschrieben: Wagner, Richard Strauss, Puccini... da hat man genug zu tun. Aber ich gestehe: Wenn ich nur Donizetti und Bellini spielen müsste, wäre auch ich in Versuchung, mir mit meinem Pultnachbarn ähnlich kreative Spässe auszudenken. – Von Offenbach gibt es eine umfangreiche Literatur für Cello. Sein Cellokonzert zum Beispiel, das «Concerto Militaire», ist hochvirtuos, gespickt mit Oktaven, Dezimen und schnellen Läufen. Für mich ist das aber nichts, ich mag es lieber gesanglich, und da bin ich in der Oper gut aufgehoben: in Hoffmanns Erzählungen gibt es etwa dieses sehnsüchtige Motiv, das zum ersten Mal beim Auftritt von Lindorf auftaucht und im Laufe des Abends immer wieder erklingt. Wie so oft bei Offenbach hallt auch diese Melodie noch lange in einem nach.
Barkouf
Synopsis
Barkouf
Erster Akt
Es ist Markt in Lahore. Bababeck, der Mundschenk des Gouverneurs, stürzt sich mit seinem Diener Kaliboul in das bunte Treiben. Bababeck ist bester Laune: Seine Tochter Périzade wird heute endlich heiraten.
Ein fernes Donnern ist zu hören – wieder gibt es einen Aufstand im Gouverneurspalast. Während das Volk zum Palast eilt, bleiben Maïma, die Blumenverkäuferin, und Balkis, die Orangenhändlerin, zurück. Maïma gesteht ihrer Freundin, dass sie vor einiger Zeit ihre Liebsten verloren hat: den Hund, mit dem sie aufgewachsen ist und den Soldaten entführt haben, sowie ihren Freund Saëb, der plötzlich verschwunden war.
Xaïloum, Balkis’ Geliebter, erscheint. Randalieren gehört zu seinem Kerngeschäft. Auch diesmal war er am Aufstand beteiligt.
Der Grossmogul trifft ein. Aus Ärger über sein aufständisches Volk, das einmal mehr seinen Gouverneur aus dem Fenster gestürzt hat, verkündet er, dass er nun einen Hund als Statthalter einsetzen werde – ganz zum Entsetzen Bababecks, der sich den Posten des Gouverneurs erträumte. Ihn ernennt der Grossmogul zum Grosswesir, der die Befehle des Gouverneurs verkünden soll.
Balkis und Maïma sorgen sich um Xaïloum, der wegen Rebellion verhaftet wurde. Als der Festzug des neuen Gouverneurs vorbeizieht, ist Maïma ausser sich: Sie hat ihren Hund in der Sänfte erkannt und Saëb gesehen, der die Leibwache anführt.
Zweiter Akt
Damit die Hochzeit von Périzade stattfinden kann, braucht Bababeck eine Heiratsurkunde sowie die Genehmigung, dass Périzade den Palast verlassen und zu ihrem Mann ziehen darf. Beide Papiere müssen vom neuen Gouverneur unterschrieben werden. Doch Bababecks Versuch, Barkoufs Pfotenabdruck zu erhalten, ging gründlich schief – Bababeck wurde fast gebissen.
Périzades Bräutigam ist Saëb. Dieser wurde zur Hochzeit gezwungen und trauert seiner alten Liebe Maïma nach, während sich Périzade und Bababeck auf das bevorstehende Hochzeitsfest freuen.
Auch Kalibouls Versuch, von Barkouf die Heiratsdokumente unterschreiben zu lassen, bleibt erfolglos. Mit Kratzspuren am ganzen Körper versehrt, weigert er sich, Barkouf je wieder aufzusuchen. Doch ohne offizielle Genehmigung wird keine Hochzeit stattfinden. Bababeck ist ausser sich.
Da taucht Maïma auf, die ihren Hund sucht. Sie erzählt Bababeck, dass Barkouf ihr gehörte. Bababeck wittert seine Chance und ernennt Maïma zur Sekretärin und Dolmetscherin des Hundes, um durch sie seine eigenen Befehle durchzusetzen. Maïma lässt sich darauf ein und beschafft schon bald die Unterschrift für das Hochzeitsdokument. Sie ahnt nicht, dass der junge Mann, der die Tochter Bababecks heiraten wird, Saëb ist.
Die Audienz des Gouverneurs naht. Maïma übersetzt das Bellen Barkoufs: Die vom Volk geforderten Steuersenkungen werden genehmigt und die zum Tode Verurteilten begnadigt, darunter auch Xaïloum. Bababeck tobt, Balkis ist erleichtert und das Volk jubelt.
Als Périzade und Saëb frisch vermählt erscheinen, erkennt Maïma ihren ehemaligen Liebhaber. Die Verbindung ist aber erst gültig, wenn die Braut zu ihrem Bräutigam ziehen darf – Bababeck stellt den Antrag. Barkouf bellt – für Maïma ein entschiedenes Nein! Das Volk feiert seinen Gouverneur, Bababeck, Périzade und Kaliboul ziehen erbost von dannen.
Dritter Akt
Xaïloum klettert in den Palast, um Balkis aufzusuchen, die mittlerweile mit Maïma dort lebt. Dabei wird er Zeuge einer Verschwörung: Bababeck und seine Männer planen, Barkouf bei der nächsten Gelegenheit zu vergiften. Als Xaïloum Balkis und Maïma von seiner Beobachtung erzählen möchte, bringt er zunächst kein Wort heraus.
Saëb und Maïma sprechen sich aus. Saëb erzählt ihr von den Umständen seiner Zwangsheirat: Er wurde zu dieser Hochzeit genötigt, um das Leben seines Vaters zu retten, der in ein Komplott verwickelt war.
Der Gouverneur lädt das Volk zu einem Dinner ein. Maïma fordert Bababeck und seine Komplizen dazu auf, ihr Glas auf Barkouf zu heben. Doch durch ihr Zögern entlarven sie sich selbst: Der Wein ist vergiftet. Als der Zorn des Volkes auf die Verschwörer niederfährt, verkündet Saëb die Nachricht, dass die Tataren die Stadt angreifen würden und sich ihnen Barkouf bereits wehrhaft entgegengestellt habe. Das Volk folgt seinem tapferen Anführer in den Kampf.
Barkouf stirbt in der Schlacht.
Durch eine Weisung von oben werden die neuen Verhältnisse besiegelt: Maïma heiratet Saëb und wird neue Gouverneurin. Périzade willigt in die Scheidung ein, Bababeck wird all seiner Ämter enthoben. Ein letztes Mal wird Barkouf als bester Herrscher gefeiert.