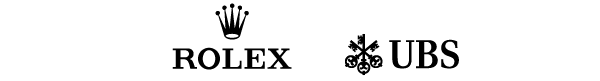Wozzeck
Gewinner des International Classical Music Award 2017 (ICMA) in der Kategorie «DVD Performance»
Die Aufnahme war von Freitag, 15. Mai ab 18.00 Uhr bis Sonntag, 17. Mai 24.00 Uhr verfügbar.
Möchten Sie noch weitere Opern- oder Ballettproduktionen kostenlos geniessen?
Hier geht's zur Übersicht unseres gesamten Online-Spielplans.
Irrlichternd hetzt der Soldat Wozzeck durch eine Welt, die er nicht zu enträtseln vermag. Vom Doktor wird er mit absurden medizinischen Experimenten gequält, vom Hauptmann gedemütigt und verhöhnt. Und seine Geliebte Marie, mit der er ein Kind hat, betrügt ihn mit dem Tambourmajor. Wozzeck wird zum Mörder und ersticht Marie. Georg Büchners Dramenfragment, das Alban Berg als Vorlage für seine erste Oper nahm, ist eine erbarmungslose Fallstudie über soziales Unrecht und menschliches Leid. Aber es ist auch eine Groteske, die von der Überzeichnung lebt – das Abgründige und das Lächerliche liegen ganz nahe beieinander. Regisseur Andreas Homoki verzichtet denn auch auf jeglichen Realismus. Seine beklemmend-radikale Inszenierung ist vom Figurentheater inspiriert. Als schlichtweg sensationell darf das Rollendebüt von Christian Gerhaher als Wozzeck bezeichnet werden: Seine Fähigkeit zur vokalen und darstellerischen Nuancierung ist atemberaubend. Fabio Luisi am Pult der Philharmonia Zürich lotet die expressiven wie auch kammermusikalischen Seiten von Bergs Jahrhundertpartitur aus.
Eine Produktion von Accentus Music in Koproduktion mit Opernhaus Zürich, in Kooperation mit BR und Arte Concert.
Trailer «Wozzeck»
Besetzung
Fabio Luisi Dirigent
Andreas Homoki Inszenierung
Michael Levine Bühnenbild und Kostüme
Franck Evin Licht
Jürg Hämmerli Chorleitung
Christian Gerhaher Wozzeck
Brandon Jovanovich Tambourmajor
Mauro Peter Andres
Wolfgang Ablinger-Sperrhacke Hauptmann
Lars Woldt Doktor
Gun-Brit Barkmin Marie
Philharmonia Zürich
Chor der Oper Zürich
Gespräch

Herr Homoki, Sie haben einmal gesagt, dass Sie sich mit dem Wozzeck einen langgehegten Wunsch erfüllen. Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt da? Anders gefragt: Warum haben Sie so lange damit gewartet?
Zunächst einmal kann man sich selbst als Intendant die Stücke nicht so einfach aussuchen. Ich hatte allerdings tatsächlich lange das Gefühl, mit diesem Stück noch warten zu können. Es mag paradox klingen, aber es ist einfach zu perfekt gebaut – in jeder Hinsicht. Gewissermassen «unzerstörbar», sodass es auch in einer weniger gelungenen Inszenierung immer eine ungeheure Wirkung entfalten wird. Umgekehrt bedeutet dies, dass ich mich als Regisseur besonders anstrengen muss, um diesem Meilenstein der Operngeschichte halbwegs auf Augenhöhe begegnen zu können und das Potenzial dieses Stückes wirklich auszuloten. Hoffentlich ist jetzt die Zeit reif dafür – jedenfalls habe ich hier in Zürich eine fantastische Sängerbesetzung.
Alban Bergs Wozzeck ist eine der wenigen Opern des 20. Jahrhunderts, die sich einen festen Platz im Opernrepertoire erobern konnten und auch beim Publikum auf grosse Akzeptanz stösst. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?
Das liegt an der grandiosen Theatralik Büchners und der Musik von Alban Berg, die trotz ihrer atonalen Komplexität in jedem Moment sehr gestisch und emotional ist. Sie zieht den Zuhörer unmittelbar in ihren Bann, ohne dass dieser etwas über ihre komplizierte Struktur wissen muss. Es ist Theatermusik im besten Sinne – was übrigens auch Arnold Schönberg lobend hervorhob, nachdem er Berg anfangs von diesem Stoff abgeraten hatte, da er ihn für Opernuntauglich hielt. Ein grandioses Fehlurteil, denn man hat sogar das Gefühl, dass erst durch Bergs geniale Vertonung das Potenzial von Büchners Fragment voll ausgeschöpft wird und der Stoff zu einer Expressivität gelangt, die er als reiner Sprechtext nie entfalten könnte. Nehmen wir nur das verrückte Panoptikum von Figuren wie dem Hauptmann, dem Doktor oder dem Tambourmajor. Allesamt pervertierte Prototypen, Karikaturen des damaligen Establishments, die durch Bergs radikalen Zugriff eine grosse Plastizität erhalten. Bei allem Schrecken, den dieses Stück entfaltet, ist Wozzeck gerade durch Bergs musikalische Sprache und ihren grotesken Humor sehr unterhaltsam.
Dass ein Stück wie Wozzeck auch humorvoll sein könnte, liegt nicht unbedingt auf der Hand. Die Oper gilt häufig als deprimierend und erschreckend realistisch. Ein Werk, in dem man das schmerzhafte Zucken jedes einzelnen, gequälten Körpernervs wie durch ein Vergrösserungsglas sieht.
Man liest tatsächlich oft, dass Büchner seinen Woyzeck aus einem «realistischen» Anspruch heraus geschrieben hat. Dafür spricht scheinbar, dass er einen zeitgenössischen Proletarier ins Zentrum seines Dramas gestellt hat – etwas damals unerhört Mutiges. Dann ist da die Sprache der einfachen Leute, die er versucht hat, möglichst direkt abzubilden. Mit diesem Mut zum «Hässlichen» war er aber seiner Zeit weit voraus, er weist in den Expressionismus des frühen 20. Jahrhunderts. Bergs Musik greift genau das auf und scheut auch vor der Groteske nicht zurück. Ich würde behaupten, dass Büchners «realistische» Figuren auf den zeitgenössischen Leser ähnlich grell gewirkt hätten, wie es Alban Bergs expressionistische Umsetzung auf uns heute tut. Die Situationen sind musikalisch extrem und oft bis ins Fratzenhafte verzerrt gezeichnet. Denken Sie nur an die Wirtshausszene mit dem Jägerchor – das hat gar keine Melodie mehr, sondern klingt wie ein Cluster, die völlige Pervertierung eines Volkslieds. Hinzu kommt die ungeheure Verdichtung, die Berg gegenüber der Büchnerschen Vorlage vornimmt. In 15 teilweise extrem kurzen Szenen überschlagen sich die Ereignisse geradezu und führen zielstrebig in die Katastrophe. Eine naturalistische Darstellungsweise im Sinne etwa eines Stanislawski-Theaters kam für uns bei dieser Oper daher von vorneherein nicht in Frage.
Sie haben sich stattdessen entschieden, die Geschichte in einem Raum zu erzählen, in welchem die Darsteller wie Puppen agieren. Warum?
Wozzeck ist ein Gefangener der Umstände, die ihn umgeben und bestimmen. Er schläft kaum und hetzt sich ab, um das Allernotwendigste zusammenzukratzen, setzt sich gar medizinischen Versuchen aus. «Nichts als Arbeit unter der Sonne, sogar Schweiss im Schlaf. Wir arme Leut’!» Wenn Büchner den Doktor pathetisch verkünden lässt, im Menschen verkläre sich «die Individualität zur Freiheit», so beweist das Stück in jeder Sekunde das komplette Gegenteil. Niemand ist hier frei, alle verhalten sich wie unter Zwang. Selbst die Ausbeuter sind Getriebene und Opfer: der Hauptmann mit seinem Tugendwahn und seiner Angst vor der Ewigkeit oder der Doktor mit seinem Wissenschaftsspleen und grössenwahnsinnigen Vorstellungen vom eigenen Ruhm. Einen Ausweg gibt es nicht. Ein Theater, das seine Figuren wie Puppen agieren lässt, schafft eine eingängige Metapher für eine Welt, in der wir alle nichts als kleine Räder eines grossen Getriebes sind. Gerade wir heutige Menschen fühlen uns doch oft allzu sicher in einer Welt, von der wir meinen, sie weitgehend erforscht zu haben. Aber ich bin überzeugt: trotz allen wissenschaftlichen Fortschritts wird unser Horizont immer begrenzt bleiben, und wir werden nie gänzlich wissen, wie die Welt, der Kosmos, wirklich beschaffen ist. Wie Puppen, die nicht wissen, von wem genau sie gespielt werden.
Das erinnert an einen Satz aus dem sogenannten Fatalismus-Brief von Büchner an seine Braut Wilhelmine Jaeglé. Der Revolutionär Büchner fühlt sich von der Schicksalsergebenheit wie vernichtet. Er schreibt, dass «der Einzelne nur Schaum auf der Welle» sei...
Diese Welt des Wozzeck ohne jede individuelle Freiheit war für meinen Ausstatter Michael Levine und mich von Anfang an nur in der Überhöhung als Groteske darstellbar. Beispielsweise, indem man die Geschichte als ein böses Spiel erzählt, eben als albtraumhaftes Puppentheater. Weil die Realität so hoffnungslos ist, dass jeder Versuch, sie auf die Opernbühne zu bringen, obszön wirken muss. Man spürt hier die grosse Geistesverwandtschaft Büchners zum Sturm-und-Drang-Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz, dem er mit seiner Novelle Lenz ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Dessen Hauptwerk, Die Soldaten, hat auch auf die Entstehung des Woyzeck grossen Einfluss ausgeübt. Für Lenz besteht das Wesen der Komödie darin, dass die Figuren nicht mehr – wie in der Tragödie – selbständig agieren, sondern einer grausamen Maschinerie ausgesetzt sind, die sie zu blossen Objekten degradiert. Das Grauen hinter dem fratzenhaften Lachen einer Maske zu verstecken, ist ein literarisches Prinzip, dem wir bis heute immer wieder begegnen, denken Sie nur an die Dramen von Peter Weiss oder die Figur des Joker in Batman.
Laut Alban Berg geht die Idee der Oper «weit über das Einzelschicksal Wozzecks hinaus». Was ist mit dieser übergeordneten Idee Ihrer Meinung nach genau gemeint? Und inwieweit wird sie durch den Weg über das Puppentheater deutlich?
Auch wenn wir auf der Bühne extreme Figuren zeigen, bleiben es selbstverständlich immer Abbilder von menschlichen Phänotypen und Verhaltensweisen, die jeder kennt und für sich übersetzen kann. Ohne eine starke theatralische Verfremdung hätte ich grosse Sorge, in eine Art politisches Betroffenheitstheater abzurutschen, bei dem sich sowohl Publikum als auch Künstler gegenseitig einlullen im wohligen Gefühl einer gemeinsamen Verurteilung der dargestellten Missstände. So etwas hat mit lebendiger Auseinandersetzung nichts mehr zu tun, zumal die kritisierten sozialen Verhältnisse der Büchner-Zeit bei uns mittlerweile ohnehin überwunden sind. Die Frage nach einer gerechteren Welt kann heute nur noch im globalen Massstab betrachtet werden, dies erleben wir in Europa heute angesichts der dramatisch zunehmenden Flüchtlingsströme mit jedem Tag deutlicher. Die Idee dieser Oper geht tatsächlich weit über das Einzelschicksal Wozzecks hinaus. Sie ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die Menschenwürde, ein Appell an die Menschlichkeit. Dieser Appell kulminiert im erschütternden letzten Zwischenspiel der Oper, bei dem jeder Versuch der Bebilderung scheitern muss. Deshalb wird an dieser Stelle auch bei uns nur die Musik sprechen.
Das Gespräch führte Kathrin Brunner.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 31, September 2015.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Essay
Der Blitz, der vom Himmel fährt
Kürzlich hörte ich in einem schwäbischen Dorf, wie ein Bauer einen abwesenden Bekannten verfluchte. Der Bauer sass im Wirtshaus und sprach: Den soll der Blitz beim Scheissen treffen! Man merkte, dass ihm die Sache ernst war. Der Bauer bebte vor Zorn, er hätte es wirklich gewollt: Dem Feind sollte nicht nur das Leben genommen werden, er sollte im Moment, da es geschähe, auch nackt, schmutzig, arglos und allein sein. Ich, am Nebentisch, stellte mir den Moment vor – der Blitz fährt nieder, zwei Häufchen bleiben übrig, eins von Asche und eins von Kot – und musste lachen. Der Verfluchte war wohl der Bürgermeister des Dorfes. Aber dann fiel mir ein anderer grosser Gewitterspruch ein, Büchners Woyzeck hat ihn geprägt. Und ich hörte auf zu lachen.
Woyzeck, der elende, von der Wissenschaft missbrauchte, von Stimmen verfolgte, von seiner Geliebten betrogene Soldat, sagt zum Hauptmann: «Wir arme Leut… Unsereins ist doch einmal unselig in der und der andern Welt. Ich glaub, wenn wir in Himmel kämen, so müssten wir donnern helfen.»
Büchners Sprache hat eine Wut, die dem Fluch des grimmigen Schwaben ebenbürtig ist. Sein Blitz, sein Blick ist so scharf, dass jeder, den er streift, vulgär gesagt, beim Scheissen getroffen wird – erfasst in der erbärmlichen Mitte des Lebens, im Moment der Einsamkeit, der Notdurft und der Erwartung.
Die Wirkung von Büchners Sätzen ist wie eine Entwurzelung, aber nicht mit dem Ziel der Vernichtung, sondern der Befreiung: Das muss alles neu gedacht werden. Er will das Leben gar nicht verneinen, sondern er stellt in Frage, dass es überhaupt schon begonnen hat. Danton sagt zu Camille: «Es wurde ein Fehler gemacht, wie wir geschaffen wurden; es fehlt uns freilich etwas, ich habe keinen Namen dafür, aber wir werden es uns einander nicht aus den Eingeweiden herauswühlen, was sollen wir uns darum die Leiber aufbrechen? Geht, wir sind elende Alchymisten.»
Immer wieder vergleicht Büchner den Menschen mit einem Mechanismus, einer Puppe, einem von aussen geführten Ding, in das man hineinsehen kann, ohne zu wissen, warum es funktioniert. «Jeder hat eine feine, feine Feder von Rubin unter dem Nagel der kleinen Zehe am rechten Fuss, man drückt ein klein wenig, und die Mechanik läuft volle fünfzig Jahre» – so heisst es in Leonce und Lena.
Seine Stücke sind Horrortragödien des Erkennens: Je mehr einer von der Welt begreift, desto unwirtlicher wird sie ihm: leer das Getriebe, hohl jeder Mittänzer. Je mehr er durchschaut, desto weniger Möglichkeiten zur Flucht hat er. Viele Büchner-Sätze wirken, als sei ihr Autor von Untoten umgeben, unsicher, ob er nicht selbst einer ist. In Leonce und Lena unterhält er sich glänzend mit seiner eigenen Verzweiflung, und seine tiefe Traurigkeit erzeugt dort, wo sie an die Oberfläche kommt, einen unbändigen Springbrunnen an Einfällen. Aber wenn es in dieser Komödie heisst, das Volk möge sich im Quadrat aufstellen, um zahlreicher zu erscheinen, so weiss man, wie Büchner es meint: Das Volk lebt gar nicht, es sind lauter Gespenster. Auch die Szene aus dem Woyzeck, in welcher ein «Erster Handwerksbursche» aus sich herausgeht, um seine Meinung über die Welt kundzutun, ist im Grunde schauderhaft: «Jedoch, wenn ein Wanderer, der gelehnt steht an dem Strom der Zeit, oder aber sich die göttliche Weisheit vergegenwärtigt und fraget: Warum ist der Mensch? (mit Pathos) Aber wahrlich, geliebte Zuhörer, ich sage Euch: (verzückt) Es ist gut so! Denn von was hätten der Landmann, der Fassbinder, der Schneider, der Arzt leben sollen, wenn Gott den Menschen nicht geschaffen hätte? Von was hätte der Schneider leben sollen, wenn Er nicht dem Menschen die Empfindung der Schamhaftigkeit eingepflanzt hätte? Von was der Soldat und der Wirt, wenn Er ihn nicht mit dem Bedürfnis des Totschiessens und der Feuchtigkeit ausgerüstet hätte?»
Und wovon, kann man heute fragen, sollten die beiden Spezialisten der Gegenwart, der Controller und der Motivationstrainer, bloss leben, wenn uns Gott nicht die Gier und die Angst vor dem Abstieg eingepflanzt hätte?
Gott hat die Berufe geschaffen, um sich an der Einfalt der Spezialisten zu erfreuen. Wer einen Beruf hat, ist kein lebender Mensch, sondern bloss ein Schneider oder ein Soldat oder ein Wirt. In Leonce und Lena wird derselbe Gedanke noch spasshafter gefasst. Dort sagt der Prinz: «Denn wer arbeitet, ist ein subtiler Selbstmörder, und ein Selbstmörder ist ein Verbrecher, und ein Verbrecher ist ein Schuft, also, wer arbeitet ist ein Schuft.» Es ist von Büchner gar nicht so weit zum Horror in der amerikanischen TV-Serie Walking Dead (Die wandelnden Toten). Wo er hinblickt, zerfällt die Welt – in Abgründe, Spezialbegabungen, Konkurrenz, Betriebsdummheit. Auch in den Spiegel kann er nicht mehr schauen, weil der Mann darin eine Marionette mit einer Maske vor dem hohlen Kopf ist. Anders als die Untoten in den amerikanischen Serien sind die Gestalten Büchners aber Wesen, die ihr Leben nicht hinter, sondern möglicherweise noch vor sich haben – das ist der Glutpunkt der Hoffnung in seinem Werk. Haben wir noch gar nicht angefangen?
Das arme Kind
Sartre hat gesagt, es liege ein Trost gerade in den dunkelsten, trostlosesten Texten. Dass das Schlimmste ausgesprochen werde, lasse darauf hoffen, dass es auch zu überwinden sei. Lesen wir daraufhin die allerdunkelste Stelle im Woyzeck, den Moment, da die Grossmutter den Kindern, den «kleinen Krabben», ein Märchen erzählt: «Es war einmal ein arm’ Kind und hatt’ kein Vater und keine Mutter, war alles tot, und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot, und es is hingangen und hat gesucht Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollt’s in Himmel gehn, und der Mond guckt es so freundlich an; und wie es endlich zum Mond kam, war’s ein Stück faul Holz. Und da is es zur Sonn gangen, und wie es zur Sonn kam, war’s ein verwelkt Sonneblum. Und wie’s zu den Sternen kam, waren’s kleine goldne Mücken, die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die Schlehen steckt. Und wie’s wieder auf die Erde wollt, war die Erde ein umgestürzter Hafen. Und es war ganz allein. Und da hat sich’s hingesetzt und geweint, und da sitzt es noch und is ganz allein.»
Man sieht es vor sich, das blindgeweinte Kind, sein runder Kopf ragt ins leere All, und man fragt sich: Was kann nach diesem Märchen noch erzählt werden? Was hätte der Autor, der nur 23 Jahre alt wurde, erst als 30 oder 40Jähriger geschrieben? Dieses Märchen ist wie ein Erwartungs-Endpunkt, und die einzige Hoffnung, die ein Kind, welches es hört, und wenn wir es hören, werden wir alle zu Kindern, aus ihm schöpfen könnte, wäre die: Ich werde so hart, so kalt werden, dass ich auf Zuversicht verzichten kann; das Nichts wird mir nichts ausmachen. Mich verschlingt es nicht. Ich mache einfach weiter.
Und so kam es auch. Man hätte nicht gedacht, dass man noch tiefer in die Hoffnungslosigkeit würde hinuntergraben können, als Büchner es tat, aber Friedrich Dürrenmatt hat es geschafft. Mehr als hundert Jahre nach dem Woyzeck schrieb er eine ganz kurze Erzählung namens Weihnacht. Dürrenmatts Erzähler ist der Kälte des Universumsgewachsen – er setzt ihr seine eigene entgegen. Er frisst sozusagen die Kulissen des kosmischen Theaters, hinter denen nichts ist; er ernährt sich von ihnen. Er ist ein Parasit, ein Aasfresser geworden. Als der Erzähler dem Christuskind begegnet, liegt es tot im Schnee: «Ich öffnete seine Lider. Es hatte keine Augen. Ich hatte Hunger. Ich ass den Heiligenschein. Er schmeckte wie altes Brot. Ich biss ihm den Kopf ab.» Wieder sechzig Jahre später: Es schmeckt uns allen, auch ohne dass wir wüssten, warum. Man braucht zum Existieren keinen Lebenssinn. Auf einer grossen Hamburger Strasse sah ich den Lieferwagen eines CateringUnternehmens vorbeifahren. Auf der Seite stand: «Wenn wir schon leben müssen, dann wenigstens im Luxus.»
Drei Szenen
Erstes Weib: «Ein hübscher Mann, der Hérault!» Zweites Weib: «Wie er beim Konstitutionsfest so am Triumphbogen stand, da dachte ich so, der muss sich gut auf der Guillotine ausnehmen, dachte ich. Das war so ’ne Ahnung.» Drittes Weib: «Ja, man muss die Leute in allen Verhältnissen sehen: es ist recht gut, dass das Sterben so öffentlich wird.»
Was prägt diese grimmige Stelle aus Dantons Tod? Am ehesten wohl die Abwesenheit von Mitgefühl, heute – Emphase. Und man stellt sich vor: Dieses Gespräch findet jetzt unter den Hasskommentatoren im Netz oder unter einer Freundesmeute bei Facebook statt, beim Gespräch über die Todesarten, die man einem Kinderschänder, einem korrupten Fussballschiedsrichter, einem verhassten Mitschüler wünscht. Büchner hört das alles nicht mit Häme, eher mit Staunen; und er hat auch nicht die Beflissenheit eines Pädagogen, der glaubt, er müsse uns ein Verhalten nur zeigen, um es abzustellen. Welche Moral spricht aus seinen Texten? Keine, allenfalls die der Genauigkeit. Volker Braun hat in seiner Dankesrede zur Verleihung des Büchnerpreises gesagt: «Es ist die Schärfe seiner Fragen, die Georg Büchner von uns allen trennt: und das entschlossene Zögern mit Antworten.»
—
«Dieweil der Tag lang und die Welt alt ist, können viel Menschen an einem Platz stehen, einer nach dem andern.» Was ist das? Der Befund eines Menschen, der einen Mittelmeerstrand betrachtet, an dem nachts die syrischen Flüchtlinge landen und am Nachmittag die nordeuropäischen Touristen liegen? Der Satz eines Unsterblichen, der 400 Jahre lang auf denselben Platz gestarrt hat? Nein, es ist nur Marie im Woyzeck. Büchner richtet diesen Jahrhundertblick aus dem Kopf jeder Gestalt auf jeden Erdenfleck. Die Verwandlung des Erdenflecks ins Niegesehene, Niedagewesene ist hier jedem gegeben, der eine Stimme hat – auch wenn ihn die Verwandlung nicht retten wird. Eineinhalb Jahrhunderte später, in Samuel Becketts Fernsehspielen Quadrat I und II, eilen stumme, von Furien gehetzte Kuttenträger über eine quadratische Bühne, im strengen Zickzack, sie sinken immer tiefer ein in die Bühne, einer nach dem anderen, und während sie das tun, wird der Tag lang und die Welt alt. Beckett hat gesagt, während seines Spiels vergingen zehntausend Jahre. Den Satz zu diesem Spiel hat Büchners Marie gesagt.
—
«Wir wissen wenig voneinander. Wir sind Dickhäuter, wir sind sehr einsam», sagt Danton. Und: «Wir müssten uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren.» Kürzlich habe ich, im Fernsehen, diese Szene in einer modernen Paraphrase gesehen. In einer Folge von Dr. House sagt eine Frau zu ihrem Geliebten: «Wie schade, dass du keinen Blog schreibst. So werde ich nie erfahren, was Du denkst.»
Der Blitz, der zum Himmel auffährt
Büchner glaubt nicht an den Gott, der Blitze senden könnte, an den alttestamentarischen Strafmeister. Aber an den zu strafenden Gott, der seine Pflichten nicht wahrnimmt, der nicht hilft, nicht rettet, nicht auffängt, an den glaubt er wohl. Nach ihm durchsucht er das leere Universum. Man könnte sagen, das Werk Büchners ist ein grosser Weltdurchsuchungsbefehl: Wo ist ER? Manche Passagen seines Werkes sind so grossartig, dass man glaubt, er habe ihn doch gefunden: So will er, im Lenz, Gott zwischen seinen Wolken schleifen, im Zorn über den Tod eines armen Kindes, und mit Dantons Stimme erklärt er, es gehe ein Riss durchs Universum, wenn nur ein Wesen Schmerz empfinde. Man könnte sagen, Büchner schickt den Wunsch-Blitz, den der grimmige Schwabe vom Beginn dieses Textes aus dem Himmel fahren lässt, kraft seines Geistes zurück, nach oben: Er will Gott durch seine Schöpfung jagen, er will ihn aus seinen Wolken fegen.
Fast 140 Jahre, so scheint es, hat Gott sich Zeit gelassen, ehe er Büchner endlich Antwort gab. Im Jahr 1972 erschien ein Song des Amerikaners Randy Newman, und dieses Meisterwerk, God’s Song, muss Newman von Büchners Gott in die Feder diktiert worden sein. ER ist es selbst, der hierin das Wort an uns richtet, und siehe, der Schöpfer ist ein unrührbarer, kalter Herr, dem die Menschheit weniger bedeutet als eine Kaktusblüte, und der über die Gebete lacht, welche die Menschen an ihn richten: «How we laugh up here in heaven at the prayers you offer me …»
Wie wir hier oben über euch lachen müssen! Warum «wir»? Natürlich könnte es der Pluralis Majestatis sein, den Gott hier verwendet. Aber vielleicht meint Newmans Gott auch die Gefolgschaft der Elenden, mit denen er sich im Himmel umgibt.
«Unsereins ist doch einmal unselig in der und der andern Welt. Ich glaub, wenn wir in Himmel kämen, so müssten wir donnern helfen.» Ich stelle mir Woyzeck als einen niederen Geräuschemacher vor, einen jener tauben Blechdosenglöckner, die im Himmel für die verheerendsten Schläge zuständig sind. Denn selbst wenn es keine Götter mehr geben sollte, so muss es, das hat Büchner uns gelehrt, Donnerhelfer ohne Zahl dort oben geben. Fünf Siebtel der Weltbevölkerung sind arm, zwei Siebtel reich; fünf Siebtel werden den Donner erzeugen, den sich die Übrigen gelassen anhören werden. Wenn es donnert, muss ich an Woyzeck denken.
Ein Text von Peter Kümmel.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 31, September 2015.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Meine Rolle

Wozzeck ist in jeder Hinsicht eine unterprivilegierte Figur. Er ist materiell, und was seine Bildung angeht, unterlegen, sogar sexuell, denn er kann seiner Frau nicht bieten, was sie offensichtlich braucht. Dass er ein Underdog ist, berührt mich doch sehr. Im Grunde besteht ja das gesamte Personal des Stücks nur aus Underdogs. Der Herrscher über die Verhältnisse taucht nicht auf. Alle sind Getriebene, die treibende Kraft bleibt anonym.
Vieles weist bei Wozzeck in Richtung einer psychischen Erkrankung. Seine Wahnvorstellungen etwa, alles sei hohl, alles schwanke. Es gibt Dinge, die nur er hört und sieht. In der Studierstube des Doktors wird Wozzeck gescholten, dass er an die Wand gepisst hat, er wird ermahnt, seine Bohnen zu essen. Irgendwann bricht es aus Wozzeck heraus, mit Worten, die nicht die seinen sind und die ihm selbst rätselhaft bleiben, weil auch das, was in ihm vorgeht, rätselhaft für ihn ist. «Sehen Sie Herr Doktor, manchmal hat man so ’nen Charakter... so ’ne Struktur... mit der Natur...» Es sind Worte, die nicht zu seinem Verständnishorizont gehören. Er redet, weil sich durch bedrängende Erlebnisse ein enormer Leidensdruck in ihm aufgebaut hat. Das ist typisch für seelisch Leidende. Sie wollen etwas loswerden, sie müssen äussern, was sie in diesem ungemein vielfältigen Erleben bedrängt und beschäftigt. Wozzeck schreibt Wahrnehmungen einen Sinn zu, den andere nicht nachvollziehen können. Er weist auf die «Schwämme» hin, «Linienkreise, Figuren, wer das lesen könnte.» Diese Tragik, etwas stark zu erleben, es aber nicht angemessen äussern zu können, habe ich im Rahmen meines Medizinstudiums oft mitbekommen. Für den Kranken hat solches Erleben eine unglaubliche Bedeutung, aber von der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist es ausgeschlossen. Bei Büchner und Alban Berg aber wird plötzlich eine solche Persönlichkeitsstruktur und das dazugehörige Leiden zum Thema. Für mich bleibt offen, ob das, was Wozzeck visioniert, wirklich interessant ist. Wozzecks Wahnwelt ist solipsistisch. Andreas Homoki trägt dem in seiner Inszenierung in starkem Masse Rechnung. Er zeigt die Szenen aus der Sicht der Titelfigur, in surrealer Verzerrung und karikaturistischer Überzeichnung.
Im Verlaufe des Stücks durchläuft Wozzeck eine Entwicklung. Am Anfang ist er hilflos und desorientiert. Der Hauptmann fährt ihn an: «Red’ Er doch was!» Wir kennen das doch alle: Wenn man einen Schweigenden anschreit, er soll endlich etwas sagen, dann sagt der erst recht nichts. Der gesamte erste Akt handelt von der maximalen Verunsicherung Wozzecks. In der Hauptmannszene, mit Andres auf dem Feld, dann in der Begegnung mit seiner Frau und dann der Doktor mit seinen unsterblichen Experimenten. Jede Szene exponiert eine existenzielle Unsicherheit Wozzecks. Im zweiten Akt entwickelt Wozzeck dann ein Selbstbewusstsein ex negativo, und das geht in Richtung Hass. Diese Entwicklung nimmt immer mehr Fahrt auf. Die Wut wächst. Und er erfährt diese zunehmend als das, was seine Person ausmacht, weil er sich in ihr zum ersten Mal als nicht mehr fremdgesteuert wahrnimmt. Er wird dann im dritten Akt tatsächlich zu dem «offenen Rasiermesser», als das ihn der Hauptmann bezeichnet hat. Gleichzeitig nimmt sein Gehetztsein ab. Er ermordet Marie bewusst und planvoll. Das empfinde ich als Wozzecks Tragik: Er mordet als Akt der Selbst-Bewusstwerdung, welche ihm sonst versagt blieb.
Text von Christian Gerhaher.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 75, Januar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Christian Gerhaher singt Wozzeck
Christian Gerhaher im Interview mit Club Jung-Mitglied Leandra Nitzsche über die Bedeutung von Alban Bergs Oper «Wozzeck».
Die geniale Stelle
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel fahren ein greller Bläser-Akkord und ein dröhnender Tam-Tam-Schlag ins musikalische Geschehen: Der Arzt, der gerade seinen Patienten zu untersuchen schien, fährt in hellem Schrecken auf. Was ist geschehen? Der Soldat, den er da untersucht, ist kein Patient (eine ärztliche Behandlung könnte er sich gar nicht leisten), sondern ein Versuchsobjekt: Der Doktor erprobt «wissenschaftlich» am lebenden Menschen die Wirkung extrem einseitiger Ernährung auf den Organismus und die Psyche. Aber das Versuchsobjekt verhält sich nicht regelkonform. Mit eigenen Augen hat der Herr Doktor gesehen, wie der Soldat Wozzeck «auf der Strasse gepisst hat». Das ist «schlecht, sehr schlecht», aber nicht, weil es ungehörig ist, sondern – diese Erkenntnis ist es, die ihn so heftig erschreckt – weil es seine Studien behindert. Denn er benötigt die kostbare Körperflüssigkeit für seine Analysen, mit denen er eine «Revolution in der Wissenschaft» auszulösen hofft, die ihn unsterblich machen, und so dem Tod ein Schnippchen schlagen soll.
Denn der Tod ist es, der hier plötzlich im Raum steht. Wenn auch der Doktor das Wort nie ausspricht, die Musik ist unmissverständlich: Der schrille Klang, der das musikalische Gewebe zerreisst, ist es-Moll, ein reiner Dreiklang, der im atonalen Umfeld wie ein Fremdkörper aus einer anderen Welt erscheint: Es ist die Welt des Todes, auf die die Tonart es-Moll traditionell verweist. Der Dreiklang bezeichnet also das Entsetzen des Doktors, der seinen Weg in die Unsterblichkeit durch Wozzecks Insubordination gefährdet sieht. Wer so stark auf das Nachher, sein Nachleben, nicht im Jenseits, sondern im Diesseits, fixiert ist, lebt nicht gern. Der Doktor ist ebenso von Angst zerfressen wie der Hauptmann und der Tambourmajor – und wie Wozzeck, den sie zugrunde richten, um ihrer Angst Herr zu werden. Die hier mit vollem Bewusstsein an der Zerstörung eines Menschen arbeiten, tun es als Getriebene, als Rädchen in einem Getriebe, dem sie ebenso ausgeliefert sind, wie ihr Opfer, auch sie unmenschlichen Verhältnissen unterworfen, die sie nicht gemacht haben und nicht durchschauen.
Diese Übereinstimmung im Schicksal der Figuren betont Berg, indem er den es-Moll-Akkord ein zweites Mal auftauchen lässt: In der Mitte der Wirtshausszene im 2. Akt, grundiert er den Moment, da Wozzeck den Entschluss fasst, Marie – und damit auch sich – zu töten. Es ist derselbe Akkord, aber in ganz anderer Gestalt. Der schrille Klang der hohen Bläser ist dem düsteren aber weichen, fast heimeligen der Posaunen in tiefer Lage gewichen. Für Wozzeck ist der Gedanke an den Tod nicht erschreckend. Der Ärmste der Armen ist wie jene Sklaven, über die es in Bertolt Brechts Verhör des Lukullus heisst: «Sie trennt nur so weniges von den Toten. Von ihnen kann man sagen, dass sie nur beinahe leben.»
Der Knecht fürchtet den Tod nicht wie der Herr, denn ihn bindet so wenig an das Leben. Doch gerade deshalb ist er es, der den Zwang brechen könnte. Denn kein undurchschaubares Fatum waltet hier über den Menschen, es sind die Menschen, die ihr Schicksal schaffen, und Menschen können es auch ändern. Erhöbe sich der Knecht, er könnte auch den Herrn befreien. Aber die Maschine funktioniert zu gut: Der Mann, der ihr kleinstes Rädchen ist, richtet seine Energie gegen den einzigen Menschen, der noch schwächer ist als er, gegen die Frau, die er liebt, und die alles ist, was er hat.
Text von Werner Hintze.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 31, September 2015.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten
Dieser Film verrät, warum die beeindruckenden und monumentalen Bühnenkulissen wie z.B. von «Wozzeck» quer durch die Stadt und wieder zurückgefahren werden müssen und warum das so wichtig ist.
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
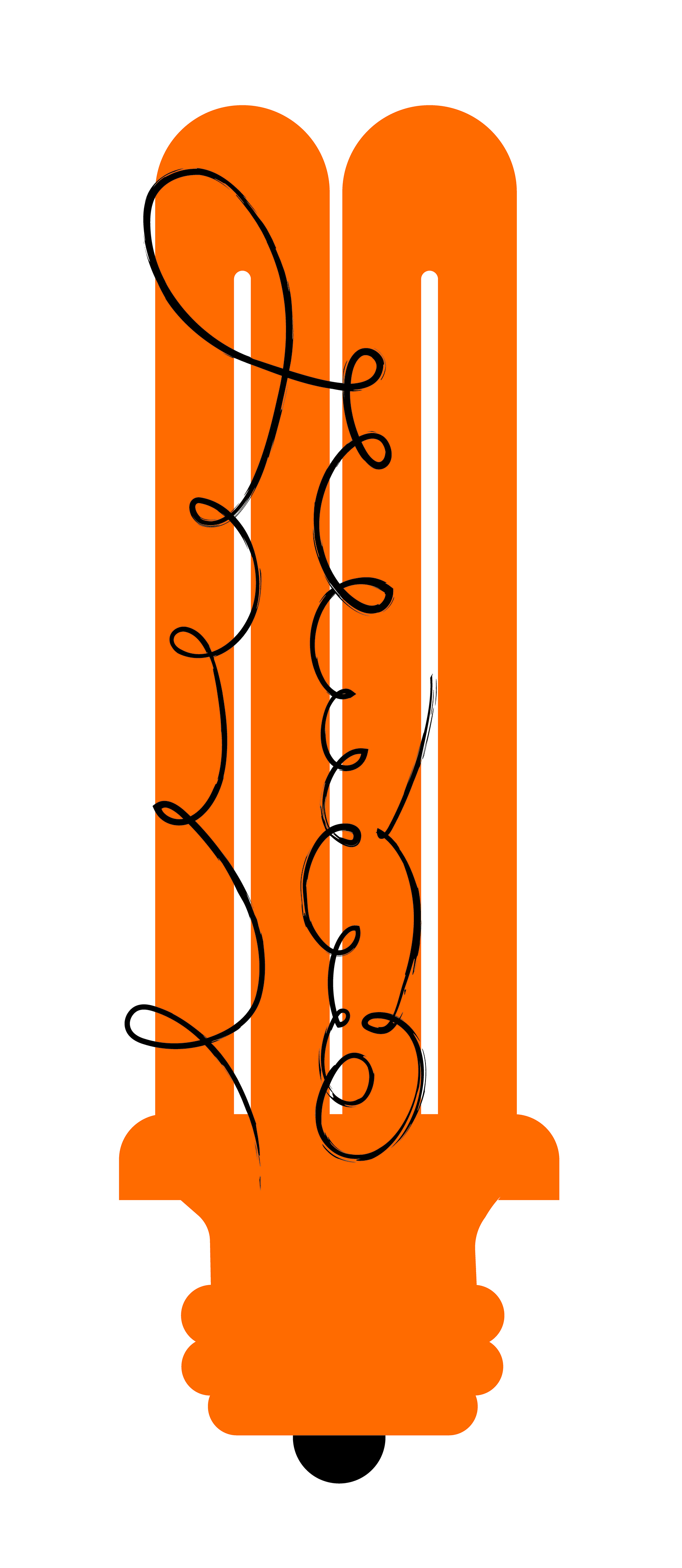
«Das geht nicht»… «Diesmal schaffen wir es wirklich nicht»… «No Way»… «Alles hat seine Grenzen»…: Diese Gedanken schossen mir durch den Kopf, während mir Andreas Homoki und sein Bühnenbildner Michael Levine den Bühnenbildentwurf zur Produktion Wozzeck zum ersten Mal präsentierten. Aber das, was sie mir präsentierten, war zugleich optisch unerhört spannend und technisch extrem herausfordernd: Ein Bühnenbild, das selbst mitspielt, die Handlung vorantreibt, kommentiert und zuspitzt. Unser Ehrgeiz, diesen Entwurf auf die Bühne zu bringen, war erwacht. So machte sich vor mehr als einem halben Jahr unsere Projektleiterin Susan Klimmer an die Planung; und während ich diesen Artikel schreibe, wird das Bühnenbild von unserer Technik unter der Leitung unseres Bühnenmeisters Marc Linke auf der Bühne zum ersten Mal aufgebaut.
Die Elemente, die Susan mit unserem Konstruktionsprogramm am Computer vor Wochen und Monaten per Mausklick entworfen, verändert, verschoben und zusammengefügt hat, werden seit heute früh sieben Uhr auf grossen Wagen auf die Bühne gerollt. Das Element, das sie am Rechner einfach neben ein anderes geschoben hat und das dann von der Software automatisch am Nachbarelement ausgerichtet wurde, steht nun ganz real vor Marc auf der Bühne und muss von 15 Technikern mühselig Zentimeter für Zentimeter über den Bühnenboden gewuchtet werden, bis es exakt am Nachbarelement sitzt. Der Versuch, die beiden Elemente zu verschrauben, scheitert zunächst: Die Befestigungslöcher sind um Millimeter gegeneinander verschoben, die Technik flucht und drückt, hebelt und ächzt, bis die Teile sitzen. Dann werden die grossen Teile miteinander verschraubt, und das nächste Element wird auf die Bühne gewuchtet. Und das Bühnenbild besteht aus vielen solchen Elementen… Jetzt ist es gleich 23 Uhr, die letzten Teile werden auf ihre Position geschoben – alles passt!
Doch mit dem Aufbau allein ist es beim Bühnenbild des Wozzeck nicht getan: Denn der Bühnenraum spielt ja mit, ist Teil der szenischen Bewegung, und seine Verwandlungen sind so komplex und vielseitig, dass wir heute Nacht beginnen müssen, mittels einer extra dafür programmierten Steuerung dem Bühnenbild Leben einzuhauchen, sprich Bewegung beizubringen. Morgen Abend kann es dann bereits bei der ersten Bühnenprobe mitspielen. Welche Rolle es spielen wird und welchen spektakulären Effekt es zum Ende der Inszenierung bereit hält, verrate ich hier nicht. Nur so viel: Schon allein aus technischen Gründen muss man diese Inszenierung unbedingt gesehen haben.
Text von Sebastian Bogatu.
Illustration von Anita Allemann.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 31, September 2015.
Das MAG können Sie hier abonnieren.