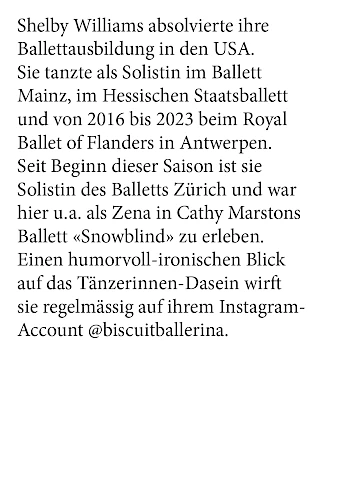Timekeepers
Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Dauer 1 Std. 45 Min. inkl. Pause nach dem 2. Teil nach ca. 45 Min. Nach dem 1. Teil findet eine 6-minütige Umbaupause statt. Gerne dürfen Sie dabei sitzenbleiben.
Partnerin Ballett Zürich 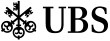
Gut zu wissen
Pressestimmen
«Jede Choreografie ist für sich einfach grossartig»
SRF, 23.01.24«Das Ballett Zürich samt Junior Ballett kann alles, individuell und kollektiv.»
Tanznetz, 22.01.24«Kein Zweifel: Das Ballett Zürich ist unter seiner neuen Chefin Cathy Marston erkennbar weiblicher und auch vielseitiger geworden, aber es ist vor allem zu einer hinreissend schönen Kompanie zusammengewachsen, die an diesem Abend Fabelhaftes leistet.»
NZZ, 22.01.24«An evening to celebrate»
Bachtrack, 23.01.24
Hintergrund

Die Freibeuterin
Bronislawa Nijinska ist als Schwester von Vaslav Nijinski und Tänzerin in Sergei Diaghilews berühmter Ballett-Compagnie eine charismatische Künstlerpersönlichkeit aus den heroischen Zeiten der Ballets Russes. Das Ballett Zürich bringt eine Rekonstruktion ihrer legendären Choreografie von Igor Strawinskys Ballett-Kantate «Les Noces» auf die Bühne.
Heiraten aller Art spielten in ihrem Leben eine Schlüsselrolle – seien es die Anlässe selbst, seien es die Folgen, sprich: spätere Trennungen von Tisch und Bett. Den Auftakt machten ihre Eltern – ein Tänzerpaar, das gemeinsam drei Kinder in die Welt setzte: Stanislav, Vaslav und eben Bronislawa, geboren 1886, 1889 und 1891. Der Vater geht schon bald auf und davon. Sein Verschwinden kann die Tochter kaum verschmerzen. Als sie selbst an der Reihe ist, einem Mann das Jawort zu geben, ist ersatzweise ein überaus illustrer Brautvater zur Stelle: Sergei Diaghilew, Impresario der Ballets Russes, übergibt seine Tänzerin Bronislawa Nijinska an Aleksandr Kochtovsky, den er ebenfalls unter Vertrag hat. Das geschieht 1912, und dann noch einmal 1924 in anderer Besetzung: Der Bräutigam, der die Nijinska wiederum aus der Hand Diaghilews entgegennimmt, heisst nun Nicholas Singaevsky. Sein Vorgänger ist aufgrund notorischer Treulosigkeit längst abserviert. Nach zwei gemeinsamen Kindern hat Bronislawa Fominichna Nijinska, von Vertrauten nur «Bronia» genannt, sozusagen die Notbremse gezogen. Das Drama des Verlassenwerdens will sie nicht noch einmal erleben.
Zwischen den beiden Hochzeiten Nijinskas hat noch eine Vermählung stattgefunden, die weltweit Schlagzeilen produzierte und ihr Dasein unmittelbar beeinflusst: Bruder Vaslav Nijinski, schon fast auf dem Olymp der unsterblichen Tanz-Götter ansässig, schliesst 1914 in Buenos Aires die Ehe mit einer gewissen Romula de Pulszky und katapultiert sich damit endgültig aus dem Diaghilew-Kosmos hinaus. Der Impresario, zugleich Nijinskis Mentor und Liebhaber, schickt ihm die Kündigung (gleichsam wie Scheidungspapiere) hinterher. Aber wo Vaslav nicht ist, kann auch Bronia nicht bleiben: Die Tänzerin steigt vorerst aus bei den Ballets Russes – ein weiterer Akt der Loyalität, die sie dem Bruder von Kindesbeinen an entgegenbringt. Das geht so, seit sie mit ihm die Ballettschule des Zaren in Sankt Petersburg besucht hat, 1909 mit ihm ans Mariinsky wechselte, dann zu Diaghilew. Und es hört auch nicht auf, als er ihr 1913 einen Tiefschlag versetzt: Nijinski verbannt seine schwangere Schwester aus der Rolle der Auserwählten im «Frühlingsopfer». Nicht ohne sie zu verpflichten, das gemeinsam erarbeitete Bewegungsmaterial an die Kollegin Maria Piltz weiterzugeben. Es ist das Fundament jenes Traditionsbruchs, der sich schon bald nach dem Premierenskandal in einen historischen Triumph verwandelt.
Man stelle sich rein spekulativ die seitenverkehrte Konstellation vor: Bronislawa als Jahrhundertballerina und revolutionäre Choreografin, die in Vaslav einen frühen Mitstreiter, Co-Entwickler und Interpreten findet. Mag ihm später auch Fantastisches gelingen, so muss er sich doch stets und ständig gegen den Schatten schwesterlicher Geniestreiche behaupten. Das Schicksal hat andersherum disponiert, und die polare Geschlechterordnung war behilflich dabei. Also gilt der seit 1917 im Kerker der Geisteskrankheit gefangene Nijinski, der mit nur drei Werken – L’Après-midi d’un faune, Jeux und Le Sacre du printemps – ins Pantheon des Tanzes einging, als Pionier der Moderne. Während sein jüngeres Geschwister über sechzig Werke geschaffen hat, darunter frühe Exemplare der Neoklassik. Deren Erfindung, wie könnte es anders sein, die Geschichte natürlich einem Mann ans Revers heften wird. Einem Herrn namens George Balanchine.
Egal, aus welcher Perspektive man sich annähert, Madame Nijinska erweist sich als eminent spannende und bisweilen spannungsreiche Person, als sprühende Denkerin und ingeniöse Künstlerin, die sich nie um Konventionen scherte. Dass sie trotzdem aus den Annalen des Tanzes irgendwie herausfiel und ihr Name sich mit keiner Handvoll Kreationen verbindet, darf getrost dem Patriarchat angelastet werden, das auch gay people wie Maestro Diaghilew nicht auszuhebeln gedachten. Jetzt aber, über ein halbes Jahrhundert nach ihrem Tod, steht diese Frau im Scheinwerferlicht: dank einer voluminösen Biografie, die Lynn Garafola ihr gewidmet hat, Hand in Hand mit der Wiederentdeckung ihrer Werke, die von London über New York bis Zürich eine Renaissance erleben. Das gilt zumindest für Les Noces, genau wie Les Biches und Le Train bleu, einst von Diaghilew produziert. Wobei das streng formalisierte, ursprünglich Svadebka betitelte Hochzeitsritual, das Zürichs neue Ballettchefin Cathy Marston aufs Programm gesetzt hat, mit dem Leben der Choreografin gleich mehrfach eng verflochten scheint: Der Schauplatz ist Russland, der Inhalt eine Heiratszeremonie samt Vor- und Nachlauf, der Komponist heisst Igor Strawinsky, und die Idee zu Les Noces wurde schon 1913 geboren – im selben Jahr, in dem Bronislawa mit Tochter Irina schwanger ist und deshalb auf Le Sacre du printemps verzichten muss. Was sie viele Tränen kostet.
Alles andere als heiter kommt auch Les Noces daher: ein schwermütiges und schwerblütiges Stück, dessen Choreografie Diaghilew der Nijinska im März 1922 anbietet. Es steht seit Jahren auf seiner To-do-Liste, jetzt soll es zudem das Finanzloch stopfen, das ein sündteures Dornröschen-Revival gerade erst ins Budget gerissen hat. Übrigens war bei diesem Fiasko auch die gerade zurückgekehrte Nijinska mit von der Partie, in doppelter Mission: Einerseits als Tänzerin, andererseits als choreografische Debütantin bei den Ballets Russes, hatte sie doch die Matrix des Petipa-Originals einstudiert und ergänzt.
Was eigentlich nicht mehr ihre Kragenweite ist. Während der Welt- und Nachkriegsjahre in Russland und Kiew hat Nijinska nicht nur eine Schule gegründet und erste Choreografien entwickelt, sondern sich auch auf Distanz zur Danse d’école gebracht. Neuerdings als «Amazone der Avantgarde» unterwegs, wie ihre Biografin Lynn Garafola festhält, rechnet sie 1918 mit dem Status quo auch am Mariinsky ab: «Die Tanzkunst ist keine Kunst mehr, sondern Akrobatik … aller Ausdruck dahin.» Von den Barfuss-Exerzitien einer Isadora Duncan will die knapp Dreissigjährige allerdings auch nichts wissen, ihr grosses Ideal ist: die Malerei. Was ihr vorschwebt, ist eine Art Polyphonie zu erzeugen. Dafür müsse man, wie sie schreibt, «die Bewegung wie die Zeichnung, wie die Farben verwenden».
Gerade so verhält es sich mit Les Noces. In Strawinskys Studio lässt sich Nijinska die Komposition auf dem Flügel vorspielen und erkennt sofort «meine choreografische Linie für das Ballett». Das Dekor, das Natalia Gontcharova bereits entworfen hat, findet sie «prächtig, theatralisch und sehr russisch» – aber untauglich. Ein Jahr lang streitet sie mit Diaghilew um die Ausstattung, weil «der heitere Geist konventioneller Bauernfolklore» überhaupt nicht zu Strawinskys Partitur passt. Denn worum geht es? Les Noces verhandelt eine arrangierte Heirat und das ganze gesellschaftliche Drumherum. Es hat, sagt Nijinska später, «den Charakter einer Tragödie. Würde man das Libretto als fröhliches Treiben russischer Bauern vor malerischem Hintergrund interpretieren, würde die Tragödie zunichte gemacht.»
In den Online-Kollektionen der Library of Congress wie der französischen Nationalbibliothek gibt es Fotos der Proben, aufgenommen auf dem Dach der Oper von Monte-Carlo. Schon diese Bilder lassen den Zuschnitt der Choreografie erkennen: Geometrisch gefasste Kollektive, die im nächsten Moment von einer Bewegungswoge erfasst zu werden scheinen, zu Kreisen, Dreiecken und Vektoren sortierte Arme, Menschenknäuel und Körperpyramiden, die sich wie organische Plastiken türmen – eine kristalline und zugleich jugendstilhafte Ornamentik, deren Silhouette die schwarzweissen Kostüme noch unterstreichen. Das chorische Element spiegelt die vierteilige Handlung, die Strawinsky als Hybrid aus Gesang und Orchesterklang angelegt hat. Auf die Hochzeitsvorbereitungen der Braut folgen diejenigen des Bräutigams, sodann der Abschied des Mädchens von seinen Eltern und das Zeremoniell der Verehelichung, das mit dem Gang der frisch Vermählten ins Schlafzimmer endet. Während die getanzten Solopassagen sich deutlich vom Corps de ballet abheben, bleiben die Gesangspartien ohne eindeutige Zuweisung. Die Texte aus der Feder Strawinskys zitieren russisches Brauchtum und eine Sammlung einschlägiger Gedichte.
Bis zur Uraufführung dieser «Ballett-Kantate» muss die Choreografin etliche Krisen überstehen, ein Streik des Ensembles wegen schlechter Bezahlung kann gerade noch abgewendet werden. Als sich am 13. Juni 1923 endlich der Vorhang im Pariser Théâtre de la Gaîté-Lyrique für Les Noces hebt, fühlen sich nicht wenige Kritiker an den Abend der Sacre-Premiere erinnert: Sind sie nicht heimliche Zwillinge, die Auserwählte des Frühlingsopfers und diese Braut, die sich in ein vereinbartes Bündnis fügen und dem Ehemann samt seiner Familie unterwerfen muss? Und ist die Choreografie nicht ein weiterer Schritt Richtung Moderne? Zwar tauchen durchaus traditionelle Ingredienzen auf, etwa Spitzenschuh, Sprungarbeit, das eine oder andere Port de bras. Aber wagemutig sprengt Nijinska das Korsett des Akademischen. Wo Strawinskys Komposition einem Kritikervotum nach als «unerbittliche, turbulente und präzise Klangfabrik» imponiert, wird die Choreografie als «pure Emotion, die uns überwältigt» und «raffinierte Kunst» gefeiert. «Diese Hochzeit ist das Trauerlied der traurigsten Menschheit», resümiert der Rezensent Louis Schneider, sein Kollege Emile Vuillermoz meint: «Vor uns demontiert die Choreografie Stück für Stück die Maschinerie von Familie und Zivilisation. Es ist ein schreckliches und unvergessliches Schauspiel.»
Das zeitgenössische Echo fällt fast durchweg positiv aus. Ein Omen, denn bald gilt Les Noces als Diaghilews grösster künstlerischer Erfolg in den Zwanzigerjahren – und als Nijinskas Signaturstück. Doch wer weiss, was daraus geworden wäre, hätte nicht Frederick Ashton 1966 eine Wiederauflage mit dem Royal Ballet angesetzt. Nijinska kam, sah und siegte nun auch in London. Sechs Jahre später starb sie in Kalifornien. Da waren Diaghilew und Vaslav, waren ihr Söhnchen, ihre Mutter und ihre beiden Ehemänner schon lange tot. La Nijinska aber blieb bis zuletzt eine Freibeuterin, eine hochbegabte Frau, wegweisende Choreografin, die kein Abenteuer scheute und in Europa wie in den USA Spuren hinterliess – und Grenzen überschritt. 1922 war sie in die Rolle geschlüpft, die ihr Bruder sich selbst auf den Leib geschrieben hatte: den Faun – transident und transgressiv. Getreu der Maxime, die sie 1918 zu Papier gebracht hatte: «Wenn Kreativität mir ein Bedürfnis ist, dann ist sie auch mein Glück.»
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 107, Dezember 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Hintergrund

Die Fliegerin
Weite geografische Wege und grosse künstlerische Bögen spannen sich über das Leben und die Arbeit der australischen Choreografin Meryl Tankard. Angefangen hat sie als Tänzerin bei Pina Bausch in Wuppertal, ihre Heimat ist bis heute Australien. Jetzt kreiert sie für das Ballett Zürich George Antheils «Ballet mécanique». Ein Porträt von Arnd Weseman.
Natalia Osiopova ist eine legendäre Solistin des Londoner Royal Ballet. Als sie 2019 in Meryl Tankards Solo Two Feet auf die Bühne ging, sorgte diese Kombination von Solistin und Choreografin, Osiopova und Tankard, rund um die Erde für restlos gefüllte Häuser. Dann kamen Covid und Kairos, Meryl Tankards jüngstes Bühnenwerk und vielleicht bemerkenswerteste Abrechnung mit der Pandemie: Eine Frau liegt am Boden wie in einem Fadenkreuz in Erwartung der Bombe. Ein Stück, das von Umweltzerstörung bis Black Lives Matter mit allem abrechnet, was der Mensch dem Menschen antut. Ob Two Feet oder Kairos – wenn Meryl Tankards Stücke touren, braucht es ein Flugzeug, denn Australien ist weit, sehr weit weg. Vor allem von Europa aus gesehen. Ausgerechnet da aber wollte Meryl Tankard immer hin.
Getanzt hatte sie einst am Australian Ballet. Anne Woolliams, John Crankos Ballettmeisterin zu dessen Lebzeiten in Stuttgart, war 1976/77 die Direktorin dort. Sie riet ihr: «Meryl, du musst choreografieren.» Bei einem Wettbewerb gewann die damals 23-Jährige tausend Dollar Preisgeld und flog nach Paris. Endlich Europa. Sie erfuhr, so erzählt sie es heute, von einer «ganz kleinen Stadt mit zwei P und einem W davor». Meryl Tankard wurde Teil des Tanztheaters Wuppertal – als eine Australierin neben zwei anderen: Jo Ann Endicott und Julie Shanahan. «Keine Ahnung, was Pina an Australierinnen so faszinierte. Waren wir wirklich frecher, freier, offener? Ich war ein junges Mädchen vom Ballett, und musste mich dafür auf der Bühne ohrfeigen lassen.»
Derlei Pointen setzt Meryl Tankard im Gespräch gern und wie nebenbei. Sechs Jahre lang, bis 1984, tanzte sie bei Pina Bausch in deren berühmten Stücken Café Müller, Kontakthof, Walzer, Keuschheitslegende, Arien, Bandoneon und 1980. Nach einem Pina-Bausch-Gastspiel in Adelaide kündigte Tankard, blieb dem Tanztheater jedoch weiter als Gast verbunden. Heute New York, morgen Kolkata, jeden Tag eine neue Anekdote. Und endlose Flugmeilen. 1989 gründete sie ihre eigene Compagnie in Canberra, von 1993 an leitete sie sechs Jahre lang das Australian Dance Theatre in Adelaide. Dann der Bruch: Sie sollte ihre Tanzkunst durch die australische Provinz schicken, dorthin, wo Bühnen teuer angemietet werden mussten. Zeitgleich hatte Tankard das gut dotierte Angebot, mit ihrer Compagnie nach Japan zu fliegen, um dort eine ganze Serie von Aufführungen zu zeigen. Der mit Politikern besetzte Verwaltungsrat war dagegen. Ihr wurde gekündigt, weil sie international gefragt war. Es brach ihr fast das Herz.
Die Olympischen Spiele 2000 in Sidney waren dann so etwas wie eine Wiedergutmachung. Tankard war als Choreografin für die Eröffnungsfeier engagiert und verwandelte das Stadion in ein gigantisches Tiefseeaquarium mit riesigen Fischen, gebildet aus Schwärmen von Tanzenden. Am Strand in der Nähe von Sidney wurde sie damals von einem französischen Fotografen namens Régis Lansac im weissen Kleid vor rauer See fotografiert. Es war der Beginn einer lebenslangen Liebe. Lansac fliegt seither immer mit, ist der unverzichtbare Autor ihrer Bühnenbilder aus opulenten Projektionen, etwa in ihrem von Nijinsky inspirierten Sacre-Solo für Paul White, diesem tanzenden Kraftpaket. Um ihn herum feierten 2009 Lansacs Spiegel-Anamorphosen seinen Körper. The Oracle hiess das starke Werk. Auch in Zürich, für Ballet mécanique, die Tanzkreation, die am 20. Januar 2024 uraufgeführt wird, ist Régis Lansac mit von der Partie. «Antiquarisch fand er ein Buch aus dem 19. Jahrhundert mit Illustrationen von Nervenzellen, die ihn dazu inspirierten, sie auf eine wie ein Origami gefaltete Wand grafisch zu projizieren», sagt Meryl Tankard.
Seit Ende November sind Tankard und Lansac einem anderen Paar auf der Spur – der frühen Kino-Ikone Hedy Lamarr und dem Komponisten und Pianisten George Antheil. Die österreichisch-amerikanische Filmschauspielerin war Ende der dreissiger Jahre des 20. Jahrhunderts ein Hollywood-Star, Antheil zur gleichen Zeit ein international beachteter Skandalkünstler mit avantgardistischen Ideen. Antheil schuf die Musik zu einem der ersten abstrakten Filme überhaupt, dem Ballet mécanique des Bildenden Künstlers Fernand Léger. Antheil liess den Film von sechzehn mechanischen Klavieren begleiten, fand aber keine Lösung, die Klaviere mit dem Film und untereinander zu synchronisieren. Die Lösung lieferte ihm Hedy Lamarr, die auch Erfinderin war, mit Hilfe von Lochkarten, mit denen sie im Zweiten Weltkrieg noch einmal für Furore sorgte, als es ihr mit einer Weiterentwicklung der Lochkartentechnik gelang, amerikanische Torpedos im Seekrieg gegen Deutschland abhörsicher zu steuern. Sechzehn mechanische Klaviere werden in Tankards Zürcher Ballet mécanique freilich nicht zu hören sein, auch nicht die elektrischen Klingeln, Flugzeugpropeller, Trommeln und Sirenen, um die Antheil sein Werk ergänzte. Aber der genial-spielerische Umgang mit der damals neuen Technologie ist ganz im Sinn von Meryl Tankard.
Sie liebt die Freiheit, die Luft, die Weite, die Welt. So begann auch ihre künstlerische Entwicklung: mit Furioso (1993) und Possessed (1995), zwei Aerial-Choreografien. Die Tänzer jagten in Seilen wie Geschosse durch den Raum, im klassischen Ordo, als habe sich der Traum von der Schwerelosigkeit erst in diesem zeitgenössischen Geschirr erfüllt. Inuk (1997) spielte auf einer projizierten Startbahn, in Wild Swans (2003) flog am Seil ein ganzer Schwanensee auf. Entscheidend für Tankard ist die Perspektive: die von oben, die kosmopolitische, die vom Ende der Welt her und die über den Wolken. Am Ballett Leipzig setzte sie 2013 für Cinderella ihr Aschenputtel ins Flugzeug, Economy Class, während ihre bösen Halbschwestern vom Shopping aus Singapur in der Business Class zurückflogen. Am Ende des Balletts hat Aschenputtel ihren asiatischen Märchenprinzen gefunden. Die beiden geniessen First-Class-Service und die Halbschwestern servieren Champagner – als Stewardessen. Natürlich kam Tankard diese Idee auf einem ihrer Langstreckenflüge. Dass ihr Prinz ein Asiate ist, wirkt nur auf Europäer exotisch. Denn der weisse Mann ist nicht mehr der Fürst der Welt angesichts des Reichtums in Shanghai, Tokio, Taipeh oder Singapur. Aus australischer Sicht ist Asien der grosse Markt vor der Haustür; an den Universitäten des Landes studieren mehrheitlich Asiaten, «auch sie sind auf der Flucht von Zuhause».
Von Australien aus wirkt Europa sehr fern, marginal, exotisch und deshalb anziehend. Asien ergötzt sich an westlicher Kultur. Sie ist das Fremde, das man sich aneignet. «Das war in Europa auch mal so», sagt Meryl Tankard, «als alle loszogen nach Indien, Afghanistan oder Bali. Je weiter weg, desto besser.» Es war die gar nicht so ferne Zeit, als Europa den Buddhismus entdeckte und friedensbewegt an eine «One World» glaubte.
Genau dafür wurde Meryl Tankards Tanzkunst anfangs gefeiert: für die indigenen Tänze in Nuti (1990), den indischen Kuchipudi mit Padma Menon in Rasa (1996), für die hoch disziplinierten, energiereichen japanischen Taikoz-Trommler in Kaidan (2007). Meryl Tankard war von fremden Tänzen fasziniert. Aber ihr Ansinnen wurde von den Festivals bald ignoriert: Die kritische Frage nach «Appropriation», nach kultureller Aneignung fremden Kulturguts, wurde zu einem viel diskutierten Thema und hat einen bitteren Beigeschmack. Umgekehrt Shakespeare und John Neumeier zu geniessen, klassisches Ballett und amerikanischen Tanz, gehörte auch in Asien lange zur Distinktion. Das ist ebenfalls vorbei. «Weil Europa so geschichtsbesessen ist, will nun auch Asien seine Tradition möglichst rein halten», sagt Tankard.
Nur in Australien gilt weiterhin: «Wir achten die Künste nicht, weil wir keine Geschichte haben», die der Aborigines ausgenommen. «In Australien sind wir mehr darauf erpicht, den ganzen Kontinent in einen Sportplatz zu verwandeln, als uns einer Kunstform hinzugeben. Bei uns gibt es diesen unerhörten Spieltrieb, der dem konkurrierenden Wetteifer der Asiaten in nichts nachsteht. Ich glaube», sagt Tankard, «unsere spielerische Art hat einen Vorteil».
Spielen ist das genaue Gegenteil der ständigen Selbstvergewisserung im Namen einer Tradition. Das gilt auch für ihre Tanzkunst. Spielen ist für Tankard wahrhaft zeitgenössisch: Das Spielen etwa mit traditionellen Balletten wie Orphée et Eurydice in Sidney (1993) – es wurde ein Sportstück – oder Petrushka am Nederlands Dans Theater (2004) – es wurde ein Schattenspiel: «Jede Tradition ist immer nur das, was weitergegeben wird», sagt sie, «doch immer vergisst man etwas davon, oder erfindet etwas hinzu, von dem man glaubte, es sei so gewesen. Da kann man doch gleich mit diesem Material einfach spielen». Spielen ist für Meryl Tankard gleichbedeutend mit dem Lerneifer, andere Welten zu studieren und sich der Erfahrung des Fremden auszusetzen. Sie erfuhr das schon als Kind, als Tochter eines Luftwaffen-Offiziers, der zeitweilig in Malaysia stationiert war, in dieser ungeheuren Buntheit der dortigen Kulturen, mit Männern, die sich mit Speeren durchbohren, mit Frauen, die eine Scheinbeerdigung zelebrieren, um die Geister zu ärgern – «All das habe ich als Kind in mich aufgesogen. Nur bei Pina habe ich irgendwann nichts mehr gelernt. Es war wie in einem Kokon.» Pina ging in die Welt und holte alles heim ins Tanztheater Wuppertal. Wie eine deutsche Touristin, die zuhause ihre Mitbringsel zeigt. «Ich wollte das Gegenteil: mich in die Welt werfen.»
Und sie warf sich noch einmal hinein. Bis 2010 studierte die damals 56-Jährige an der Australischen Film-, Fernseh- und Radioakademie. Ihr Abschluss: der Kurzfilm Moth (Motte). Auf Cockatoo Island, einer Insel im Hafen Sidneys, befand sich bis in die 1970er-Jahre hinein eine Besserungsanstalt für junge Mädchen, die ein «unstetes Leben» führten. Tankards Film porträtierte drei von ihnen, die es kurzzeitig schaffen, von der Insel zu fliehen und ihre Albträume aus rigiden Erziehungsmethoden und Demütigungen – zu tanzen. Von ihren Lehrern bekam sie den Rat, «niemals Tanz im Film zu benutzen.» Er erzeuge zu viel unkontrollierte Energie und verschleiere den Blick auf den Menschen. Aha. Tankards Film Michelle’s Story über eine an Multipler Sklerose erkrankte Tänzerin wurde zuletzt mit Preisen geradezu überhäuft. Und schon lange vorher, mit Sydney an der Wupper, räumte sie 1983 in Berlin einen Silbernen Bären ab. Sie liebt die Präzision der Kameraführung und die bei der Postproduktion, die technische Finesse aus Farbtemperaturen und Kamerabewegung. Nicht, dass nicht auch der Tanz genau davon lebt. Aber warum Filmkunst? Meryl Tankard zögert keinen Moment mit der Antwort: «Um den Menschen in die Augen schauen zu können. Im Ballett ist das unmöglich.»
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 107, Dezember 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren
Interview

Der Newcomer
Der aus Südafrika stammende Choreograf Mthuthuzeli November arbeitet erstmals mit dem Ballett Zürich. Er choreografiert zu George Gershwins «Rhapsody in Blue». Ein Gespräch über Türen in kreative Räume, die sich gerade öffnen, und die Erfahrungen seiner Herkunft, die er überall mitnimmt.
Mthuthu, kurz bevor du erstmals mit dem Ballett Zürich arbeiten wirst, treffen wir uns zu diesem Gespräch in London. Hier choreografierst du gerade ein neues Stück für das Royal Ballet, und gleichzeitig gastierst du mit dem Ballet Black auch im Linbury Theater am Royal Opera House. Was muss man über das Ballet Black wissen?
Das Ballet Black ist eine in London beheimatete Tanzcompagnie. 2001 wurde sie von Cassa Pancho gegründet, die das Ensemble bis heute leitet. Ihre Idee war es, schwarzen und asiatischen Tänzerinnen und Tänzern ein Zuhause zu geben. Unser Repertoire bewegt sich zwischen klassischem Ballett und zeitgenössischem Tanz. Und so vielseitig wie das Repertoire ist auch das Publikum. Es geht quer durch alle Altersgruppen und Schichten und widerlegt die Behauptung, dass Ballett nur ein weisses Publikum mittleren Alters aus der Mittelklasse anspricht.
Was bedeutet es für dich, für diese Compagnie zu tanzen und zu choreografieren?
Es ist ein grossartiges Gefühl, Tänzer im Ballet Black zu sein. Hier bin ich unter Gleichgesinnten, fühle mich zu Hause und integriert. Ich tanze mit meinen Freunden. Dass ich für diese Compagnie auch choreografieren darf, ist ein grosses Geschenk.
Dein aktuelles Stück für das Ballet Black heisst Nina: By whatever means. Angekündigt wird es als Brief an die grosse US-amerikanische Soul-Sängerin und Bürgerrechtsaktivistin Nina Simone. Was steht da drin?
Um es ganz kurz zu machen: «Ich liebe dich!» und: «Ich bewundere den Weg, den du gegangen bist!» Am Anfang habe ich mich gefragt, was ich zu Nina Simone gesagt hätte, wenn ich die Chance bekommen hätte, sie zu treffen. Ihr Leben hat viel gemeinsam mit dem Leben schwarzer Balletttänzerinnen und -tänzer. Viele haben die Hoffnung, eine Karriere als klassische Tänzer zu machen, und erleben dann, dass sie in Schubladen gesteckt werden, auf denen «Afrikanischer Tanz» oder «Modern Dance» steht. Dass ein schwarzer Körper klassisches Ballett tanzen kann, liegt oft immer noch ausserhalb des Vorstellungsvermögens. Das hat einige Verbindungen zur Geschichte von Nina Simone. Sie wollte klassische Pianistin werden, und dann wurde sie dazu gedrängt, Jazz zu spielen, was sie zunächst gar nicht wollte.
Zum ersten Mal wirst du nun beim Ballett Zürich choreografieren in einem dreiteiligen Ballettabend, der den Titel Timekeepers trägt. Was hast du für ein Verhältnis zur Zeit, welche Rolle spielt sie in deinem Leben?
Kurz vor unserem Gespräch habe ich mich mit einem guten Freund über die Zeit unterhalten, in der wir als schwarze kreative Künstler leben. Dass wir auch im Jahr 2023 immer noch zu den ersten gehören, die eine Art von «Creative Spaces» betreten, die uns lange verschlossen waren. Das bringt eine grosse Verantwortung mit sich, damit sich diese Räume in Zukunft für noch mehr Menschen öffnen, die so aussehen wie ich. Ich möchte so viel von mir mit anderen Menschen teilen und sie inspirieren. Deshalb bin ich glücklich über die Chance, bei Timekeepers dabei zu sein. Soviel ich weiss, bin ich der erste schwarze Choreograf aus Südafrika, der mit dem Ballett Zürich arbeitet.
Welche Dinge möchtest du teilen und weitergeben?
Vor allem Liebe und Offenheit. Und die Bereitschaft, sich über Schubladen hinwegzusetzen. Ich bin jemand, der seine Herkunft nicht verleugnet und seine Kultur überallhin mitnimmt. Es beschäftigt mich unentwegt, wie ich meine Kultur weitergeben und mit anderen Menschen teilen kann. Ich habe das Glück, dass ich mich durch den Tanz ausdrücken kann. Ich möchte verstehen, wer die Tänzerinnen und Tänzer sind, mit denen ich arbeite. Woher kommen sie, welches Umfeld hat sie geprägt? Dieser Austausch lässt ein Vertrauensverhältnis entstehen und ist eine wichtige Grundlage meiner Arbeit.
Dein Leben hat sich in kürzester Zeit radikal verändert. Du stammst aus einem Township in der Nähe von Kapstadt. Unter welchen Bedingungen bist du dort aufgewachsen?
Vor allem habe ich Fussball gespielt in einer staubigen Umgebung und meistens auf einem Spielfeld ohne Rasen. Aber das war völlig egal! Beim Fussballspielen – und später auch beim Tanzen – konnte ich alles um mich herum vergessen. Konnte vergessen, dass ich aus einer armen Familie stamme, die oft nicht wusste, wie sie über die Runden kommen soll und ob abends etwas zu essen auf dem Tisch steht. Mit drei Brüdern und einer Schwester bin ich bei meiner Mutter in sehr beengten Verhältnissen aufgewachsen, und das war schwierig. Allerdings habe ich mir nie gewünscht, ich käme aus einer reichen Umgebung. Denn das, was ich bin, hat mich im Leben angetrieben und mir die Leidenschaft und die Entschlossenheit gegeben, die ich heute habe. Beim Choreografieren denke ich oft daran, wie sich das damals angefühlt hat. Dann weiss ich mein neues Leben umso mehr zu schätzen.
Stimmt es, dass die Familie November als eine Art Tanz-Clan berühmt war?
Solange ich denken kann, haben wir in meiner Familie getanzt. Das war vor allem traditioneller afrikanischer Tanz oder Street Dance. Ich war fünfzehn, als ich erstmals mit dem Ballett in Berührung gekommen war. Das war 2008, damals bot eine Organisation namens «Dance For All» kostenlose Tanzstunden und Outreach-Programme an. Ich habe sehr schnell erkannt, dass Ballett vielleicht ein Weg sein könnte, der mich aus der Armut herausführt und mir ein anderes Leben ermöglicht. Ich weiss noch, wie ich das erste Mal vom Ballettunterricht kam und eine Strumpfhose trug, und alle fragten: «Was hast du denn da an?». Für meine Umgebung war das erst einmal ein Schock. Keiner hatte ja eine Ahnung davon, was Ballett ist und welches Potential es in sich trägt. Nach Meinung meiner Freunde war Ballett nur etwas für Weisse. Für mich war es einfach nur Tanz, und auch jetzt gerade, wo ich für das Ballett Zürich choreografiere, verstehe ich mich als Dance-Maker.
Wie reagieren denn die Leute aus der klassischen Welt des Balletts auf dich? Bist du für sie der Typ von einem anderen Stern?
Ich versuche, ihnen als Mensch zu begegnen, mit dem Background all der Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Bevor ich mich darum kümmere, ob mein Gegenüber nun ein klassischer Tänzer oder ein contemporary dancer ist, versuche ich, ihn als Menschen zu sehen. Erst dann entscheidet sich, in welche Richtung unsere gemeinsame Reise gehen kann. Wenn ich ins Studio gehe, versuche ich, die Tänzerinnen und Tänzer, die mit mir arbeiten, daran zu erinnern, warum sie das tun, was sie tun. Ich frage jeden Einzelnen im Raum, wie es ihm geht, und versuche, mir noch vor Beginn der eigentlichen Proben Zeit für jede und jeden zu nehmen. Das beginnt meist sehr spielerisch. Oft spielen wir eine ganze Weile, ehe wir mit der Arbeit an der eigentlichen Choreografie beginnen. Ja, wir sind tatsächlich alle Spielkameraden. In diesen Spielen entsteht ein gegenseitiges Vertrauen, das für mich als spätere Arbeitsgrundlage unverzichtbar ist. Die Zeit vergeht schneller, wenn man gemeinsam Spass an der Arbeit hat.
Nach Abschluss deiner Tanzausbildung an der Cape Dance Academy bist du 2015 nach England gegangen. Wie hat sich das angefühlt?
Vom Naturell her bin ich jemand, der die Dinge nicht zu sehr analysiert oder in Frage stellt. Ich versuche einfach, mein Ding zu machen. Aber dieser Ortswechsel war natürlich ein Rieseneinschnitt. England ist sehr effizient! Ich musste mich daran gewöhnen, dass hier ein anderes Tempo vorgelegt wird und alles viel, viel schneller geht. Begeistert hat mich, dass man hier so viele unterschiedliche Arten von Tanz erleben und die verrücktesten Leute treffen kann. Englisch ist nicht meine Muttersprache, und so musste ich erst einmal lernen, mich richtig auszudrücken. Aber dabei bin auch viel selbstbewusster geworden.
Wie bist du zum Choreografieren gekommen?
Ehrlich gesagt, glaube ich, dass ich schon immer ein Choreograf war. Street Dance erfordert ein hohes Mass an geistiger Flexibilität. Ich musste mir ständig neue Schritte und Bewegungen ausdenken. Stundenlang habe ich das gemacht, und wenn es gut war, haben mir die Leute ein bisschen Geld in den Hut geworfen. Natürlich habe ich das nicht als eine berufliche Perspektive gesehen. Das kam erst viel später. Meine Art zu choreografieren ist wesentlich von den Menschen geprägt worden, denen ich auf meinem Weg begegnet bin. Gerade hat das Royal Ballet hier in London noch einmal Cathy Marstons The Cellist getanzt. Über die Art und Weise des Geschichtenerzählens habe ich viel von ihr gelernt. Aber auch andere Choreografinnen und Choreografen haben mich beeinflusst in ihrer Art, wie sie kommunizieren, wie sie über Bewegung denken oder einen Raum nutzen.
Die afrikanische Stimme in deinen Arbeiten ist unüberhörbar. Doch während der afrikanische Tanz sehr geerdet und mit einer gewissen Schwere verbunden ist, macht das Ballett das genaue Gegenteil: Es strebt die Leichtigkeit an, ist «nach oben» gerichtet. Wie bringst du beides zusammen?
Ich glaube, selbst als Vogel muss man irgendwann landen und auf den Boden zurückkehren. Das ist genau der Moment, der mich interessiert. Wenn du aus der Feenwelt des Balletts wieder in der Realität ankommst. Wichtig ist mir besonders das spirituelle Element, das der afrikanische Tanz beinhaltet. In der Gegend, aus der ich komme, ist der Tanz sehr stark vom Rhythmus geprägt und sehr perkussiv. Dieses perkussive Element versuche ich, für den Körperausdruck nutzbar zu machen. Meine Zusammenarbeit mit dem Ballett Zürich ist aufregend, denn normalerweise komponiere und arrangiere ich die Musik selbst, zu der ich choreografiere. Da kann ich selbst entscheiden, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Jetzt treffe ich mit George Gershwins Rhapsody in Blue auf eine existierende Komposition, deren Ablauf ich nicht beeinflussen kann und der ich komplett ausgeliefert bin.
Welche Assoziationen löst Gershwins Musik in dir aus?
Dass die Uraufführung 1924, also vor gut einhundert Jahren, stattgefunden hat, wollte ich beim ersten Hören kaum glauben. Das Stück wirkt auf mich sehr modern und ist bei einer Dauer von gerade mal fünfzehn Minuten äusserst komplex. Ich bin immer wieder fasziniert von den unerwarteten Wendungen, die die Komposition an vielen Stellen nimmt, aber auch die sanften Passagen mag ich sehr. In einer Viertelstunde kann man da sicher eine ganze Menge herausholen. Die Herausforderung besteht darin, mich selbst in der Komposition wiederzufinden und Inspiration aus ihr zu gewinnen. Ich bin wirklich gespannt darauf, ins Studio zu gehen und zu sehen, wie die Tänzerinnen und Tänzer mich und die Musik aufnehmen werden. Eine zusätzliche Herausforderung ist, dass wir Gershwins sehr fokussierte Version für zwei Klaviere verwenden. Mal sehen, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben.
Siehst du schon offene choreografische Türen zu dieser Partitur?
Ganz viele sogar!
Heute wird Rhapsody in Blue als grosse musikalische Hommage an den brodelnden Kosmos New Yorks in den 1920-er Jahren interpretiert. Gibt dir der Tanz die Möglichkeit, diese Musik anderswo zu verorten?
Dass ICH zu dieser Musik choreografiere, gibt dir wahrscheinlich schon die Antwort auf deine Frage (lacht). Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich als junger schwarzer Mann aus Südafrika einmal Rhapsody in Blue choreografieren würde. Da werden sich also zwei Welten begegnen, und wer weiss: Vielleicht wird es eine Cape Town Rhapsody? Auf jeden Fall eine mit einem grossen Schuss Südafrika.
Inzwischen klopfen immer mehr renommierte Compagnien bei dir an, um neue Choreografien zu bestellen. Hast du nicht Angst, dass das gerade alles ein bisschen zu schnell geht?
Ich hoffe, dass ich bei all den Möglichkeiten, die sich gerade bieten, immer Menschen in meiner Nähe habe, die mir Halt geben und mich daran erinnern, wer ich bin und was ich tun musste, um dort zu sein, wo ich bin. Ich will auf dem Boden bleiben und weiss doch, dass ich all diese neuen Räume, die sich gerade auftun, betreten muss. Nicht für mich, sondern für all die Talente, die es in Südafrika und an vielen anderen Orten auf der Welt gibt. Damit sie wissen, dass sie eines Tages an eben diesen Plätzen sein werden und dass das absolut in Ordnung ist.
Das Gespräch führte Michael Küster.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 107, Dezember 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Fotogalerie
Ich sage es mal so
Stumme Antworten auf grundsätzliche Fragen – mit Shelby Williams, die seit dieser Spielzeit Solistin beim Ballett Zürich ist.Ich sage es mal so ist eine Interviewform in unserem MAG, in der Künstlerinnen und Künstler des Opernhauses - nach einer Idee des SZ-Magazins - in Form eines Fotoshootings Auskunft über sich geben