Petruschka
Petruschka / Sacre
Choreografien von Marco Goecke und Edward Clug.
Musik von Igor Strawinsky (1882-1971)
Dauer 1 Std. 40 Min. inkl. Pause nach dem 1. Teil nach ca. 35 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Partnerin Ballett Zürich 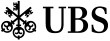
Vergangene Termine
März 2018
14
Mär19.30
Petruschka / Sacre
Choreografien von Marco Goecke und Edward Clug. Musik von Igor Strawinsky, Mittwoch-Abo B
22
Mär19.00
Petruschka / Sacre
Choreografien von Marco Goecke und Edward Clug. Musik von Igor Strawinsky, Donnerstag-Abo A
April 2018
02
Apr14.00
Petruschka / Sacre
Choreografien von Marco Goecke und Edward Clug. Musik von Igor Strawinsky, Sonntag-Abo A
Petruschka / Sacre
Choreografien von Marco Goecke und Edward Clug. Musik von Igor Strawinsky, AMAG Volksvorstellung
Gut zu wissen
Petruschka / Sacre
Kurzgefasst
Petruschka / Sacre
Vom russischen Impresario Sergej Diaghilew gegründet, läuteten in Paris vor gut 100 Jahren die Ballets russes die Moderne in der Tanzkunst ein. Mit seinen Balletten Petruschka und Le Sacre du printemps eröffnete der junge Igor Strawinsky dem Tanz neue musikalische Horizonte. Unser Ballettabend kombiniert aufregende Neudeutungen dieser wegweisenden Stücke von zwei der gefragtesten Choreografen unserer Tage.
In Petruschka werden die drei Puppen eines Gauklers zu unheimlichem Leben erweckt. Der sensible, unansehnliche Harlekin Petruschka verfällt der eitlen Ballerina, die sich jedoch für den kraftprotzenden Mohren entscheidet. Marco Goecke – 2015 von der Zeitschrift tanz zum «Choreografen des Jahres» gewählt – fokussiert sich in seiner unverwechselbaren Bewegungssprache auf die Oberkörper und Arme der Tänzer. In seiner Petruschka-Version interessiert er sich nicht für russische Jahrmarktfolklore, sondern macht die existenzielle Tragik der Geschichte in abstrakt-poetischen Bildern erlebbar. Dabei tritt die eigene, starke Musikalität seiner Choreografie mit der temporeichen Partitur in ein atemraubendes Spannungsverhältnis.
Le Sacre du printemps, das bei der Uraufführung einen der grossen Theaterskandale des 20. Jahrhunderts provozierte, bringt mit der Darstellung eines Frühlingsritus im vorchristlichen Russland einen Gewaltakt auf die Bühne. In einem archaischen Ritual wird eine Frau dem Fruchtbarkeitsgott geopfert, um die Kräfte der Natur günstig zu stimmen. Der hochaktuelle Stoff hat die Tanzschöpfer immer wieder zu Neudeutungen herausgefordert. Inspiriert von Vaslav Nijinskys Uraufführungsfassung von 1913, findet der slowenische Choreograf Edward Clug in seiner Fassung einen zeitgemässen Zugang. Indem er die Tänzer auf spektakuläre Weise mit dem Element Wasser konfrontiert, stellt er den Menschen als Spielball und Diener der Natur in den Mittelpunkt seiner aufwühlenden Lesart.
Trailer Petruschka/Sacre
Trailer Petruschka/Sacre
Gespräch

Edward Clug, Igor Strawinskys Le Sacre du printemps ist ein Meilenstein für die Musik-, aber besonders auch für die Tanzgeschichte. In beiden Kunstformen gibt es ein «vor» und ein «nach» Sacre. Was bedeutet dir dieses Stück?
Immer wieder bin ich davon fasziniert, wie sich in Strawinskys Werk die gesamte Entwicklung der Musik im 20. Jahrhundert spiegelt. Le Sacre du printemps ist bei der Uraufführung 1913 im Pariser Théâtre des Champs-Élysées wie ein Meteorit aus dem All ins Herz der bürgerlichen Musikkultur eingeschlagen. Noch heute freue ich mich an den Augenzeugenberichten dieser Aufführung, die als einer der grössten Skandale in die Musikgeschichte eingegangen ist. Das Spannende liegt für mich vor allem im charakteristischen Wechselspiel der Bewegungszusammenhänge. Strawinskys Musik ist tönende Bewegung, auch wenn die ständigen metrischen Wechsel und die komplizierten rhythmischen Überlagerungen einer tänzerischen Umsetzung erst einmal zu widersprechen scheinen. Dass das jedoch absolut kein Gegensatz ist, haben herausragende Umsetzungen in den letzten einhundert Jahren eindrucksvoll bewiesen. Zum 100-jährigen Sacre-Jubiläum, das die Musikwelt 2013 begangen hat, konnte ich der Versuchung, mich selbst mit dem Frühlingsopfer auseinanderzusetzen, nicht länger widerstehen.
Die Geschichte von Le Sacre du printemps ist natürlich auch eine Historie seiner Choreografen. Wie präsent ist diese Rezeptionsgeschichte in deiner Choreografte?
An den vielen Versionen, die seit 1913 entstanden sind, lässt sich die Tanzgeschichte der letzten 100 Jahre verfolgen. Am meisten haben mich die Umsetzungen von Pina Bausch (1975) und Maurice Béjart (1959) beeindruckt. Béjart hat auf sehr ursprüngliche Weise das Erwachen der Liebe zwischen Mann und Frau in aller Körperlichkeit gezeigt. Pinas sehr theatralische Lesart drang in noch tiefere, allgemein menschliche Dimensionen vor. Mein Zugang zu Sacre verlief jedoch zunächst einmal nur über die Musik. Geradezu magnetisch hat sie mich angezogen und regelrecht herausgefordert. Lange bevor ich daran dachte, Choreograf zu werden. Da ist dieser unerklärliche Moment, wo man diese Musik in seinem Bauch spürt, als würde einem als lebenslangem Vegetarier plötzlich ein saftiges Steak vorgesetzt werden. Ich habe versucht, mich von allen Versionen frei zu machen. Einzig aus der Uraufführungsfassung von Vaslav Nijinsky habe ich zwei Elemente übernommen: die Bärte der Männer sowie die Zöpfe und Wangenbemalung der Frauen. Nijinskys Fassung erscheint mir bis heute sehr hermetisch und in gewisser Weise unantastbar. Ein Universum, das sich nicht von allein öffnet. Es wirkt wie eingefroren, als würde es auf die Jahre warten, die da kommen und einen bis dahin zur Zwiesprache mit seinem Schöpfer auffordern.
Lässt sich nach einer über einhundertjährigen Aufführungsgeschichte überhaupt noch etwas Neues zum Thema Sacre sagen?
Die Herausforderung liegt sicher darin, dass man diese Aufführungstradition mitdenken, sich aber letztlich von ihr lösen muss. Wie bei Nijinsky ist auch mein Ausgangspunkt die heidnische Legende, die ich jedoch in meine Umgebung übersetze. Natürlich denken wir bei Sacre sofort an die grossen, machtvollen Momente, in denen die ganz ursprüngliche Kraft des Rhythmischen so eindrucksvoll zum Tragen kommt. Doch daneben existieren eben auch ganz poetische, ja fast zärtliche Passagen. Mich hat im Sacre-Kontext vor allem die Figur der Auserwählten – der Geopferten – interessiert. In meiner Choreografie wird sie gleich zu Beginn des Balletts vorgestellt. Man weiss sofort, wer sie ist, und wie auf einer Reise begleiten wir sie von diesem Moment bis zu ihrem letzten Atemzug. Das ist ein Unterschied zur Originalversion, wo im ersten Teil ja erst einmal die Rituale der rivalisierenden heidnischen Stämme thematisiert werden. Bei uns ist die Entscheidung über das Opfer bereits gefallen, wenn sich der Vorhang öffnet. Die Auserwählte sondert sich selbst aus der Gruppe ab, sie wird – das erscheint mir ganz wichtig – nicht zu der Opferhandlung gezwungen. Sie hat eine bewusste Entscheidung getroffen, die von Furcht und Stolz gleichermassen geprägt ist. Für sie ist es eine Ehre, die Auserwählte zu sein. Mir kam es darauf an, dass wir die Sacre-Reise aus der Perspektive dieser Frau antreten. Erkennbare Situationen versetzen uns in die Lage, ihrer letzten Reise durch das gesamte Stück zu folgen und eben nicht nur im letzten Solo. Wenn der Auserwählten von zwei Frauen die Zöpfe entflochten werden, ist das ein sehr ergreifender Moment. «Du bist keine von uns mehr», scheinen sie zu sagen, aber dieses Entflechten der Zöpfe hat eine so grosse Zärtlichkeit und geschieht so behutsam, dass jenes Sich-Aufopfern in einem anderen Licht erscheint.
Sein Leben für eine Gemeinschaft hinzugeben, und sei es auch nur einen Teil davon, scheint am Beginn des 21. Jahrhunderts kein sehr populäres Thema zu sein.
Im Gegensatz zu dem vorzeitlichen Ritual des Sich-Opferns, von dem Strawinsky und Nikolai Roerich in ihrem Ballett erzählen, erleben wir heute, wie sehr sich die privaten Interessen des Einzelnen vor das Wohl einer Gemeinschaft stellen. Wir wollen nichts abgeben, nichts teilen, nichts verlieren. Und mit Blick auf unseren Planeten müssen wir feststellen, dass wir anstatt ihr zu opfern, die Erde selbst zum Opfer auserkoren haben. Für ihre Fruchtbarkeit sind wir heute bereit, fast jeden Preis zu zahlen und sägen so an dem Ast, auf dem wir sitzen. Dennoch lag es mir fern, Sacre auf einen Kommentar zur Umweltproblematik herunterzubrechen. Als Choreograf stand für mich das Archaische der heidnischen Legende im Vordergrund. Wenn jemand natürlich meint, Parallelen zu unserer Gesellschaft zu entdecken, übernehme ich dafür keine Verantwortung. (lacht)
Also wirklich gar keine Verbindung ins 21. Jahrhundert?
In Sacre-Aufführungen mit ihren sehr archaischen Bildern realisiert man eigentlich immer, dass wir nicht so fern von den heidnischen Riten, den blutigen Ritualen aus der vermeintlich grauen Vorzeit sind. Sie liegt näher, als uns lieb ist. Am Beginn meiner Beschäftigung mit dem Frühlingsopfer gab es zwar einige Ideen, Sacre mehr im Heute zu verankern. Doch wenn man einmal anfängt, sich zu dieser Musik zu bewegen und versucht, eine bestimmte Essenz herauszufiltern, eliminiert sich jede überflüssige Information fast von selbst. Man kommt auf das Einfachste und Ursprünglichste zurück. Also kein Platz für ölverschmierte Möwen! Die Kraft der Musik, aber auch die tänzerische und darstellerische Stärke meiner Tänzerinnen und Tänzer hat mir geholfen, mich von überflüssigem Ballast zu befreien.
Zur «Anbetung der Erde», wie der erste Teil in Strawinskys Partitur betitelt ist, ergiesst sich in deiner Choreografie Wasser auf die Bühne.
Am Anfang habe ich, ehrlich gesagt, noch gar nicht gewusst, dass wir Wasser benutzen würden. Das hat sich erst im Prozess des Choreografierens so ergeben. Als wir beim «Tanz der Erde» angekommen waren, hat mir die Musik gesagt, dass da etwas vom Himmel fallen müsse. Mir war nicht klar was. Wir haben dann verschiedene Möglichkeiten durchgespielt, und plötzlich ergab das Wasser Sinn, weil es sich ganz aus der Geschichte entwickelt: Wasser als das fruchtbringende und reinigende Element in all seiner Gewalt! In der Introduktion zum zweiten Teil, dem lyrischsten und innigsten Moment der gesamten Sacre-Partitur, kann es dann aber auch eine poetische Qualität entfalten, wenn die Mädchen schwanengleich über das Wasser gleiten.
Wie gehen die Tänzer mit diesem für sie auf der Bühne eher ungewohnten Element um?
Am unangenehmsten ist sicher, dass sich das warme Wasser, das da herabgeschüttet wird, in kürzester Zeit abkühlt. Ein Stück in diesem kalten Nass kreieren und darin tanzen zu müssen, ist – zugegeben – keine sonderlich angenehme Erfahrung. Der Begriff Sacre bekommt da also noch einmal eine ganz neue Bedeutung. Gerade wenn man weiss, wie empfindlich Tänzer normalerweise reagieren können. Da reicht manchmal nur ein Tropfen Wasser, um den Ausnahmezustand nach dem Motto: «Ich tanze nicht!» hervorzurufen. Hier sind es nun gleich 120 Liter, die auf die Tänzer hinunter prasseln. Dass sie das ertragen, hat meinen allergrössten Respekt. Sich auf solch einem ungewohnt rutschigen Untergrund bewegen zu müssen, ist eine Herausforderung. Tänzer sind es gewöhnt, mit äusserster Selbstkontrolle zu agieren. Diese Fähigkeit funktioniert zwar auch auf dieser völlig unberechenbaren Oberfläche, aber durch das Wasser kommt ein Element des Risikos und der Unsicherheit in die Aufführung, das ihr etwas sehr Natürliches verleiht und die Aufmerksamkeit ein wenig von der überstarken Musik abzieht. Es ist ein bisschen, als würde sich durch das Wasser eine gewisse Balance des Stückes herstellen.
Schon in deinen anderen Zürcher Arbeiten hast du Elemente des Bühnenbildes für die Choreografie nutzbar gemacht. Ob Schneehaufen oder quer über die Bühne gespannte Saiten: Die Tänzer werden provoziert, sich zu einem Bühnenbild in Beziehung zu setzen.
Im Fall von Sacre hat mich die Musik regelrecht dazu herausgefordert. Strawinsky scheint die ganze Zeit sagen zu wollen: Lasst uns nicht ruhen! Aber es stimmt. Solche Momente interessieren mich in all meinen Choreografien: Bis wohin kann man gehen, wie weit kann man eine Idee ausreizen und aus ihr ungewohnte Kraft schöpfen? Tanz ist eine Abfolge sich bewegender Bilder. Nur das genaue Timing dieser sich verändernden Sequenzen lässt sie natürlich und glaubwürdig erscheinen.
Wie besetzt man ein Ballett wie Le Sacre du printemps?
Wie jede andere Entscheidung, die im Zusammenhang mit Sacre getroffen werden muss, ist das ein sehr instinktiv verlaufender Prozess. Was will ich? Solisten mit starken Persönlichkeiten oder Tänzer, die sich sehr gut in eine Gruppe einfügen? Die Kombination aus beidem wäre ideal. Bei einem Ensemblestück wie Sacre finde ich eine Gemeinschaft, die wirklich aus verschiedenen Individualitäten besteht, spannender als ein uniforme Masse. Es gibt zwar Momente, in denen die Tänzer unisono auftreten müssen, aber die anderen Momente sind mir ebenso wichtig. Die Masse ist nicht grau!
Deine Sacre-Choreografie kam 2012 beim von dir geleiteten Slowenischen Nationalballett in Maribor heraus. Wie wird sich die neue Zürcher Version von der damaligen Fassung unterscheiden?
Ich bin sehr stolz, dass Christian Spuck dieses Stück ins Repertoire des Balletts Zürich übernimmt. Ich mag diese Choreografie sehr und freue mich, jetzt noch einmal daran zu arbeiten. Ich bin vier Jahre älter geworden und schaue aus einer anderen Perspektive auf dieses Stück. Die Antworten auf einige Fragen, die damals offen geblieben sind, kommen erst jetzt. Die Grundstruktur aus Maribor behalte ich bei, aber ich bin sehr froh über die Gelegenheit, einige Momente noch einmal überdenken und schärfen zu dürfen. Das können einzelne Bewegungen sein, aber auch musikalische Situationen, die nach anderen choreografischen Lösungen verlangen und das Ganze organischer, natürlicher und überzeugender machen. Und natürlich ist so eine Wiederbegegnung immer auch an die jeweiligen Tänzer gebunden. Ihre Persönlichkeiten und tänzerischen Qualitäten rufen nicht selten ganz unerwartete Lösungen hervor.
Was ist das Fazit deiner kreativen Auseinandersetzung mit Strawinskys Musik?
Es hat mich überrascht, wie stark ich beim Choreografieren das Diktat seiner Musik gespürt habe. Man merkt in jedem Moment, dass die Musik nicht nur tänzerische Aktionen begleiten will, sondern selbst deren Quelle, also der Ursprung des Tanzes ist. Die Schwierigkeit für den Choreografen liegt darin, den Kontrapunkt zu dieser Musik zu finden. Natürlich könnte man der Musik einfach folgen oder sie als Krücke benutzen. Doch Choreografie ist Freiheit. Man darf sich nicht zum Sklaven der Musik machen. Man muss im richtigen Moment die richtigen Prioritäten setzen und nicht versuchen, die Musik zu übertrumpfen. In einigen Situationen habe ich mich als Choreograf aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Es ging da plötzlich nicht mehr um mich. Nicht um den Versuch, sich etwas zu beweisen oder jemanden zu beeindrucken. So, als würde man sich ganz in der Musik auflösen.
Das Gespräch führte Michael Küster
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 42, September 2016
Das MAG können Sie hier abonnieren
Die geniale Stelle
«Das Werk eines Wahnsinnigen!» – «Kakophonie!» – «Ein Machwerk von Idioten!» – Es ging hoch her am Abend des 29. Mai 1913 im nagelneuen Théâtre des Champs-Élysées. Herren im Frack zerbeulten ihren Nachbarn mit Faustschlägen den Zylinder, gingen wutentbrannt mit Spazierstöcken aufeinander los oder bliesen mit dicken Backen angestrengt in Trillerpfeifen, Damen in kostbarer Abendrobe wanden sich schreiend in Krämpfen oder lagen ohnmächtig zwischen den Sitzreihen, der Dirigent konnte wegen des Getöses das Orchester kaum noch hören. Die Uraufführung von Igor Strawinskys Le Sacre du printemps hatte sich zu einer gewaltigen Schlacht, einer heroischen Sternstunde im Kampf um die moderne Musik ausgewachsen.
Heute zählt das Stück unumstritten zu den klassischen Meisterwerken des 20. Jahrhunderts, die Herrschaften, die damals so tapfer gegen diese Katzenmusik ankämpften, haben das wohl kaum so gesehen. Was sie an diesem denkwürdigen Abend hörten, schien ihnen gar keine Musik zu sein, erst recht keine meisterhafte, sondern sinnloser Lärm, dem sie mit kräftigem Radau den Garaus machen wollten.
Was nahm sich dieser freche Russe auch heraus! Man betrachte nur den Anfang der Einleitung zum zweiten Teil, der dem Vernehmen nach auf ganz besondere, geradezu hysterische Ablehnung stiess! Was man hier zu hören bekommt, muss doch jeden ehrbaren Musikliebhaber zornig machen, dachten die Kenner damals: Ein d-Moll-Akkord wird als Orgelpunkt in extrem tiefer Lage von den Hörnern intoniert. Wie hört sich denn das an? Und damit nicht genug! Gleichzeitig spielen die Holzbläser in extrem hoher Lage abwechselnd dis- und cis-Moll-Akkorde! Keiner der grossen Komponisten der ruhmreichen französischen Ballett-Tradition wäre im Traum darauf verfallen, solche Harmonien niederzuschreiben und sie auf diese groteske Weise zu instrumentieren. Und nun kommt dieser Russe daher … Er muss verrückt sein.
Mit Sicherheit hatte Strawinsky das Publikum provozieren, aus seiner satten Selbstzufriedenheit in der bequemen Reproduktion überholter Traditionen aufstören wollen, und die Saalschlacht zeigte, dass er sein Ziel erreicht hatte. Aber er wusste auch: Wenn die Wahrnehmung seines Stücks auf diesen Skandaleffekt beschränkt bliebe, würde es schon bald das Schicksal so vieler anderer Werke teilen, die einst grosses Aufsehen erregt hatten und dann schnell in der Versenkung verschwunden waren. Bei aller diebischen Freude am Spiesser-Ärgern – Strawinsky hatte doch mehr und Wichtigeres im Sinn, als er das Pariser Publikum mit seiner Vision eines Frühlingsrituals aus dem heidnischen Russland konfrontierte. Er wollte ein idealisiertes Porträt seines Volkes zeichnen, seiner urtümlichen Kraft, aber auch seiner Zartheit und tiefen Religiosität. Für diese Züge, die so gar nicht zum nach wie vor beliebten Klischee vom «wilden Russen» passen, erfindet Strawinsky die ungewöhnlichsten Klänge. Heute ist der Schockeffekt jener Anfangstakte des zweiten Teils verblasst. Wo die Zeitgenossen nur Kakophonie hörten, bewundern wir heute ein geniales Klanggemälde von betörender Schönheit. Der fremdartige Klang, die kühnen Akkordverbindungen versetzen uns in das mysteriöse Halbdunkel eines Waldes, in dem sich in flirrender Zartheit und betörender Schönheit das Wunder des erwachenden Frühlings vollzieht. Strawinsky schuf dafür eine Musik, die auf ebenso kühne wie suggestive Weise eine innige Naturverbundenheit schildert, die das alte Europa vielleicht tatsächlich von den Völkern am Rand seiner Aufmerksamkeitssphäre lernen könnte.
Text von Werner Hintze
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 57, März 2018
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Essay
Es ist ganz einfach zu choreografieren. Es ist nicht mehr als: Einmal kommt jemand von links oder von rechts oder von hinten nach vorne. Trotzdem habe ich immer Herzklopfen und manchmal panische Angst, einem Tänzer zu sagen: Komm mal von da oder dort. Meiner Meinung nach steht mir das nicht zu, aber ich muss es ja machen. Übertrieben, vielleicht pathetisch, wenn Nina Simone sagt: Gott ist zwischen den Noten. Mich lässt das aber nicht los. Ich versuche nur zu verstehen oder zu fühlen, warum die eine Bewegung in die nächste übergeht. Es ist eine Art Wind dazwischen. Mehr als zu sagen: Energie. Es ist zum Verrücktwerden, das Versuchen zu sehen und zu erfühlen – zusammen mit der wahnsinnigen Angst, dass dies den Raum nicht hält, und dem Gefühl, nicht zu treffen. Was heisst das wohl? Bewegung als Abfall von etwas anderem!! Etwas anders Gemeintem. Bewegung als spätere Geschichte, etwas davon mitzuteilen und doch den Sinn dieser Geschichte auf dem Weg zu verlieren.
Also keine Geschichte? Nur Wind und Menschen. Menschen, die im Wind gehen. Mir fehlt der Wind gerade. Ich mag den Sommer nicht. Der Sommer ist nicht das Theater! Der Wind schon, der Herbst eher. Ich habe eine Vorlage in diesem Stück. Eine Geschichte. Eine einfache. Zum Glück! Diese Geschichte wird mich nicht beugen, und trotzdem hält sie mich und die Arbeit an den Bewegungen. Sie ist der komische Auftrag. Es klingt wie eine Erleichterung. Ist es aber nicht. Denn: Was könnte ich anderes erzählen als von mir und uns? Ich meine manchmal zu spüren, wie jeder einzelne Tänzer oder Mitarbeiter im Raum sich fühlt. Das ist mir manchmal zu viel. Nur wenn ich dann mit einem Tänzer arbeite, hilft das und ist die Quelle, die etwas intim macht.
Ich frage mich, ob ich gerade lebe, oder ob ich auf irgendetwas warte. Morgens wache ich auf und denke sofort an die Arbeit. Also weniger denken, mehr ein Gefühl, was alles heute möglich ist!!! Ein grosses Nichts, das es zu füllen gilt. Manchmal glauben die Leute, dass man in einem schönen Traum lebt, aber ich wünschte, ich könnte erzählen, wie erdig und arm man ist – sozusagen auf dem Boden der Tatsachen dort im Studio – einen Hauch von etwas zu produzieren.
In der Kommunikation ruf ich aus einer Einsamkeit. Aus einer Wolke von Wünschen, aber das Gegenüber hört das vielleicht nicht. Gerade hab ich das Gefühl, dass ich das Stück so gerne hätte! Besitzen möchte ich es. Fast wie man sich etwas Wertvolles wünscht. Ich hätte so gerne gewusst, was das ist, was ich gerade mache. Es gibt diesen Moment, wenn mir aus etwas Winzigem plötzlich klar wird, was es ist, und doch weiss ich es nicht für den Tag der Premiere. Premiere, das ist anders. Da fühl ich mich kalt, wie aus einem Traum erwacht!! Oft sind die Tänzer dann an diesem Abend besonders. Ich bin oft zufrieden. Schüttle den Kopf manchmal, weil sie wie Kinder sind. Störrischmüde vorher!! Aber diese Minuten dann.
Heute dachte ich, es müssen Berliner mit Puderzucker im Stück gegessen werden. Gibt’s das hier??? Ich weiss nicht, warum die Tänzer manchmal spüren, was ich suche. Es passiert. Heute war Katja genau auf dem Punkt mit einer Winzigkeit. Ja, winzig klein. Aus einer anderen Situation hab ich sie gebeten, dies oder das zu tun. Ja, dies oder das. Oft nichts. Was dann plötzlich sich anreichert zu etwas. Ich blick jetzt schon zurück auf die Unmöglichkeit etwas zu tun, und jetzt klappern Minuten dahin im Rhythmus, eben wie man wohl ein Stück macht. Ich hab nicht viel überlegt, auch nicht beim Casting. Aber ich fange an, meine Entscheidungen zu geniessen. Die Tänzer stimmen, mit Grossartigem oder mit dem, was nicht so klappt.
Ich weiss nicht, ich fühl mich verliebt. Heute, gerade eben. Vielleicht nur kurz, oder vielleicht bis zum Schluss. Ich hoffe, jemand ist in der Arbeit auch verliebt in mich.
Die Musik strengt mich an. Da ich sie nur von Tag zu Tag höre, bin ich überrascht, aber das gefällt mir. Ich bin Widder. Ich bin sprunghaft. So ist die Musik auch. Sie erzählt und will mich zwingen. Langsam verstehen wir uns besser. Ich vergebe der Musik, was ich nicht erwartet hätte. Ich hab Rasseln im Sinn, Trampeln, denke an einen Luftvorhang. Im Spiegel die Wahrheit. Ketten aus Glöckchen, nur ein Blatt, das fällt. Nur eins.
Es gibt auch so einen einfachen Wunsch manchmal, der heisst: Ich will, dass es schön wird. Weiss nicht, was das ist. Was ist für mich schön? Für andere? Ich wäre gerne spielerischer, aber ich bin angespannt. Nach der Probe fallen mir die Augen zu. Ich fasse für mich nachts zusammen: Da ist ein Raum, der ist dunkel, da sind Menschen, die sich anders bewegen können als andere Menschen. Da sind ein paar Lampen, ein paar Hosen, Menschen, die Instrumente spielen können, weil sie es gelernt haben. Da ist eine seltsame, recht einfache Geschichte als Grundlage. Sonst nix. Und jetzt? Denk ich wie jedes Mal. Dann müsste etwas passieren, das uns das Herz zerreisst!!! Hahaha. Ich wünschte, ich hätte manchmal diese Aufgabe nicht, aber dann schaff ich es auch nicht ohne sie. Am Wochenende war ich traurig!!! Ich hab die Tänzer vermisst. Menschen, die ich kaum kenne!!!
Als Kind hatte ich Ideen, etwas zu erfinden, etwas zu bauen; oder nachts durchs Fenster, mich mit Freunden im Wald treffen, sich gruseln vielleicht. So ein Gefühl hab ich für die Tänzer. Einen Plan schmieden ohne die Erwachsenen!!! Ja, eine Idee haben. Die anderen, die Erwachsenen haben immer alles zerschlagen! Vielleicht deshalb Theater heute!
Ich habe hier ein paar Glöckchen. Ganz kleine. Mit denen spiele ich rum. Sie werden im Stück auftauchen. Was ganz Einfaches, wo aber eine ganze Welt mitschwingt. Ich suche Sachen mit Charme, nichts Perfektes. Das Gefundene darf mitspielen!!! Die gefundenen Schritte dürfen mittanzen, die Tänzer, die ich zufällig gesehen habe. Die Geschichte darf probiert werden, die Musik darf spielen, so wie sie mir vorgeschlagen wurde.
Alles an der Arbeit ist ok, so wie im selben Moment alles zu bezweifeln ist!!! Alles wird gebaut, so wie es auch zerschlagen wird. Trümmer werden zusammengesetzt, und nichts kann ein Gefühl garantieren. Keine noch so harte Arbeit. Verrückt!
Text von Marco Goecke
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 42, September 2016
Das MAG können Sie hier abonnieren
Ich erlaube nicht einen einzigen Takt Pantomime
Igor Strawinsky
Essay
Ein greller Schmerzensschrei, ein Sturz, ein leises Jammern, tiefe Stille, ein wie aus der Ferne hereingewehtes Fanfarenmotiv – so beginnt das zweite Bild von Strawinskys Ballett, das die Geschichte einer traurigen Marionette erzählt.
Ein brutaler Tritt befördert Petruschka in seine Kammer, mühsam rappelt sich der Geschundene auf, langsam kommt er zu sich. Das erwähnte Fanfarenmotiv ist die Chiffre seiner Existenz: ein bis zur Oktave aufsteigender C-Dur-Dreiklang, dessen letztes Intervall, die Quarte, wie ein Alarmsignal mehrmals wiederholt wird. Doch der Klang ist seltsam gebrochen, scheint nicht zur musikalischen Gestalt passen zu wollen, die man im scharfen Ton der Trompete erwarten würde, nicht im sanft-schattierten der Klarinette. Dieser weiche Klang verleiht dem doch eigentlich aggressiven, zumindest aufrüttelnden Gebilde einen irritierend melancholischen Charakter und selbst die Quarten am Ende klingen eher wie ein Hilferuf, wie ein Signal, das einer aussendet, der in höchster Not ist. Die Unterstimme des Motivs, die einer zweiten Klarinette anvertraut ist, verstärkt den schmerzlichen Charakter noch. Sie beschreibt einen gebrochenen Fis-Dur-Dreiklang, so dass sich ein bitonales Gebilde ergibt, das die im Quintenzirkel am weitesten voneinander entfernten Tonarten zusammenzwingt: eine scharf dissonierende musikalische Formulierung von extremer Spannung, das Bild einer zerrissenen Existenz – Petruschka.
Und tatsächlich: Der Held von Strawinskys Stück ist ein Widerspruch in sich. Er ist eine beseelte Gliederpuppe, ein gleichzeitig mechanisches und gleichzeitig empfindungsbegabtes, liebesfähiges Wesen. Sein schmerzverzerrtes Motiv, das am Anfang des zweiten Bilds zum ersten Mal auftritt, durchzieht von da an die Partitur in allen denkbaren gestischen Variationen von hoffnungsloser Traurigkeit bis zum verzweifelten Aufschrei, der in manischer Wiederholung das ganze Orchester in Aufruhr versetzt. Und je öfter man es hört, desto deutlicher wird, dass Strawinsky die unglückliche Marionette durch dieses scheinbar simple Motiv zu einem umfassenden Sinnbild der menschlichen Existenz gestaltet hat: der Existenz als biologisches Wesen einerseits, das den natürlichen Abläufen unterworfen ist, und als geistiges mit Selbstbewusstsein und eigenem Willen ausgestattetes andererseits, das fortwährend mit diesen über- mächtigen Kräften im Kampf um seine Selbstbehauptung liegt.
Noch eine andere, eine soziale Dimension lässt sich in Petruschkas innerem Konflikt ausmachen: Er ist der Knecht, der widerspruchslos den Befehlen seines Herrn folgen muss – bis er dem Zwang schliesslich entrinnt: Ganz am Ende, wenn der Schaubudenbesitzer den zerschmetterten Leichnam der «entseelten» Gliederpuppe von der Bühne schleift, erscheint Petruschkas Geist auf dem Dach des kleinen Theaters – befreit aus dem Leib, der fremdem Willen unterworfen war. Nun sind es zwei grell klingende Trompeten, die Petruschkas Fanfaren-Motiv spielen, und die Quartschritte am Ende sind kein Hilfeschrei mehr, sondern geraten zu einem kleinen aggressiven Tänzchen im fünfteiligen Metrum, das für die Musik des russischen Volkes so typisch ist: Petruschka droht dem Besitzer, der sich verängstigt in seine Schaubude verkriecht. Was mit dieser Drohung gemeint ist, kann niemand sagen, aber es ist unüberhörbar: Dieses «Peterchen» (ist es ein Zufall, dass der Titelheld des Stücks denselben Namen trägt wie jener Zar, der Russland zur Weltmacht formte?) hat es faustdick hinter den Ohren, mit ihm wird man noch rechnen müssen. Wir schreiben das Jahr 1911…
Text von Werner Hintze
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 42, September 2016
Das MAG können Sie hier abonnieren
Während ich «Sacre» komponierte, sah ich das Schauspiel vor mir als eine Folge ganz einfacher rhythmischer Bewegungen, so dass ein unmittelbarer Eindruck auf den Zuschauer entsteht. Alle überflüssigen Einzelheiten, alle Verwicklungen, die den grossen Eindruck hätten abschwächen können, sollten verbannt sein.
Igor Strawinsky
Petruschka / Sacre
Synopsis
Petruschka / Sacre
Petruschka
Das Treiben eines Jahrmarkts. Verschiedene Gruppen und einzelne Figuren treten auf. Mittelpunkt der Szene ist ein Zauberer mit seinen Puppen: Petruschka, Ballerina und Mohr, die er zum Leben erweckt und die ausgelassen zu tanzen beginnen. Petruschka erkennt seine menschlichen Gefühle. Mit Bitterkeit empfindet er sein Ausgeschlossensein vom gewöhnlichen Leben, seine Hässlichkeit und sein lächerliches Aussehen. In der Liebe zur Ballerina sucht er Trost zu finden. Doch die Ballerina flieht vor ihm, weil ihr Petruschkas wunderliches Auftreten nichts als Schrecken einflösst. Die Ballerina wendet sich dem grobschlächtigen Mohren zu und setzt all ihre Verführungskünste ein. Der eifersüchtige Petruschka stört die Intimität der beiden. Das Jahrmarkttreiben geht weiter und erreicht seinen Höhepunkt. Der Mohr beseitigt seinen Widersacher Petruschka. Der Zauberer versichert, es handle sich bloss um eine Puppe. Petruschkas Geist erscheint.
Le sacre du printemps
Ein junges Mädchen wird geopfert, um den Gott des Frühlings günstig zu stimmen. In einem heidnischen Ritual tanzt sich die Opferjungfrau zu Tode.
Musikalischer Ablauf
Erster Teil: Die Anbetung der Erde
Introduktion
Die Frühlingsauguren. Tänze der jungen Mädchen
Spiel der Entführung
Frühlingsreigen
Spiel der wetteifernden Städte
Auftritt des weisen Alten
Anbetung der Erde. Der weise Alte
Tanz der Erde
Zweiter Teil: Das Opfer
Introduktion
Geheimnisvolle Kreise der Mädchen
Verherrlichung der Auserwählten
Anrufung der Ahnen
Weihevolle Ahnenfeier
Heiliger Tanz. Die Auserwählte
Biografien

Edward Clug, Choreografie
Edward Clug
Edward Clug vollendete seine Ballettausbildung 1991 an der Nationalen Ballettschule in Cluj-Napoca (Rumänien). Im selben Jahr wurde er als Solist an das Slowenische Nationaltheater (SNG) in Maribor engagiert. 2003 wurde er am selben Theater Ballettdirektor und führte die Compagnie auf neue, unverkennbare Wege. Mit seinem unverwechselbaren choreografischen Stil zog Edward Clug die Aufmerksamkeit eines internationalen Publikums auf sich. Gleichzeitig gelang es ihm, das Mariborer Ensemble mit Gastspielen in ganz Europa, Asien, den USA und Kanada in der internationalen Tanzszene zu etablieren. Seit mehreren Jahren ist Edward Clug dem Stuttgarter Ballett und dem Ballett Zürich verbunden. In Zürich waren u.a. Faust – Das Ballett und Le Sacre du printemps zu sehen. Ausserdem entwickelte sich eine enge Beziehung zum Nederlands Dans Theater. Neue Stücke entstanden ferner für das Royal Ballet of Flanders, das Ballett der Wiener Staatsoper, das Nationalballett Lissabon, das Kroatische Nationalballett, das Rumänische Nationalballett Bukarest, die Bitef Dance Company, das Ukrainische Nationalballett Kiew, das Staatsballett Nowosibirsk, die Station Zuid Company, Graz Tanz, das Ballett des Theaters am Gärtnerplatz München, das Hessische Staatsballett Wiesbaden, das Ballett Augsburg, das Aalto Ballett Essen, das Ballett Dortmund und das West Australian Ballet. Edward Clug erhielt zahlreiche nationale und internationale Preise. Für Quattro wurde er 2010 in Moskau für den Kunstpreis «Goldene Maske» nominiert. Ausserdem wurde er mit den höchsten slowenischen Kulturpreisen, dem Preis der Prešern Foundation (2005) und der Glazer Charter (2008), ausgezeichnet. 2017 wurde seine Choreografie Handman (NDT 2) für den «Benois de la Danse» nominiert. Sein Ballett Peer Gynt wurde vom Wiener Staatsballett ins Repertoire übernommen. Am Moskauer Bolschoitheater choreografierte er 2018 Petruschka, mit der Starballerina Diana Vishneva realisierte er in Miami das Projekt Sleeping Beauty Dreams.

Marco Goecke, Choreografie
Marco Goecke
Marco Goecke stammt aus Wuppertal. Seine Ballettausbildung absolvierte er an der Ballettakademie der Heinz-Bosl-Stiftung München sowie am Königlichen Konservatorium Den Haag. Darauf folgten Engagements an der Staatsoper Berlin und am Theater Hagen. An diesem Theater schuf Goecke im Jahr 2000 seine erste Choreografie mit dem Titel Loch. Es folgten mehrere Choreografien für die Noverre-Gesellschaft mit Tänzern des Stuttgarter Balletts und eine Einladung an das New York Choreographic Institute. Mit der Spielzeit 2005/06 wurde Marco Goecke zum Hauschoreografen des Stuttgarter Balletts ernannt und kreierte dort 2006 sein erstes Handlungsballett Nussknacker, das später auch für den ZDF-Theaterkanal verfilmt wurde. Von 2006 bis 2012 hatte Goecke den Titel des Hauschoreografen auch beim Scapino Ballet Rotterdam inne. Ab der Spielzeit 2013/14 wurde er Associate Choreographer beim Nederlands Dans Theater. 2019 bis 2023 war er Gauthier Dance als «Artist in Residence» verbunden, von 2019 bis 2023 war er Ballettdirektor des Staatsballetts Hannover. Von den über neunzig Werken, die Goecke innerhalb von wenigen Jahren geschaffen hat, gehören viele zum Repertoire namhafter Ballettcompagnien, u. a. Grands Ballets Canadiens de Montréal, Canadian National Ballet, Ballett-Theater München, Finnish National Ballet, Ballett Zürich, Ballett am Rhein Düsseldorf, Ballett der Opéra de Paris und Ballett der Wiener Staatsoper. Marco Goecke wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Nijinsky Award Monte Carlo, der Niederländische Tanzpreis «Zwaan» sowie der italienische «Danzadanza Award» für Nijinski als «Beste Choreografie des Jahres». In der Kritikerumfrage der Zeitschrift tanz wurde er 2015 als «Choreograf des Jahres» ausgezeichnet. Das vom NDT uraufgeführte Stück Wir sagen uns Dunkles wurde für den Prix Benois nominiert. 2022 wurde Marco Goecke mit dem Jiří-Kylián-Ring sowie dem Deutschen Tanzpreis ausgezeichnet. Zu seinen jüngsten Arbeiten gehören das abendfüllende Stück A Wilde Story über den Schriftsteller Oscar Wilde für das Staatsballett Hannover sowie das 2023 entstandene Stück In The Dutch Mountains für das Nederlands Dans Theater. Mit der
Spielzeit 2025/26 wird Marco Goecke Direktor des Balletts am Theater Basel.

Tomáš Hanus, Musikalische Leitung
Tomáš Hanus
Der Dirigent Tomáš Hanus studierte an der Janáček-Akademie in Brno. Aktuell ist er Music Director der Welsh National Opera, wo er in dieser Saison die Fledermaus und den Rosenkavalier dirigiert. 2017 war er Dirigent des renommierten Cardiff Singer of the World-Wettbewerbs. In den vergangenen Spielzeiten leitete er Opernaufführungen an der Dänischen Nationaloper, am Teatro Real in Madrid, an der Finnischen Nationaloper, an der Opéra de Paris sowie an der Janáček-Oper in Brno, deren Musikdirektor er mehrere Jahre lang war, ferner am Nationaltheater Prag sowie in Berlin, Dresden, Basel, Kopenhagen, Oslo, Lyon und Warschau. Eine enge Zusammenarbeit verbindet den Dirigenten seit 2009 mit der Bayerischen Staatsoper in München. Dort dirigierte er die Opern Jenůfa, Rusalka, Hänsel und Gretel und Věc Makropulos. Aktuelle und zukünftige Opernprojekte werden ihn erneut nach München (Die verkaufte Braut), Brno (Der Rosenkavalier) und Paris (Jolanta) führen. Tomáš Hanus geht ausserdem einer ausgedehnten Konzerttätigkeit nach. Mit Strawinskys Petruschka/Le Sacre du Printemps debütiert er am Opernhaus Zürich.
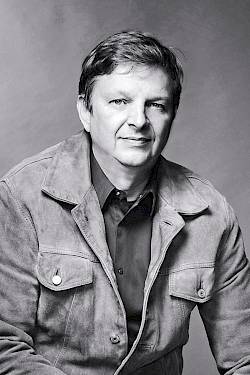
Marko Japelj, Bühne
Marko Japelj
Marko Japelj stammt aus Maribor (Slowenien). Er studierte Architektur in Ljubljana. 1986 entstand sein erstes Bühnenbild für Hedda Gabler an der Theaterakademie Ljubljana. Mittlerweile realisierte er fast 200 Bühnenbilder für Drama und Musiktheater. Viele davon wurden ausgezeichnet. Als Gastprofessor leitete er drei Semester die Meisterklasse für Film und Bühnengestaltung an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Er arbeitete mit zahlreichen Theatern in Slowenien und Europa, u.a. für die Opernhäuser in Bukarest, Riga, Metz, Bratislava sowie die Wiener Staatsoper, die Nationaltheater in Zagreb, Rijeka und Belgrad, das Nederlands Dans Theater, das Ballet Vlaanderen in Antwerpen, das Aalto Theater Essen und die Theater Augsburg, Dortmund und Wuppertal. Für Edward Clug realisierte er die Bühnenbilder zu Tango, Lacrimas, Radio & Juliet, Prêt-à-porter, Watching others, The Architecture of Silence, Hill Harper’s Dream, Le Sacre du printemps, Six Antique Epigraphs, Les Noces, Chamber Minds, Peer Gynt, Hora und Proof. Für Filipe Portugal und das Ballett Zürich entstand das Bühnenbild zu disTANZ.

Leo Kulaš, Kostüme
Leo Kulaš
Leo Kulaš ist Bühnen- und Kostümbildner. Er studierte an der Akademie für Angewandte Kunst in Belgrad. Im ehemaligen Jugoslawien schuf er die Kostüme für über 150 Theater-, Opern- und Ballettproduktionen. Mit Roberto Ciulli arbeitete er am Theater an der Ruhr und an Paolo Magellis «Teatro Metastasio della Toscana». Am Slowenischen Mladinsko Theatre und am Slowenischen Nationaltheater Maribor arbeitete er mit der Kostümbildnerin Svetlana Visintin zusammen. Für La divina commedia am Slowenischen Nationaltheater Maribor wurde er mit dem «Maribor Theatre Festival Award» und dem «Prešeren Fund Award» ausgezeichnet, 2008 erhielt er den «Maribor Theatre Festival Award» für Das Käthchen von Heilbronn in Ljubljana. Auch ausserhalb Sloweniens hat Leo Kulaš mit namhaften Regisseuren zusammengearbeitet. Seine Arbeiten waren u.a. am Theater Dortmund, am Thalia Theater Hamburg, an der Staatsoper Hannover, an der Oper Sofia, am Landestheater Linz, an der Wiener Staatsoper, an der Lettische Nationaloper in Riga und am Moskauer Bolschoitheater zu sehen. Er schuf die Kostüme für Edward Clugs Ballette Tango, Lacrimas, Radio &Juliet, Prêt-à-porter, Watching Others, Sketches und The Architecture of Silence, Hill Harper’s Dream, Le Sacre du printemps, Six Antique Epigraphs, Les Noces, Chamber Minds und Peer Gynt. Ausserdem ist er als Kostümbildner für Film und Fernsehen tätig. Am Theater St. Gallen entwarf er die Kostüme für das Musical Flashdance.

Martin Gebhardt, Lichtgestaltung
Martin Gebhardt
Martin Gebhardt war Lichtgestalter und Beleuchtungsmeister bei John Neumeiers Hamburg Ballett. Ab 2002 arbeitete er mit Heinz Spoerli und dem Ballett Zürich zusammen. Ballettproduktionen der beiden Compagnien führten ihn an renommierte Theater in Europa, Asien und Amerika. Am Opernhaus Zürich schuf er das Lichtdesign für Inszenierungen von Jürgen Flimm, David Alden, Jan Philipp Gloger, Grischa Asagaroff, Matthias Hartmann, David Pountney, Moshe Leiser/Patrice Caurier, Damiano Michieletto und Achim Freyer. Bei den Salzburger Festspielen kreierte er die Lichtgestaltung für La bohème und eine Neufassung von Spoerlis Der Tod und das Mädchen. Seit der Spielzeit 2012/13 ist Martin Gebhardt Leiter des Beleuchtungswesens am Opernhaus Zürich. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn heute mit dem Choreografen Christian Spuck (u.a. Winterreise, Nussknacker und Mausekönig, Messa da Requiem, Anna Karenina, Woyzeck, Der Sandmann, Leonce und Lena, Das Mädchen mit den Schwefelhölzern). Er war ausserdem Lichtdesigner für die Choreografen Edward Clug (u.a. Strings, Le Sacre du printemps und Faust in Zürich), Alexei Ratmansky, Wayne McGregor, Marco Goecke, und Douglas Lee. Mit Christoph Marthaler und Anna Viebrock arbeitete er beim Händel-Abend Sale und Rossinis Il viaggio a Reims in Zürich sowie bei Lulu an der Hamburgischen Staatsoper zusammen und mit Jossi Wieler und Sergio Morabito an der Oper Genf für Les Huguenots. 2023 gestaltete er das Licht für Spucks Ballett Bovary beim Staatsballett Berlin und 2024 Rossinis Tancredi an den Bregenzer Festspielen. Ausserdem war er Lichtdesigner bei Atonement von Cathy Marston am Opernhaus Zürich.

Michaela Springer, Bühne und Kostüme
Michaela Springer
Michaela Springer studierte Bühnen- und Kostümbild an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart bei Martin Zehetgruber. Vor und während ihres Studiums arbeitete sie als Assistentin am Schauspiel Stuttgart und am Aalto Theater Essen. Seit 2005 ist sie als freischaffende Bühnen- und Kostümbildnerin für Schauspiel, Oper und Ballett tätig und entwarf in Deutschland u.a. die Ausstattung für Produktionen an der Württembergischen Landesbühne Esslingen, am Düsseldorfer Schauspielhaus, am Hessischen Staatstheater Wiesbaden, Schauspielhaus Dortmund, Schlosstheater Moers und am Rheinischen Landestheater Neuss. Mit dem Choreografen Marco Goecke arbeitete Michaela Springer erstmals 2005 zusammen und entwarf die Kostüme für sein Ballett Sweet Sweet Sweet. Es folgten Ausstattungen beim Stuttgarter Ballett für Der Nussknacker (2006), Alben (2008), Orlando (2010), Black Breath (2012) On Velvet (2013) und Lucid Dream (2015). Die erfolgreiche Zusammenarbeit setzte sich auch bei Auftragswerken für das Scapino Ballett Rotterdam mit Der Rest ist Schweigen (2005), Bravo Charlie (2007) und Songs for Drella (2011), für Les Ballets de Monte-Carlo mit den Stücken Whiteout (2008) und Le Spectre de la Rose (2009) fort, für das Ballett Zürich mit dem Stück Deer Vision (2014)wie auch bei dem Ballett Fur (2009) für das Norwegische Nationalballett. Michaela Springer entwarf ausserdem die Kostüme zu zwei Balletten des Choreografen Demis Volpi.

Michael Küster, Dramaturgie
Michael Küster
Michael Küster stammt aus Wernigerode (Harz). Nach dem Studium der Germanistik, Kunst- und Sprechwissenschaft an der Universität Halle war er Moderator, Autor und Sprecher bei verschiedenen Rundfunkanstalten in Deutschland. Dort präsentierte er eine Vielzahl von Klassik-Programmen und Live-Übertragungen wichtiger Konzertereignisse, u. a. aus der Metropolitan Opera New York, der Semperoper Dresden und dem Leipziger Gewandhaus. Seit 2002 ist er Dramaturg am Opernhaus Zürich, u. a. für Regisseure wie Matthias Hartmann, David Alden, Robert Carsen, Moshe Leiser/ Patrice Caurier, Damiano Michieletto, David Pountney, Johannes Schaaf und Graham Vick. Als Dramaturg des Balletts Zürich arbeitete Michael Küster seit 2012 u. a. mit Cathy Marston, Marco Goecke, Marcos Morau, Edward Clug, Alexei Ratmansky, William Forsythe, Jiří Kylián und Hans van Manen, vor allem aber mit Christian Spuck zusammen (u. a. Romeo und Julia, Messa da Requiem, Winterreise, Dornröschen). An der Mailänder Scala war er Dramaturg für Matthias Hartmanns Operninszenierungen von Der Freischütz, Idomeneo und Pique Dame.

William Moore, Petruschka
William Moore
William Moore ist Brite und erhielt seine Ausbildung an der Royal Ballet School in London. Er war Preisträger internationaler Ballettwettbewerbe. Seit 2005 gehörte er zum Stuttgarter Ballett, wo er 2010 zum Ersten Solisten ernannt wurde. Wichtige Rollen waren Siegfried in Schwanensee, Lenski in Onegin und Lucentio in Der Widerspenstigen Zähmung (alle von John Cranko), Armand in Neumeiers Kameliendame, Leonce in Christian Spucks Leonce und Lena, die Titelrolle in Marco Goeckes Orlando, Albrecht in Giselle von Anderson/Savina, Colas in Ashtons La Fille mal gardée. 2012 wurde William Moore mit dem deutschen FaustPreis ausgezeichnet. Seit der Saison 2012/13 ist er 1. Solist beim Ballett Zürich. Wichtige Rollen waren Romeo in Spucks Romeo und Julia, Wronski in Anna Karenina, der Nussknacker in Spucks Nussknacker und Mausekönig, Mephisto in Faust von Edward Clug, Petruschka in der Choreografie von Marco Goecke und Diaghilew in Goeckes Nijinski. Ausserdem trat er in Stücken von Wayne McGregor, Sol León/Paul Lightfoot, Douglas Lee und Jiří Kylián auf. 2018 erhielt er den «Tanzpreis der Freunde des Balletts Zürich».

Daniel Mulligan, Petruschka
Daniel Mulligan
Daniel Mulligan stammt aus Grossbritannien und studierte an der Royal Ballet School in London. Nach zwei Spielzeiten im Junior Ballett ist er seit 2009/10 Mitglied des Balletts Zürich. Er tanzte in Stücken von Mats Ek, William Forsythe, Marco Goecke, Johan Inger, Jiří Kylián, Sol León/Paul Lightfoot, Hans van Manen, Marcos Morau, Ohad Naharin, Crystal Pite und Heinz Spoerli. Wichtige Rollen waren Mercutio/Benvolio in Romeo und Julia, Fritz/Clown in Nussknacker und Mausekönig, Stiwa in Anna Karenina und Grüne Fee in Dornröschen von Christian Spuck, Mephisto in Faust und Tod in Peer Gynt von Edward Clug sowie Vater in The Cellist von Cathy Marston. 2022 erhielt er den «Tanzpreis der Freunde des Balletts Zürich».

Giulia Tonelli, Die Ballerina
Giulia Tonelli
Giulia Tonelli stammt aus Italien. Ihre Ausbildung absolvierte sie beim Balletto di Toscana und an der Ballettschule der Wiener Staatsoper. Nach einem Engagement an der Wiener Staatsoper tanzte sie von 2002 bis 2010 beim Royal Ballet of Flanders in Antwerpen, ab 2004 als Halbsolistin. Dort tanzte sie u. a. Giselle (Petipa) sowie Solopartien in Choreografien von Forsythe, Balanchine, Kylián, Haydée und Spuck. Seit 2010/11 ist sie Mitglied des Balletts Zürich, wo sie in Balletten von Spoerli, Goecke, McGregor, Lee, Kylián und Balanchine auftrat. In Choreografien von Christian Spuck tanzte sie Julia in Romeo und Julia, Lena in Leonce und Lena, Betsy in Anna Karenina sowie in Messa da Requiem. Weitere Höhepunkte waren Alexei Ratmanskys Schwanensee-Rekonstruktion, Quintett von William Forsythe, Emergence von Crystal Pite, Gretchen in Edward Clugs Faust sowie die Titelrolle in The Cellist von Cathy Marston. Bei den «Jungen Choreografen» präsentierte sie gemeinsam mit Mélissa Ligurgo die Arbeiten Mind Games und Klastos. 2013 wurde sie mit dem GiulianaPenzi-Preis ausgezeichnet. 2017 erhielt sie den «Tanzpreis der Freunde des Balletts Zürich».

Katja Wünsche, Die Ballerina
Katja Wünsche
Katja Wünsche stammt aus Dresden und wurde an der Staatlichen Ballettschule Berlin ausgebildet. Sie war Preisträgerin zahlreicher Ballettwettbewerbe. Von 1999 bis 2012 tanzte sie im Stuttgarter Ballett, seit 2006 als Erste Solistin. Sie tanzte Hauptrollen in Choreografien von John Cranko (Romeo und Julia, Der Widerspenstigen Zähmung, Onegin), John Neumeier (Endstation Sehnsucht, Die Kameliendame), Marcia Haydée (Dornröschen, La Sylphide, La Fille mal gardée) und Christian Spuck (Lulu, Der Sandmann, Leonce und Lena, Das Fräulein von S.) sowie in Balletten von Forsythe, Kylián, León/Lightfoot und Goecke. 2007 wurden ihr der Deutsche Tanzpreis Zukunft und der Deutsche Theaterpreis Der Faust verliehen. Seit 2012/13 ist Katja Wünsche Solistin beim Ballett Zürich. Hier tanzte sie u.a. die Julia in Spucks Romeo und Julia, Lena in Leonce und Lena, Marie in Woyzeck, Anna Karenina und Kitty in Anna Karenina sowie Clara in Der Sandmann. Ausserdem trat sie in Zürich in Choreografien von Sol León/Paul Lightfoot, Douglas Lee, Martin Schläpfer, Wayne McGregor und Marco Goecke auf. 2014 wurde sie mit dem «Tanzpreis der Freunde des Balletts Zürich» ausgezeichnet.

Matthew Knight, Der Mohr
Matthew Knight
Matthew Knight ist Brite. Seine Ausbildung absolvierte er an der Elmhurst School und an der Royal Ballet School in London. Nach einer Spielzeit im Junior Ballett ist er seit der Saison 2014/15 Mitglied des Balletts Zürich. In der Reihe «Junge Choreografen» präsentierte er die Choreografien Jane Doe und Mocambo. Er tanzte in Choreografien von Mats Ek (Kavalier in Dornröschen), William Forsythe, Marco Goecke (Mohr in Petruschka), Jiří Kylián, Douglas Lee, Sol León/Paul Lightfoot, Hans van Manen, Wayne McGregor, Ohad Naharin, Crystal Pite und Filipe Portugal. Er war als Leonce in Christian Spucks Leonce und Lena, als Nathanael in Spucks Sandmann und als Clown in Spucks Nussknacker und Mausekönig zu erleben. Ausserdem tanzte er die Titelrollen in Faust von Edward Clug und Nijinski von Marco Goecke. 2016 wurde er mit dem «Tanzpreis der Freunde des Balletts Zürich» ausgezeichnet.
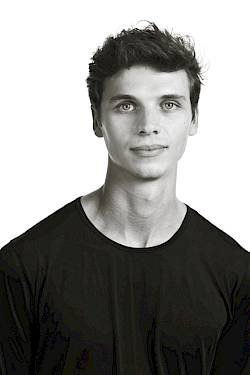
Mark Geilings, Der Zauberer
Mark Geilings
Mark Geilings stammt aus Australien, wo er an der Australian Ballet School ausgebildet wurde. Von 2012 bis 2015 tanzte er im Leipziger Ballett und trat dort in Choreografien von Uwe Scholz, Mario Schröder (Titelrolle in Otello), Meryl Tankard (Cinderella) und Ohad Naharin auf. In der Saison 2015/16 war er Mitglied von Gauthier Dance in Stuttgart, dort war er u.a. in Marco Goeckes Nijinsky zu erleben. Seit der Spielzeit 2016/17 ist er Mitglied des Balletts Zürich. U.a. war er in Petruschka von Marco Goecke, Kammerballett von Hans van Manen, Gods and Dogs von Jiří Kylián, Lady with a Fan von Douglas Lee und als Mercutio in Spucks Romeo und Julia zu sehen.


































