Monteverdi
Musiktheater von Christian Spuck
Musik von Claudio Monteverdi,
Benedetto Ferrari, Biagio Marini, Tarquinio Merula,
Francesco Rognoni und Giovanni Maria Trabaci
Uraufführung
In italienischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer ca. 2 Std. 25 Min. inkl. Pause nach ca. 1 Std. 05 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Partnerin Ballett Zürich 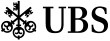
und mit der Unterstützung der Freunde des Balletts Zürich
Vergangene Termine
Januar 2022
Februar 2022
Gut zu wissen
Ab Freitag, 1. April entfällt die Maskenpflicht für das Publikum in allen Vorstellungen und Veranstaltungen im Opernhaus Zürich. Mehr Infos finden Sie hier.
Monteverdi
Kurzgefasst
Monteverdi
Mit Claudio Monteverdi hat alles angefangen. Mit dem bedeutendsten italienischen Komponisten des frühen 17. Jahrhunderts wird die Musik theatralisch. Liebende und Einsame, Eifersüchtige und Zornige betreten die Bühne, klagen ihr Leid und kehren im Gesang ihr Innerstes nach aussen. So sinnlich und herzzerreissend ich-bewusst war der singende Mensch bis dahin noch nicht in Erscheinung getreten wie in Monteverdis Opern, die zu den ersten der Musikgeschichte gehören, und in seinen Madrigalbüchern, in denen sich der Übergang vollzieht von der polyphonen Vokalkunst der Renaissance zur Ausdruckskraft der einzelnen, von Musik begleiteten menschlichen Stimme. Monteverdi macht für seine Madrigale einen genere rappresentativo geltend, einen darstellenden Stil, der nicht nur Szenisches, sondern auch Gestisch-Tänzerisches in Töne kleidet. Das berühmteste seiner Madrigalbücher ist das Achte und letzte, das der Komponist sieben Jahre vor seinem Tod veröffentlicht hat. Eine Stücksammlung, in der er gleichsam noch einmal die Summe seiner Stilentwicklungen und seines dramatischen Schaffens zieht. Musik aus diesem Achten Madrigalbuch steht im Zentrum von Christian Spucks neuem Ballettabend, der wie zuvor schon in den Choreografien von Verdis Messa da Requiem oder Schubert/Zenders Winterreise Vokalsolisten und das Ballett Zürich auf der Bühne vereint.
Sich mit Monteverdi zu beschäftigen, heisst noch einmal von vorne zu beginnen und dem Zauber des musiktheatralischen Anfangs nachzuspüren, der in dessen Arien, Tanzsätzen und Madrigalen erblüht. Wie etwa kann aus dem weltverlorenen Lamento della Ninfa, einem der berühmtesten Klagegesänge Monteverdis, Bewegung, Szene, Tanz erwachsen? Zu welchem choreografischen Ausdruck fordert die zitternd expressive Erregung von Il Combattimento di Tancredi e Clorinda heraus, dem Kampf eines sich feindlich und liebend zugleich gegenüberstehenden Paares? Christian Spuck sucht in diesem Ballettabend nicht nach einer Geschichte, die Monteverdis Minidramen überwölbt, sondern schöpft Energie aus der Kraft des Fragmentarischen und der tänzerischen Abstraktion in einem vom Bühnenbildner Rufus Didwiszus gestalteten Raum, der Theater nach dem Ende von Theater noch einmal von vorne beginnen lässt.
Pressestimmen
«Dem Zürcher Ballettchef gelingt an diesem Abend ein Paradox: Der Tanz tritt zurück – und gewinnt gerade dadurch an Ausdrucksmöglichkeiten.»
NZZ, 17.01.22«Spuck ist mutiger geworden, auch bezüglich der Geschlechterrollen»
Tages-Anzeiger, 17.01.22«Nur, wer derart hochklassig ist wie [das Ballett Zürich], vermag Monteverdi so zu tanzen: als Christian Spucks persönlichste, intimste Choreografie.»
CH Media, 17.01.22
Interview
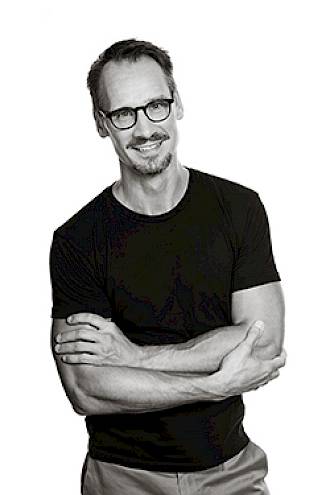
So einfach und so viel Gefühl
Christian Spuck ist fasziniert von den Madrigalen und Lamenti Claudio Monteverdis. Gemeinsam mit Sängerinnen und Sängern, dem Ballett Zürich, dem Orchestra La Scintilla und dem Dirigenten Riccardo Minasi entwickelte er Anfang 2022 einen Musiktheaterabend, der der zutiefst berührenden Emotionalität in der Musik des genialen Italieners nachspürt.
Christian, Claudio Monteverdi gehört zu den Komponisten, die dir viel bedeuten. Woher rührt diese persönliche Beziehung?
Ich habe seine Musik zum allerersten Mal bei einer Tanz-Produktion von Anne Teresa De Keersmaeker gehört, als ich 17 Jahre alt war. Da hat sie mich allerdings noch eher gelangweilt. Einige Jahre später habe ich mir dann bei Zweitausendeins, dem damals wichtigsten Schallplattenladen für junge Leute, die Gesamtaufnahme der drei MonteverdiOpern von John Eliot Gardiner gekauft und fand darin vor allem den grossen Anfangsmonolog von Penelope in Il ritorno d’Ulisse in patria wunderschön. Ich habe das auf meinem Walkman immer gehört und fand die Schlichtheit der Musik in Kombination mit der Direktheit, mit der die Emotionen zum Ausdruck kommen, total berührend. Das war der Beginn meiner Liebe zu Monteverdi, die nach und nach gewachsen ist. Die extrem reduzierte Form mit nur einer Gesangsstimme plus Lauten und Basso Continuo-Begleitung erzählt so viel. Kurz bevor ich nach Zürich kam, habe ich dann auch einen Ballettabend mit Musik von Monteverdi gemacht, der hiess Poppea, Poppea. Die Musik wurde darin aber nicht live gespielt. In unserer Zürcher Produktion, die wir im Moment proben, ist das anders: Hier kommen Sängerinnen und Sänger, unser Orchestra La Scintilla und die ganze Ballettcompagnie zusammen.
Claudio Monteverdi hat seit dem legendären Pionier-Zyklus mit Nikolaus Harnoncourt und Jean-Pierre Ponnelle am Opernhaus in Zürich eine grosse Renaissance auf den Opernbühnen erlebt. Seine Opern sind vielerorts fester Bestandteil des Repertoires geworden. Monteverdi hat aber auch Karriere im Privaten gemacht. Melancholische Menschen hören ihn wie Popsongs. Einige seiner populärsten Nummern sind regelrechte Hits bei Liebeskummer. Hörst du Monteverdi auch zu Hause nur für dich?
Ja, klar. Für mich war Monteverdi unabhängig von seiner Bühnenpräsenz immer auch etwas Privates. Das spielt auch in unserer Produktion eine Rolle. Ich habe mir die Highlights aus seinem Schaffen herausgesucht, die ich emotional besonders stark finde und die als Nummern für sich stehen können. Die meisten Stücke sind aus dem Achten Madrigalbuch. Es ist, wie du sagst: Viele Sachen sprechen zu uns wie Songs von heute, obwohl sie vierhundert Jahre alt sind.
Inwiefern eignet sich Monteverdis Musik für ein Ballett?
Ballett finde ich nicht den richtigen Begriff für das, was wir machen. Es ist umfassender. Ich sehe es als ein Musiktheater, in dem Gesang, Tanz und instrumentale Teile zusammenkommen. Ich habe sieben Sängerinnen und Sänger in dieser Produktion, so viele wie noch nie, dazu das gesamte Ballett Zürich. Aber deine Frage zielt ja darauf ab, wie viel Nähe zum Tanz per se in Monteverdis Musik steckt. Tanz spielt in seinen Werken durchaus eine wichtige Rolle in Form von Ritornellen oder Zwischenspielen, in den Madrigalbüchern gibt es explizit als «Balli» ausgewiesene «Ballette». Aber ausgerechnet die finde ich nicht so spannend, sie sind in der Form eher schematisch und vorhersehbar. Dem Tanz kam zu Monteverdis Zeiten eben eine ganz andere Bedeutung zu als heute. Das war zeremonielle Unterhaltung am Hof und hatte nicht den subjektiven Ausdruckscharakter, der für Monteverdis Musik so prägend ist. Mich interessiert die Vokalmusik und die emotionale Kraft, die ihr innewohnt. Sie inspiriert mich zu Tanz.
Du hast das Achte Madrigalbuch erwähnt. Was ist das Besondere an dieser Werksammlung?
Es ist Monteverdis letztes Madrigalbuch, in dem er noch einmal eine Art Summe seines Schaffens zieht. Er hat es Canti guerrieri et amorosi genannt, Lieder von Krieg und Liebe, wobei mit «Krieg» ein Krieg der Liebenden gemeint ist. Im Achten Madrigalbuch finden sich berühmte Stücke wie das Lamento della ninfa, Hor che’l ciel e la terra oder das unglaubliche Combattimento di Tancredi e Clorinda. Sie sind in einer interessanten Zwischenform komponiert – noch nicht richtige Oper, aber auch nicht mehr konzertanter Vortrag. Die Szenen werden durch erzählte Dramatik zum Ausdruck gebracht, die Figuren selbst treten nur sparsam in Erscheinung. Monteverdi hat dafür einen sehr expressiven Gesangsstil erfunden, er selbst nennt ihn «stile concitato», erregten Stil. Das macht die Werke für eine Umsetzung in abstrakten Tanz extrem spannend.
Wovon handeln die Stücke, die du für deinen Abend zusammengestellt hast?
Von Verlassensein, von Vereinsamung und gebrochenen Herzen. Eigentlich wohnt nur den eingeschobenen Tänzen eine gewisse Fröhlichkeit inne, ansonsten sind die Stücke sehr auf der melancholischen Seite. Melancholie ist ein grosses Thema im Schaffen von Monteverdi. Er konnte wie kein anderer zuvor Liebesschmerz und Welttraurigkeit in Töne fassen. Er hat dadurch etwas für die damalige Zeit völlig Neues in die Musik gebracht – das tief empfindende Individuum, das seine innersten Gefühle nach aussen kehrt. Vor Monteverdi wurde Musik vor allem für die Kirche, zum Lob Gottes geschrieben, oder sie diente zur Unterhaltung an Fürstenhöfen. Damit gab sich Monteverdi aber nicht zufrieden. Er wollte mit seiner Musik nicht mehr nur gefallen, sondern die Zuhörer erschüttern und zu Tränen rühren – und es ist ihm gelungen. Seine Aufführungen müssen für die damalige Zeit eine unglaubliche emotionale Intensität gehabt haben. Es gibt Berichte, in denen beschrieben wird, dass das Publikum beim Hören von Monteverdis Musik tatsächlich in Tränen ausgebrochen ist.
Wie könnte man den Abend, den du kreierst, überschreiben?
Es gibt ein berühmtes Buch aus dem 17. Jahrhundert, das zu Lebzeiten Monteverdis geschrieben wurde. Es heisst Die Anatomie der Melancholie von Robert Burton. Davon handelt auch unsere Arbeit: Unser neues Stück ist eine Art Untersuchung über das Wesen der Melancholie. Von welchen Gefühlszuständen ist sie geprägt? Wie äussert sie sich? Wie viele Facetten wohnen ihr inne? Ein anderer Aspekt ist theatralischer Art: Mit Monteverdi beginnt die Geschichte der Oper. Seine Musik ist der faszinierende Anfang von Oper mit und durch Musik, und diese Anfangssituation werden wir zum Thema machen, im Bühnenraum und in den fragmentarischen Szenen und Episoden, die darin stattfinden. Es ist ein Moment von Theatralität, dervor dem eigentlichen Beginn von Theater mit konsistenten Figuren und einer ausführlichen Handlung liegt. Es geht mehr um die Emotionen, die die Szenen hervortreiben, und da kann ich mit Tanz und einer abstrakten Choreografie sehr gut ansetzen.
Im Lamento della ninfa etwa klagt eine von ihrem Geliebten verlassene Nymphe. In Combattimento stehen sich Tancredi und Clorinda gegenüber, die aus feindlichen Lagern stammen, sich aber trotzdem lieben und einen Kampf auf Leben und Tod führen. Treten diese Figuren in deinem Musiktheater auf?
Ja und Nein. Es treten Tänzerinnen und Tänzer auf, die diesen Figuren für Momente eine emotionale Beglaubigung geben, aber sie sind nicht diese Figuren. Sie treten nicht als Nymphen auf. Alle Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne sollen durch ihre Kunst, also Gesang und Tanz, das vermitteln, wovon die Musik in ihrem Inneren handelt. Wir streben eine Gleichzeitigkeit von angedeuteter Narration und Abstraktion an. Wir versuchen den ersten Momenten von Musiktheater nachzuspüren, und mich interessiert dabei auch die Fragilität, die in so einem Anfang immer liegt.
Der Hauptakteur in Combattimento di Tancredi e Clorinda ist ein Erzähler, der den Kampf zwischen dem Kreuzritter Tancredi und der sarazenischen Heerführerin Clorinda schildert. Was heisst das für die Umsetzung auf der Bühne?
Es ist für einen Regisseur oder Choreografen immer eine grosse Herausforderung, wenn auf der Bühne erzählt wird, was geschieht. Dann macht es nämlich keinen Sinn mehr, es auch noch zu zeigen. Zeige ich es trotzdem, gibt es eine ungute Verdoppelung von Erzähltem und Gezeigtem. Das ist das Problem. Aber das Tolle an Monteverdis Musik ist ja, dass man bereits in den Beschreibungen des Erzählers den dramatischen Kampf hört, die wütenden Schwertschläge, das Blut, das aus den Wunden rinnt, das Entsetzen, das Seufzen. Alles ist musikalisch vor allem durch Sprache umgesetzt. Alles ist auch ohne Bühne da. Unsere Aufgabe ist es, diese Dramatik nicht durch eine zusätzliche szenische Bebilderung zu schwächen, sondern ihre emotionale Kraft zu verstärken, und das geht meiner Meinung nach nur mit Abstraktion in der Choreografie. Das Publikum soll gewissermassen mit dem Auge zuhören. Das wäre mein Wunsch.
Du sagst, du willst die Anfangssituation von Theater zum Thema machen. Kannst du etwas konkreter beschreiben, was das heisst?
Wir arbeiten alle am Theater, es ist unser Leben. Und es ist für uns selbstverständlich, dass wir auf der Bühne etwas erzählen. Ich finde es spannend, diese Selbstverständlichkeit zu hinterfragen und mit Monteverdi zu reflektieren: Wann beginnt Theater? Aus welchen Energien speist es sich? Durch was wird es in Gang gesetzt? Mein Bühnenbildner Rufus Didwiszus hat für unseren MonteverdiAbend einen Raum geschaffen, der Vieles ist: Man kann in ihm eine Landschaft sehen, den Innenraum eines geschlossenen Caféhauses, eine Wartehalle. Es liegen Requisiten herum. Der Ort verströmt eine melancholische Grundstimmung. In einer solchen Offenheit kann theatralische Kreativität entstehen.
Besteht nicht die Gefahr, dass ein Abend mit Monteverdis Musik im Liebesschmerz absäuft?
Ich hoffe nicht, dass das passiert. Ich habe in der Vorbereitung des Stücks nach einem musikalischen Kontrast zu Monteverdi gesucht. Ich wollte eine Leichtigkeit in die Produktion tragen und Humor, der den Schwermut der Lamenti bricht. Wir sind dann auf italienische Popsongs der sechziger und siebziger Jahre gekommen, die wir zwischen die Monteverdi-Stücke geschnitten haben. Monteverdis Texte handeln ganz oft von Liebeskummer und Verlassensein und haben darin viel Ähnlichkeit zu Schlagertexten, die wir heute hören. In die Stille zwischen den Madrigalen erklingen bei uns Schlager vom Band. Die vierhundert Jahre alte Musik schlägt in die Gegenwart von heute um, und aus dieser Stimmung entwickelt sich die nächste Monteverdi-Szene. Ich habe es mir humorvoll vorgestellt, wenn nach Monteverdi plötzlich Adriano Celentano kommt. Aber in den Proben haben wir dann festgestellt, dass die Stimmungslage sich gar nicht so sehr ändert. Die Melancholie bleibt. Sie liegt über der Musik aus beiden Genres, obwohl die so unterschiedlich sind. Trotzdem ist der Kontrast wichtig, denn das Combattimento di Tancredi e Clorinda beispielsweise ist so aufwühlend, dass man sich unweigerlich fragt, wie ein Abend nach diesem Stück überhaupt noch weitergehen kann. Das geht nur über einen scharfen Kontrast, durch Humor. Schade, dass das nur auf der Theaterbühne möglich ist und nicht im wirklichen Leben. Da würde man ja manche katastrophische Entwicklung auch gerne mit einem Witz relativieren, aber das hilft leider nicht.
Du sprichst wahrscheinlich die Corona-Situation an. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Art, wie in diesem Stück das Theater aus dem Nichts und dem Stillstand wieder Raum zu greifen versucht, auch mit der Erfahrung des Lockdowns zu tun haben könnte. Reagiert das Projekt auf die Zeit, in der an den Theatern Spielverbot herrschte und phasenweise nicht einmal geprobt werden konnte?
Die Idee zu Monteverdi ist eigentlich schon älter. Die hat uns schon beschäftigt, als es Corona noch nicht gab. Ich hab mich gefragt, wie es künstlerisch mit dem Ballett Zürich weitergehen könnte, als wir so erfolgreich waren, etwa nach Nussknacker und Mausekönig. Sollen wir die Handlungsballette und die konventionellen Formen weiter bedienen, oder sollen wir weitergehen und Grenzen ausloten? Bei Helmut Lachenmanns Mädchen mit den Schwefelhölzern haben wir das getan, das Werk war noch nie als Ballett zu sehen, und fünfzig Tänzerinnen und Tänzer haben sich über einen sehr langen Zeitraum mit komplexer zeitgenössischer Musik auseinandergesetzt. In unserem Monteverdi-Projekt sehe ich auch einen Versuch, aus den konventionellen Bahnen des Balletts auszubrechen und künstlerisches Neuland zu betreten. Leicht fällt das nicht. Es tauchen in der Entstehung des Abends jeden Tag mehr Zweifel und Fragen in meinem Kopf auf. Ich glaube, es gibt keine Produktion, mit der ich mehr kämpfen musste. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass die Genialität von Monteverdis Musik in ihrer Einfachheit liegt. Da trifft alles ins Schwarze. Anders als eine Oper von Verdi, die ohne Szene gar nicht denkbar ist, brauchen die Sachen eigentlich kein Theater und erst recht kein Ballett. Aber sie lassen einen auch nicht los, weil sie so wundervoll sind. Ich hoffe, wir finden bis zur Premiere noch Antworten auf die vielen Fragen.
Das Gespräch führte Claus Spahn.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 88, Januar 2022.
Das Mag können Sie hier hier abonnieren.
Gespräch

Wir erforschen die Quellen, probieren aus und diskutieren alles
Riccardo Minasi ist der musikalische Leiter des neuen Musiktheaterprojekts «Monteverdi» von Christian Spuck und übernimmt die künstlerische Verantwortung beim Orchestra La Scintilla. Ein Gespräch über Forschergeist und Fakegefahr in der Alte-Musik-Szene, Verdi-Experimente und den Reiz der grossen Sinfonieorchester.
Riccardo, du hast die künstlerische Leitung des Orchestra La Scintilla übernommen, ein Amt, das es bisher noch nicht gab. Was bedeutet es dir?
Es erfüllt mich mit grosser Freude. Ich habe hier in Zürich schon so viele Projekte realisiert, dass zwischen den Musikerinnen und Musikern und mir echte Freundschaften entstanden sind. Es gibt ein grosses gegenseitiges Vertrauen, das die Basis unserer Zusammenarbeit bildet.
Wie würdest du deine Aufgaben als künstlerischer Leiter von La Scintilla beschreiben?
Da lastet zunächst einmal eine grosse Verantwortung auf meinen Schultern. Das Ensemble steht in der Tradition von Nikolaus Harnoncourt, der in Zürich legendäre Pionierarbeit geleistet hat. Bei ihm hat die Zürcher Leidenschaft für Alte Musik ihren Ursprung, und es gibt noch viele Gründungsmitglieder von La Scintilla, die sie bis in die Gegenwart tragen und auch für mich wichtige künstlerische Partner sind, wenn ich etwa an Ada Pesch oder Dieter Lange denke. Dieser Tradition und dem damit verbundenen künstlerischen Anspruch müssen wir gerecht werden. Es ist eine Riesenherausforderung für die Ensemblemitglieder, an einem Abend eine Belcanto Oper von Donizetti auf modernen Instrumenten aufzuführen und am nächsten Abend Monteverdi auf historischen Instrumenten. Das ist Alltag am Opernhaus Zürich, erfordert aber viel stilistische und instrumentale Flexibilität.
Kann ein Ensemble, das sich aus den Reihen eines Opernorchesters bildet, mit den spezialisierten Barockorchestern konkurrieren?
Natürlich. Ich werde immer ganz skeptisch, wenn von sogenannten «Spezialisten» die Rede ist. Riccardo Minasi ist ein Spezialist für dieses und das Ensemble ein Spezialorchester für jenes – ich weiss gar nicht, was das sein soll. Das sind Schubladen, die überhaupt nichts aussagen. Ich sehe ein anderes Problem in der Szene für historisch informierte Aufführungspraxis. Als Geiger habe ich über Jahrzehnte hinweg in all diesen Ensembles mitgespielt und festgestellt, dass es bei vielen einen Mangel an Quellenforschung gibt. Pioniere wie Nikolaus Harnoncourt, Sigiswald Kuijken, Gustav Leonhardt oder Roger Norrington haben die Forschung vorangetrieben. Aber dieser Elan droht zu erlahmen. Es gibt inzwischen viel Fake.
Bei Scintilla nicht?
Wir versuchen, den Zugang zu den Werken mit grösstmöglicher Seriosität zu erarbeiten. Wir suchen und experimentieren. So haben wir etwa vor Corona mit Hilfe eines Geigenbauers aus Cremona das Setup der Streicher geändert, um einen anderen Klang zu kreieren, und das hat bereits sehr positive Ergebnisse gebracht.
Was heisst das genau?
Wir haben daran gearbeitet, dass alle Streichinstrumente die gleichen Saiten, den gleichen Steg, den gleichen Neigungswinkel des Halses haben, so wie es historisch belegt ist. Heutzutage besitzt man ein Instrument und versucht, die passenden Saiten dafür zu finden, früher war es andersherum: Man hatte Saiten, für die man einen passenden Instrumentenkörper baute. Was wir versucht haben, folgt dem Prinzip, historisch rekonstruierte Saiten für unsere Instrumente möglich zu machen und die Art der Saiten im Ensemble zu vereinheitlichen. Man muss da viele Aspekte im Auge behalten. Ich selbst habe mich intensiv mit rekonstruierten historischen Darmsaiten beschäftigt, Quellen studiert, mit Experten geredet und sogar angefangen, die Saiten selbst herzustellen. Wenn man, wie wir das getan haben, den Auf bau verändert, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Spielweise. Man muss die Technik anpassen, um die Saiten sauber zum Klingen zu bringen.
Wie hat das den Klang des Ensembles beeinflusst?
Der Klang ist unverwechselbarer geworden, ein bisschen wärmer, klarer in der Artikulation und in der Attacke, auf eine Art auch etwas geräuschhafter, und es gibt grössere dynamische Möglichkeiten. Das ist natürlich jetzt eher verallgemeinernd gesagt, das Publikum soll sich in jedem Konzert selbst ein Bild machen. Die Experimentierfreudigkeit ist übrigens bei den Bläsern genauso gross, die sind auch immer auf der Suche nach neuen instrumentalen Entwicklungen. Diese generelle Leidenschaft im Ensemble, zu forschen, finde ich grossartig. Wir probieren aus, überlegen gemeinsam, diskutieren alles. Natürlich gebe ich als Leiter eine gewisse Richtung vor und fühle mich für das interpretatorische Ergebnis verantwortlich.
Eure stilistischen Überlegungen scheinen auch über das angestammte Repertoire des 17. und 18. Jahrhunderts hinauszugehen, wie man eurer CD entnehmen kann, auf der ihr Verdi in historisch informierter Aufführungspraxis spielt.
Ja, das ist eine der Ideen, die wir diskutieren. Wir wollen unser Repertoire erweitern. Warum sollten wir unsere Erfahrungen nicht auch aufs 19. Jahrhundert ausweiten?
Wann wäre La Scintilla von der instrumentalen Ausstattung her so weit, eine Verdi-Oper in historisch informierter Aufführungspraxis zu präsentieren?
Eigentlich jetzt schon, und das gilt nicht nur für Verdi, sondern auch für andere Komponisten von Bellini bis Wagner. So etwas auszuprobieren, wäre natürlich fantastisch, aber wir wollen auch niemandem etwas wegnehmen, denn im Moment wird das VerdiRepertoire ja von der Philharmonia Zürich gespielt mit den entsprechenden Dirigenten. Ausserdem müsste man dann auch über Stimmen und ihre Stilistik diskutieren. Wir sind es gewohnt, Verdi mit grossen Stimmen zu hören. Aber die Sängerinnen und Sänger, mit denen Verdi selbst gearbeitet hat, besassen eine andere Charakteristik, das wissen wir aus Quellen und frühen Tonaufnahmen. Zu Verdis Zeit schätzte man klar definierte Stimmregister zwischen sonorer Brust und einer funkelnden Kopfstimme, sozusagen Marilyn Horne und Emma Kirkby in einer Person. Heute will man eine makellose Verblendung der Register. Das wiederum ist etwas, das man zum Beispiel zu Monteverdis Zeit angestrebt hat. Deshalb haben wir auch Christian Spucks aktuelle MonteverdiProduktion mit wirklichen Opernstimmen besetzt. Die zarten Stimmen, die uns heute besonders original und historisch vorkommen, waren zu Monteverdis Zeiten nicht üblich. Sie sind eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Damals hatten die Sänger voluminöse Stimmen durch alle Register. Einen Countertenor gab es in Monteverdi-Aufführungen nicht, allenfalls in der Kirchenmusik.
Aber es gab die Kastraten.
Ja, klar. Aber das ist von der Stimme her etwas ganz anderes als ein Countertenor. Die Kastraten haben mit ihrer natürlichen Stimmlage gesungen und nicht im Falsett. Die Gesangstechnik, die die Countertenöre im Verlauf des 20. Jahrhunderts entwickelt und immer weiter perfektioniert haben, hat natürlich phänomenale Stimmen hervorgebracht wie Franco Fagioli, Max Emanuel Cenčić oder Philippe Jaroussky. Ich habe mit vielen von ihnen gearbeitet.
Sie sind grossartige Künstler, aber ihre Gesangstechnik ist eine Erfindung von heute und nicht historisch belegt. Sind letztlich nicht alle Rekonstruktionsversuche Erfindungen unserer Zeit?
Rekonstruktionen sind immer utopisch. Eine historisch korrekte Rekonstruktion würde wahrscheinlich noch nicht einmal bei einer Aufführung funktionieren, die nur fünfzig Jahre zurückliegt und von der wir eine Aufnahme besitzen. Dementsprechend hypothetisch ist es, eine Aufführung zu rekonstruieren, die dreihundert Jahre zurückliegt. Je länger ich mich mit diesen Themen befasse, desto mehr wird mir klar, dass man die Erkenntnisse immer in Beziehung zu unserer heutigen Rezeption setzen muss. Es geht immer auch darum, wie weit man gehen kann. Es kann passieren, dass man unter Berücksichtigung aller Quellen und Erkenntnisse bei einer Art zu spielen landet, die heute nicht akzeptiert würde. Man muss eine Balance finden zwischen den Erkenntnissen und der Rezeptionssituation.
Kannst du ein Beispiel dafür geben?
Da ist zum Beispiel die Frage nach den metrischen Freiheiten innerhalb eines Taktes, dem sogenannten Tempo rubato. Wie inegal hat man etwa zu Georg Friedrich Händels Zeiten gespielt? Es gibt im Brüsseler Instrumentenmuseum Walzen für automatische Orgeln, die von einem Musiker aus Händels Umfeld stammen, Orgelkonzerte, Arrangements von Ouvertüren und Ähnliches. Sie führen uns klanglich vor Augen, was mit dem inegalen Spiel gemeint war, von dem in schriftlichen Quellen die Rede ist. Würden wir das heute so machen, gäbe es einen Skandal im Publikum. Die Leute würden sagen, die sind besoffen. Man muss sich immer im Klaren darüber sein, dass wir über Moden reden, wenn wir über Stil sprechen. Und unser Blick auf Moden ändert sich ständig. Wir kennen das doch, wenn wir alte Fotos anschauen und uns kaputtlachen, in welchen Klamotten wir damals herumgelaufen sind. Wie die Mode ändert sich auch unser Hören.
Hat die musikwissenschaftliche Forschung nicht die Wahrheit zum Ziel?
Es gibt nicht die eine Wahrheit, und es gibt nicht nur eine Richtung in der Forschung. Das ist ja das Faszinierende auf dem Gebiet des Erklingenden – der Gegenstand ist immateriell und deshalb flüchtig, und die Erkenntnisse sind angreifbar.
Gibt es bei Monteverdi heute noch neue Erkenntnisse oder ist alles weitgehend erforscht?
Viel Neues gibt es da nicht mehr so. Aber mich überrascht, dass viele Informationen in der täglichen Praxis noch nicht angekommen sind. Wir wissen so viel über die künstlerischen Absichten dieses Künstlers, aber das wird leider oft ausser Acht gelassen. Wenn ich selbst an einer Aufführung beteiligt bin, steht am Anfang immer eine Vorbereitung, die einen möglichst genauen, sorgfältigen Zugang zum Text und den Quellen miteinschliesst. Dass die Aufführung dann durch meine subjektiven Empfindungen als musikalischer Leiter geprägt wird, versteht sich von selbst.
Bei Monteverdi besteht der Notentext nur aus den Vokalstimmen und dem Basso continuo. Die Instrumentierung richtet jeder musikalische Leiter ein. Wie sieht dein Konzept für unsere Monteverdi-Produktion aus?
Wir folgen den Angaben des Komponisten. Im Siebten und im Achten Madrigalbuch, aus denen die meisten Musiken stammen, ist Monteverdi geradezu überpräzise, was die Angaben zur Instrumentation angeht. Wir spielen nur mit Streichern und einer Continuogruppe und fügen auf keinen Fall Flöten oder Hörner hinzu. Wenn Monteverdi diese Instrumente will, schreibt er das. Es gibt Musiker, die der Kraft von Monteverdis Musik nicht wirklich vertrauen. Sie meinen, sie müssten sie anreichern und Instrumente hinzufügen, um sie noch aufregender zu machen. Dabei ist die Musik extrem kraftvoll, wenn man sie genauso spielt, wie sie ist. Die braucht keine Extras. Das heisst andererseits aber nicht, dass alles festgelegt ist. Selbstverständlich gibt es bei Monteverdi viele Freiheiten, etwa im Hinblick auf Phrasierungen und Ornamentierungen.
Wir erleben in Zürich also ein klein besetztes Instrumental-Ensemble, kombiniert mit echten Opernstimmen. Passt das zusammen?
Natürlich. Die Violine war zu Monteverdis Zeiten ein ganz junges Instrument. Sie war noch nicht einmal ein Jahrhundert alt und damals Ausdruck höchster instrumentaler Innovation. Man konnte mit dem Klang dieses revolutionären Instruments plötzlich den Kirchenraum füllen, unabhängig von den Orgeln. Die Geigen hatten eine doppelt so hohe Zugspannung auf den Saiten wie unsere heutigen Instrumente. Deshalb stimmt es nicht, wenn behauptet wird, die Barockgeigen seien schwache Instrumente mit wenig Klang gewesen. Das ist nur ein Missverständnis von vielen.
Man spürt im Gespräch mit dir, dass du von der Geige kommst. Wie hast du den Weg zum Dirigieren gefunden?
Ich habe mir nie vorgenommen, Dirigent zu werden, es ist einfach so passiert. Ich war mit meinen vielfältigen Aktivitäten als Geiger sehr zufrieden und habe in vielen Ensembles und Orchestern als Konzertmeister gespielt. In dieser Funktion habe ich auch Proben vorbereitet und Einstudierungen übernommen. Eine entscheidende Wende hin zum Dirigieren war 2008 in Montreal, als Kent Nagano mich bat, die Proben von Tschaikowskis Jewgeni Onegin vorzubereiten. Das ist nun wirklich kein Werk, das man vom Konzertmeisterstuhl aus leiten kann. Ich musste also meine Geige zur Seite legen und mit den Händen Zeichen geben. In dem Moment dachte ich: Ein paar Dirigierstunden könnten nicht schaden. Ich wollte mir die Fähigkeiten eigentlich nur aneignen, um meinen Job als Konzertmeister und Assistent besser machen zu können. Aber dann hat sich die Dirigiertätigkeit immer weiterentwickelt. Das Opernhaus Zürich beispielsweise gab man mir die allererste Gelegenheit, eine Oper szenisch auf die Bühne zu bringen. Das war vor acht Jahren Domenico Cimarosas Il matrimonio segreto in einer Produktion mit dem Internationalen Opernstudio. Für diese Chance bin ich sehr dankbar. Als ich zum ersten Mal vor der Philharmonia Zürich stand, war ich einer von diesen jungen schwitzenden Dirigenten, die dem Orchester vor Aufregung ganz kurzatmig erklären, wie sie spielen sollen. Als ich selbst noch am Ersten Pult in den Orchestern sass, habe ich genau diese jungen, schwitzenden, kurzatmigen Dirigenten gehasst. Plötzlich war ich selbst einer.
Und deine Erfahrung als Konzertmeister kam dir zugute.
Klar. Am meisten lernt man von den schlechten Dirigenten und von den Fehlern, die sie machen. Ich habe oft gedacht: Falls ich irgendwann mal selbst am Dirigentenpult stehen sollte, werde ich diesen Fehler ganz bestimmt nicht machen.
Du leitest in Zürich das Orchestra La Scintilla, aber du bist in deiner Arbeit als Dirigent nicht festgelegt auf Ensembles, die auf historischen Instrumenten Werke der Klassik und der Vorklassik spielen. War es ein bewusster Schritt, dieses Repertoire, indem du lange zu Hause warst, zu verlassen und zu neuen Ufern aufzubrechen?
Ich habe Spass daran, alles Mögliche auszuprobieren. Ich habe mein ganzes Leben lang schon immer Sachen zu machen versucht, die grösser sind als ich. Wenn man nur macht, was man kann, kommt man nicht so weit, als wenn man sich immer wieder darüber hinauswagt. Jetzt bereite ich gerade die Monteverdi-Produktion mit Christian Spuck vor, vergangene Woche habe ich die Oper Agrippina von Händel in Hamburg dirigiert, davor Gustav Mahlers Dritte Sinfonie in Salzburg. Ich mache einen Freischütz mit dem Concertgebouw Orkest an der Amsterdamer Oper und habe eine Einladung der Berliner Philharmoniker für die übernächste Saison. Jetzt, wo ich mein neues Spielzeug, ein Orchester zu dirigieren, langsam beherrsche, will ich es auch in all seinen Facetten ausprobieren.
Du wandelst auf Karajans Spuren.
Nein. Um Gottes Willen. Ich bin einfach nur neugierig.
Riccardo Minasi ist gebürtiger Römer. Als Violinist hat er sich früh der Barockgeige zugewandt. Er war Konzertmeister und Solist in zahlreichen international bekannten Ensembles für Alte Musik, bis er eine Dirigentenlaufbahn startete. Minasi ist seit 2017 Chefdirigent des Mozarteumorchesters in Salzburg. Mit dem Zürcher Orchestra La Scintilla hat er zahlreiche Konzertprojekte und unter anderem eine hochgelobte CD mit den «Vier Jahreszeiten» von Vivaldi und Verdi realisiert.
Das Gespräch führte Claus Spahn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 88, Januar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Fragebogen

Lauren Fagan
Lauren Fagan ist eine der beiden Sopranstimmen in unserer Produktion «Monteverdi». Sie wurde in Australien geboren und hat in London studiert. In der vergangenen Spielzeit war sie die Giulietta in Offenbachs Oper «Les Contes d’Hoffmann», die Andreas Homoki am Opernhaus Zürich neu inszenierte.
In welche Welt tauchen Sie ein, wenn Sie Musik von Claudio Monteverdi in der Ballettproduktion von Christian Spuck singen?
Ehrlich gesagt, ist diese Monteverdi-Welt für mich völlig neu. Ich singe Monteverdis Musik zum ersten Mal. Sie wird jetzt für mich immer mit Tanz verbunden sein. Wenn ich die Madrigale höre, ruft das tiefe Gefühle in mir wach. Die Poesie und die unglaublichen Harmonien mit ihren Dissonanzreibungen versetzen mich in eine melancholische Stimmung. Und das ist ja genau das, was Christian Spuck erreichen wollte.
Sie treten in Monteverdi gemeinsam mit den Tänzer*innen des Balletts Zürich auf. Was gibt Ihnen diese künstlerische Begegnung?
Die Arbeit mit Christian und dem Ballett Zürich ist für mich künstlerisch sehr erfüllend. Obwohl wir unterschiedliche künstlerische Sprachen sprechen, haben wir uns sofort verstanden. Selbst wenn ich die Bewegungen der Tänzer*innen auf der Bühne nicht sehe, kann ich ihre emotionale Intention spüren und sie mit meiner Stimme ausdrücken.
Können Sänger*innen etwas von Balletttänzer*innen lernen?
Auf jeden Fall. Die Disziplin, die Hingabe, mit der sie ihre Kunst betreiben, die Teamarbeit, die Feinheit von Christians Choreografie – das alles hat mich sehr inspiriert.
Woran merkt man, dass Sie Australierin sind?
Ich habe auf meinen Reisen immer ein Glas Vegemite dabei. Das ist der Brot aufstrich, den wir Australier lieben und den der Rest der Welt sehr gewöhnungsbedürftig findet.
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Als ich zur Schule ging, habe ich viel im Chor und in Musicals gesungen und während dieser Zeit meine Leidenschaft für die Stimme und für das Auftreten entdeckt. Ohne diese Erfahrung hätte ich nie den Weg zur Oper gefunden.
Mit Monteverdi hat die Kunstform Oper begonnen. Was muss passieren, dass sie auch in hundert Jahren noch existiert?
Die Regierungen müssen Musik von Anfang an als festen Bestandteil in die Bildung integrieren und Kindern aus allen sozioökonomischen Schichten die Möglichkeit geben, in einem Chor zu singen, ein Instrument zu spielen, eine Oper zu sehen oder ein Orchester live spielen zu hören. Das ist die einzige Möglichkeit, wie die Oper in Zukunft ein Publikum haben wird.
Welches Buch würden Sie niemals aus der Hand geben?
Die Kameliendame von Alexandre Dumas, ein Geschenk meines Gesangslehrers. Ich lese den Roman immer wieder – besonders, bevor ich Violetta singe.
Welche CD hören Sie immer wieder?
Im Moment höre ich jeden Tag Puccinis La rondine mit Antonio Pappano als Dirigent und Angela Gheorghiu und Roberto Alagna.
Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?
Ich habe es noch nicht gekauft, aber ich will unbedingt ein Bild von Palm Beach in Sydney für meine Wohnung kaufen, damit ich jeden Tag an meine Heimat denken kann.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 89, Februar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Hintergrund
Herr Földényi, wir wollen mit Ihnen über Melancholie reden. Sie haben zwei vielbeachtete Bücher darüber geschrieben, zuletzt das Lob der Melancholie. Ist die Melancholie Ihr grosses Lebensthema?
Das scheint so zu sein, ja. Ich komme von dem Thema nur schwer los. Auch andere meiner Bücher, etwa über Caspar David Friedrich oder Heinrich von Kleist, hatten mit Melancholie zu tun. Diese beiden Künstler sind in meinen Augen auch grosse Melancholiker. In meinem ersten Buch aus den achtziger Jahren habe ich die Geschichte der Melancholie erforscht und war fasziniert davon, wie unterschiedlich sie in den verschiedenen Epochen bewertet wurde. Für die Griechen waren viele herausragende Persönlichkeiten Melancholiker, von den Heroen bis zu Philosophen wie Empedokeles oder Platon. Im Mittelalter galten die Geisteskranken und Gottesleugner als Melancholiker. In der Renaissance waren es hauptsächlich die grossen Künstler, im 17. und 18. Jahrhundert die Faulen, die vom Leben Gelangweilten und die Aussenseiter der bürgerlichen Gesellschaft. Im 19. Jahrhundert verdrängt der Begriff der Depression die Melancholie, und im 20. Jahrhundert wird sie zum kitschigen Gemeinplatz: Melancholisch war ein schöner Spaziergang im Sonnenuntergang am Meer und ähnliches.
Aber der depressive Mensch im Verständnis unserer Zeit ist nicht gleichzusetzen mit dem Melancholiker, über den Sie reflektieren. Wie lässt sich das Phänomen der Melancholie denn für uns heute fassen?
Nach der Beendigung meines Buches über die Geschichte der Melancholie hat mich der Gedanke nicht mehr losgelassen. Wenn man trotz unterschiedlichster Deutungen immer am Begriff «Melancholie» festgehalten hat, muss es über die Jahrhunderte hinweg einen gemeinsamen Nenner geben, und dem bin ich in meinem zweiten Buch nachgegangen. Ich wollte herausfinden, was die griechischen Philosophen, die Herätiker, die Gelangweilten und die Genies gemeinsam haben. Man kann die Melancholie nicht auf einen klaren Begriff reduzieren, aber ich habe festgestellt, dass sie schon immer mit einem Verlust des Weltvertrauens einherging. Melancholiker haben die schwarzen Schatten über der jeweiligen Zivilisation wahrgenommen, und sie waren überzeugt, dass es noch etwas hinter der Hülle der realen Welt geben muss. Das klingt nach einem religiösen Gedanken, aber die Melancholiker sind nicht religiös. Der Gläubige hat ein festes Vertrauen ins Jenseits, der Melancholiker nicht. Trotzdem kann der Melancholiker nicht akzeptieren, dass die reale Welt die endgültige Verfasstheit unseres Daseins ist, es muss noch etwas anderes geben. Der Dichter Charles Baudelaire hat in einem Aufsatz über die «irritierende Melancholie» geschrieben, die der Musik und der Poesie entspringt. Sie brächte uns eine Welt, die jenseits des Grabes liegt, zum Vorschein. Das fand ich einen schönen Gedanken. Baudelaire sieht das Jenseits hier bei uns, nur wir bemerken es nicht. Im Bekannten das Unbekannte zu erkennen, sei Melancholie. Ich stimme Baudelaire zu. Melancholie hat mit Offenheit für Metaphysik zu tun.
Das Melancholische bringen wir immer mit einer gewissen Gestimmtheit des Menschen in Verbindung. Wenn der Begriff aber so gross und so weit gedacht ist, in welche Stimmung gerät dann der melancholische Mensch?
Mich stört es, wenn man Melancholie auf Schwermut, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit oder Weltschmerz reduziert. Man kann als Melancholiker auch heiter und glücklich sein. Novalis war oft heiter, aber ein grosser Melancholiker. Für den englischen Romantiker John Keats war die Melancholie «the very temple of delight». Melancholie ist mehr als ein Gefühl, sie ist eine Art von Weltsicht. Der Melancholiker will unsere Welt in Richtung des Unbekannten erweitern. Das Unbekannte kennt er nicht, aber es zieht ihn an.
Ist die Melancholie ein erstrebenswerter Zustand für den Menschen?
Ich würde sagen, man strebt nicht nach Melancholie, sondern man wird melancholisch, ohne es zu merken. Wenn man sich in Musik vertieft, hört man am Ende etwas, das über die Musik hinausgeht. Der Schriftsteller Louis-Ferdinand Céline sagte, in jeder Musik stecke ein einziges Lied, und das sei das Lied vom Tod. Der Gedanke, dass aus jeder Musik die ungeschriebene Weise vom Tod herauszuhören ist, gefällt mir. Diese Erfahrung kann man nicht nur bei Monteverdi oder Gustav Mahler machen, sondern selbst bei Haydn, der helle Musik komponiert hat.
Welches Verständnis von Melancholie hatte man zu Lebzeiten von Monteverdi im 17. Jahrhundert?
Ein typischer Melancholiker in der Spätrenaissance war der italienische Neuplatoniker Marsilio Ficino. Er hatte ein zwiespältiges Verhältnis zu seiner eigenen Melancholie. Einerseits litt er daran und beklagte sich ständig: «Warum bin ich im Zeichen des Saturn geboren? Warum bin ich so unglücklich?» Anderswo schreibt er dann, dass gerade Saturn für die geistige Ausserordentlichkeit verantwortlich sei. Der Zwiespalt, einerseits verdammt und andererseits ein Auserwählter zu sein, war typisch für die Renaissance. Zu Monteverdis Zeiten war man stolz auf diesen Zwiespalt.
Die Renaissance steht für das grosse Erwachen des Menschen in der Kunst, wie es ja auch bei Monteverdi zu erleben ist. Öffnet dieses aufblühende Ich-Bewusstsein auch der Melancholie die Pforten?
Das kann man so sagen. Die Melancholie hat in dieser Zeit eine grosse Epoche. Das Ich im neuzeitlichen Sinne wird hier geboren, immer mehr Schichten des Individuums kommen zum Vorschein, voll mit Widersprüchen natürlich. Wenn man Vasaris Lebensgeschichten der grossen Maler liest, stellt man fest, wie viele von ihnen Melancholiker waren. Das macht sie unglücklich und befähigt sie gleichzeitig dazu, geniale Werke zu schaffen.
Es gibt ein berühmtes Buch, das im 17. Jahrhundert entstanden ist, Die Anatomie der Melancholie von Robert Burton. Sie kennen es natürlich. Kann man aus der Existenz dieser grossen Abhandlung schliessen, dass die Epoche Monteverdis nicht nur eine melancholische war, sondern auch eine, in der besonders intensiv über das Wesen der Melancholie nachgedacht wurde?
Das würde ich so nicht sagen. Die Melancholie ist von jeher ein Gegenstand der Reflexion, schon bei Aristoteles. Die Melancholie ist geradezu eine Condition humaine. Sie gehört zum Menschsein.
In den Madrigalen und Lamenti von Monteverdi geht es ganz oft um Liebesschmerz. Die Einsamen und Verlassenen klagen ihr Leid. Ist denn Liebeskummer überhaupt ein Ausdruck von Melancholie, so wie Sie sie verstehen?
Natürlich. Liebe ist immer eine Form von Selbstverlust. Man verliert sich, wenn man verliebt ist, egal ob die Liebesgefühle einseitig oder gegenseitig sind, und gerade in den Situationen, in denen man kopflos ist, ist man am nächsten bei sich selbst. Das ist eine sehr melancholische und vielversprechende Gefühlslage.
Bei Monteverdi ist dem Schmerz der Liebeskranken immer auch eine Süsse beigemischt, ein Genuss. Ist der Teil der Melancholie?
Unbedingt. Das Schwelgen gehört dazu. Mir fällt da sofort das berühmte Schluss Duett «Pur ti miro, pur ti godo» aus Monteverdis Oper L’incoronazione di Poppea ein, das finde ich einfach wunderbar. Poppea und Nerone sind am Ende und überschreiten in dem Duett eine Grenze, nicht ins Jenseits, sondern in eine Sphäre, in der alles, was bisher geschah, nebensächlich wird. Das ist unendlich traurig und zugleich voller Glück. Auf diese Art eine Oper zu beenden, ist einmalig.
In dem Madrigal Interrotte speranze, zu deutsch «Erstickte Hoffnungen», will das lyrische Ich die «wilde Liebesglut nur noch mit Seufzern nähren und den Kummer vor spähenden Augen verstecken». Ziehen sich Melancholiker immer in die Einsamkeit zurück, oder ist auch eine kollektive Melancholie denkbar?
Das bezweifle ich. Ich glaube, die Melancholie ist ein sehr privater Zustand. Oft bemerkt man die Melancholie erst, nachdem der Zustand schon vorbei ist. Und oft merkt man überhaupt nicht, dass man gerade melancholisch ist. Lord Byron beschreibt in seinem Tagebuch, wie er an einer Festtafel seine Gäste unterhielt. Er war lustig, glänzte, alle lachten, und zu seiner Frau rief er: «Siehst du, Bell, und mich nennt man einen Melancholiker!» Sie erwiderte: «Ja! Du bist der melancholischste Mensch der Welt, und gerade, wenn du am fröhlichsten bist.»
Der Choreograf unserer Monteverdi-Produktion, Christian Spuck, hat den Abend in Fragmentform angelegt als ein Puzzle mit vielen offenen Enden, und schon in den Proben ist zu spüren, dass sich durch diese Form in Verbindung mit Monteverdis Musik Räume für eine ganz eigene weltverlorene Stimmung auftun. Gibt es Verbindungen zwischen dem Fragmentarischen und dem Melancholischen?
Fragmente sind immer wichtige Herausforderungen. Besonders in der Romantik spielen sie eine grosse Rolle. Wenn das Fragment nicht als abgebrochener Teil eines einheitlichen Ganzen erscheint, sondern nur als Fragment existiert, ist es ein typisches Symbol der Melancholie.
Sie schreiben in Ihrem Buch, der Melancholiker nehme Welt in Stücken wahr, und zitieren John Dunne, der schreibt: «Alles in Scherben ohne Bezug, hier ist zu wenig und dort nie genug.»
Wir leben eigentlich in Fragmenten. Der Weg von der Geburt bis zum Tod ist ein Fragment, nichts anderes. Natürlich streben alle Religionen danach, dieses Fragment des Lebens in ein grosses Ganzes einzubetten. Der Melancholiker zweifelt daran und geniesst das Leben als Fragment.
In der Moderne ist das eine sehr unzeitgemässe Lebenseinstellung. Wir wollen die Welt immer zu einem sinnhaften, kompletten Ganzen zusammensetzen.
Ja, das machen diejenigen, die alles erklären wollen, die Technokraten, die Gläubigen. Der Melancholiker geht einen anderen Weg. Er kann die Unlösbarkeit von Dingen akzeptieren.
Ist die Melancholie also auch ein Affront gegen die Moderne?
Schon. Sie ist eine anachronistische Anlage. Sie ist jetzt kein aggressiver Akt gegen die moderne Welt, aber wenn man melancholisch wird – und das erlebt jeder Mensch –, erkennt man, wie ungenügend all das ist, was uns horizontal umgibt. Die Moderne möchte für alles Lösungen finden, aber das geht natürlich nicht.
Wird die Melancholie in unserer Zeit als Depression pathologisiert?
Die Depression ist eine Krankheit, die man behandeln muss mit Medikamenten und Therapie, sie ist eine Last. Aber Melancholie ist keine Last für den Menschen. Sie macht einen offen für Fragen, die wir sonst nur selten stellen. Diese vermeintliche Gewissheit, dass wir alles im Griff haben, wird von den Melancholikern in Frage gestellt, etwa in Situationen übergrosser Trauer, überfliessender Liebe, kathartischen Kunstgenusses oder einem Zustand der Extase. Dann hat man das Gefühl, dass es wichtigere Horizonte gibt als die, die wir jeden Tag um uns herum sehen. Ich glaube, Melancholie ist eine sehr gesunde Einstellung zur Welt.
László Földényi zählt zu den bedeutendsten ungarischen Intellektuellen und leitet als Professor den Lehrstuhl für Kunsttheorie an der Akademie für Theater und Film, Budapest. Sein Buch «Lob der Melancholie» erschien 2019 im Verlag Matthes & Seitz und wurde mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnet.
Das Gespräch führten Michael Küster und Claus Spahn
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 88, Januar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Die geniale Stelle
So etwas hat es gegeben! Ein Komponist präsentiert sein neuestes Werk und erntet helle Begeisterung, weil seine Musik ganz modern ist, nur so strotzt von kühnen Harmonien, neuartigen Klangfarben und ungewöhnlichen Spieltechniken. Die Zuhörer lauschen mit angehaltenem Atem einer Erzählung, die sie zwar gut kennen, aber noch nie so gehört hatten. Ein Werk der musikalischen Avantgarde eroberte sein Publikum im Sturm. Das waren noch Zeiten!
Mehr noch: Monteverdis Vertonung einiger Verse aus Torquato Tassos Epos Das befreite Jerusalem mutet auch nach fast vierhundert Jahren noch frisch und fast zeitgenössisch an. Erzählt wird eine Episode der Zeit des ersten Kreuzzugs: Der christliche Ritter Tancredi kämpft in der Nacht mit der sarazenischen Kriegerin Clorinda, die er für einen Mann hält. Zu spät erkennt er, dass er die Frau getötet hat, die er über alles liebte. Sie vergibt ihm, bittet ihn um die Taufe und stirbt in seinen Armen. Das ist eine Geschichte, die ein grosses Orchester mit reichem Schlagwerk zu verlangen scheint – Monteverdi beschränkt sich auf drei Singstimmen und ein kleines Streicherensemble und vollbringt das Wunder, durch geschickten Einsatz neuer Techniken wie Tremolo und Pizzicato den Lärm der Schlacht und die Wut der Krieger so plastisch zu schildern, dass sich der Zuhörer mitten in das Geschehen versetzt fühlt. Aber nicht nur diese spektakulären Effekte begeistern; vielleicht noch erstaunlicher ist Monteverdis Fähigkeit, mit feinsten Ausdrucksnuancen das ganze Spektrum menschlicher Empfindungen von wütendem Hass bis zur zärtlichsten Liebesgeste auszudrücken und so auf kleinstem Raum eine gewaltige, tief ergreifende Tragödie zu gestalten.
Wer in diesem Werk die eine «geniale Stelle» sucht, wird sich nicht entscheiden können, denn hier ist buchstäblich jeder Takt ein Geniestreich. Das zeigt schon der scheinbar ganz unauffällige Anfang: «Tancredi, der Clorinda für einen Mann hält, will sich mit ihr im Kampf messen.» Mit dieser schnörkellosen Mitteilung beginnt das Stück, und die Singstimme scheint denselben trockenen Ton anzuschlagen, indem sie den Text auf einem einzigen Ton psalmodierend vorträgt. Aber etwa in der Mitte der Phrase schleicht sich eine kleine Abweichung ein: Plötzlich sinkt die Stimme um einen Ganzton nach unten, um aber sofort wieder aufzusteigen. Ein winziges Zittern der Stimme, das auf die emotionale Beteiligung des Erzählers hindeutet. Wenn in der Folge ausgesprochen wird, dass sich Tancredi mit dem vermeintlichen Gegner im Kampf messen will, gibt es aber kein Halten mehr: Die Stimme sinkt mit einer resignierten Geste um eine Quinte ab, die letzten beiden Töne der Phrase sehr lang dehnend, was den trauervollen Gestus der Phrase noch einmal unterstreicht. Was man in der ersten Halbphrase vielleicht noch überhören konnte, tritt nun deutlich hervor: Der Erzähler referiert nicht unbeteiligt, sondern ist selbst von dem Geschehen, das er berichtet, zutiefst ergriffen, auch wenn er seine Rührung verbergen möchte. Denn was dieser karge Einleitungssatz ausspricht, ist der tragische Kern des Geschehens: dass die Liebenden Krieger sind, dass der Krieg sie zum Kampf treibt, der beide zerstört. So spektakulär Monteverdis Musikgemälde des blutigen Kampfes ist, die eigentliche Grösse liegt in dieser sparsamen, tief mitfühlenden und dabei ganz unsentimentalen Zeichnung der seelischen Dimension des Geschehens.
Text von Werner Hintze.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 89, Februar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Volker Hagedorn trifft...

Emma Ryott
Emma Ryott stammt aus England. Sie arbeitete für das English National Ballett und die Royal Shakespeare Company. Heute ist sie international als Kostüm- und Bühnenbildnerin tätig. Eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Ballett und Oper verbindet sie seit 2003 mit Christian Spuck. Auch für seine Inszenierung «Monteverdi» kreiert sie die Kostüme. Ein Text aus dem Jahr 2022.
Wenn Emma Ryott im Kino sitzt, schaltet sich ihr Extraauge ein. So, wie sie es mit der Hand andeutet, sitzt es, natürlich unsichtbar, links an der Schläfe und speichert nützliche Eindrücke für ihren Job, an den die Kostümbildnerin dann eigentlich nicht denkt. «Ich gehe ja ins Kino, um hineingezogen zu werden, to get involved!», sagt sie. Aber die Elster in ihr, wie sie sie nennt, schläft nie, «hmmm, this could be interesting…», und trägt alles ins Nest, die Kinobilder und noch viel mehr, «Sachen aus dem Internet, Zeitungsartikel, und was man in irgendeinem Fenster sieht, Magazine, Modemagazine, auch alte Kollektionen, es gibt Designer, die ich sehr mag, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen…» Das alles fliesst ein in den inneren Fundus und verwandelt sich irgendwann in Stoff und Farbe, Rüschen und Rüstungen, in das, was Schauspieler, Sängerinnen, Tänzer auf der Bühne tragen. Während wir in der Zürcher Opernkantine zusammensitzen, werden in den Werkstätten ein paar Meter weiter silberne Applikationen auf schwarze Gewänder gestickt, einfachere Kleider hängen schon reihenweise auf Bügeln, «250 Kostüme, alles in allem», sagt Emma. Nicht, weil so viele Tänzerinnen und Sänger auf der Bühne wären in Monteverdi, dem neuen Ballett von Christian Spuck – aber es gibt zwei Besetzungen, und jede und jeder darin wird immer wieder mal etwas anderes tragen.
Emma Ryott selbst trägt dezentes Beige. «Als Kostümdesignerin laufe ich neutraler herum als die Leute, die ich kostümiere. Ich muss nicht die grosse Präsenz haben. Manche ja, aber ich nicht. Ich bin keine Performerin und will auch keine sein.» Ihr kann die grosse Präsenz genügen, die ihre Arbeit international und besonders im Œuvre des Choreografen Christian Spuck geniesst, mit dem sie seit achtzehn Jahren zusammenarbeitet. Über Monteverdi sprachen die beiden zuerst vor einem Jahr in Moskau, wo Emma für seine Choreografie Orlando das Bolschoi Ballett einkleidete. «Die Musik war dabei noch gar nicht so wichtig, wie sie am Schluss sein wird. Wir sprachen über Atmosphäre mehr als über alles andere. Später dann über Farben, über die basic colour world. Wir wollen diesmal viel mehr Farbe nach so vielen monochromen und disziplinierten Paletten. Wir wollen mehr Freiheit, und wir wollen die Geschichte über Farben erzählen.» Der Haken ist nur, dass es keine Geschichte gibt, auch wenn Monteverdis Combattimento eines der aufregendsten Liebesdramen der Musik ist. Zusammen mit anderen Werken wird ein abstraktes Ballett daraus, «und das ist schwer hinzukriegen, nicht ohne Kopfzerbrechen!»
Trick ist es, eben doch eine Geschichte zu erzählen, mit den Kostümen. Vom story telling mag sie nicht lassen, seit sie mit zwölf, dreizehn Jahren von Shakespeares Henry V. überwältigt war, in Stratford-upon-Avon. «Das war ein Schulausflug», sagt sie, «ich fand die Ausstattung unbeschreiblich. Ich dachte, das möchte ich auch können, so etwas entwerfen!» Und so studierte sie, jüngste von drei Töchtern einer Lehrerin und eines Werbefachmanns, Theaterdesign in Nottingham. Dann wurde sie Kostümbildnerin beim English National Ballett. Es folgten dreizehn Jahre bei der Royal Shakespeare Company, zuletzt als Kostümchefin, schliesslich machte sie sich auch mit der Oper vertraut und wurde selbstständig.
«Ich musste meine eigene Stimme finden», meint sie. Das gelang ihr auf dem Kontinent. «Es gibt hier mehr Möglichkeiten, es ist ein wunderbares Theatersystem auf eurer Seite vom Teich, aus historischen Gründen. In England ist der Respekt vor dem gesprochenen Wort gross, aber weniger der vor den visuellen Künsten, überhaupt werden die Künste nicht als Teil des Stoffs des Lebens gesehen, eher als Spezialität.» «The fabric of life» ist eine passende Metapher bei einer Frau, die Stoffe über alles liebt. «Kostüme entwerfen ist wie mit Stoffen malen, sie haben eine Sprache. Alle Kleider haben eine Sprache, auch das, was Sie jetzt tragen. Das ist unbewusst. Sie merken es nicht mal!»
Sie lacht, und ich wage nicht zu fragen, was wohl kleine blaue Knöpfe an einem weissen Hemd über mich erzählen könnten. Aber – welche Sprachen sieht sie denn in den Strassen der Städte, in denen sie unterwegs ist? «Hier in Zürich sind die Leute gut angezogen in die französische Richtung, sie wollen gut aussehen, schick oder casual, aber auf Nummer sicher. In London sieht man viel extremere Dinge, das mag ich. Sehr eklektisch, bunt, spannungsgeladen. Sie wollen etwas sagen. Hier bin ich! Natürlich nicht alle…» Der Wechsel der Moden über die Jahre ist ihr neulich an eigenen Entwürfen von 2006 aufgefallen, «die Art des Zuschnitts, wirklich seltsam. Schultern sehr gross, Taille sehr klein. Das habe ich gemacht? Das war fast ein Schock, jedenfalls sehr überraschend.»
Die Suche nach der neuen Kleidersprache von Monteverdi war mit den ersten Gesprächen über die Farbpalette natürlich nicht zu Ende. «Ich sammelte Bilder, und wir trafen uns, um zu gucken, worauf wir wie reagieren, was wir mögen. Dann kam ich mit der Kostümabteilung zusammen, erzählte die Ideen, machte Zeichnungen, und wir kreierten eine Art Kollektion. Die können hier wirklich alles. Sie schufen grosse Kostüme, prunkvoll, extravagant, historisch orientiert am 17. Jahrhundert, aber wir fanden, es ist nicht die richtige Richtung. Man muss das vereinfachen, um die Essenz des Stückes zu treffen.»
Wie der Bühnenbildner Rufus Didwiszus, mit dem sie auch diesmal zusammenarbeitet, kennt Emma die Krise auf halbem Weg, «den Punkt, an dem man sich fragt: Was tun wir, wo soll das hingehen? Ist alles, was ich mache, schrecklich? Hat es Sinn? Spricht es zum Publikum?» Dann müsse man einen Schritt zurücktreten: «Okay, schauen wir uns das mal an.» Ja, schauen wir uns das an. Es gibt immer noch weisse Halskrausen, aber so elegant, leicht, reduziert, dass man fast beim Bauhaus ist. Hemden wurden genäht, deren Textur entfernt an Kettenhemden denken lässt – aber nicht explizit. Und alles wirkt schlank.
«Die Bewegungsgeschwindigkeit der Tänzerinnen und Tänzer hat selbst eine Stimme, man darf da nicht zuviel drauftun, am wenigsten bei einem abstrakten Ballett.» Zugleich sind da, gar nicht abstrakt, die Persönlichkeiten. «Christian wählt für bestimmte Bewegungen bestimmte Tänzer aus, das versteht man erst, wenn man eine Weile mit der Compagnie zusammen war. Und das kann ich unterstützen. Ein Kostüm hilft auch, die Rolle und sich selbst zu entdecken, es kann ihnen den kleinen Schubs geben, von dem sie gar nicht wussten, dass sie ihn brauchten.»
Das ist eine schöne Beschreibung für das, was Theater auch mit den Menschen machen kann, die es besuchen. Einmal nahm Emma ihren vierjährigen Sohn mit nach Stratfordupon-Avon, den Ort ihrer Erweckung, es gab Wie es euch gefällt. «Er war vollkommen gebannt vom Schnee auf der Bühne. ‹How come it’s snowing on stage, mum?›» Das habe er, nun erwachsen, längst vergessen, aber nicht, dass da etwas Wunderbares geschah. Voriges Jahr hat sie für ein kleines Sommerfestival in Oxfordshire Wagners Rheingold ausgestattet. «Es gab Vorstellungen für Schülerinnen und Schüler, und es war auf Deutsch! Natürlich gab’s auch ein bisschen unruhiges Füssescharren. Mit elf, zwölf kann man nicht alles interessant finden. Aber sie waren hingerissen, sie waren mitten drin!»
Für Emmas eigenen Weg war übrigens nicht nur der Schulausflug zu Shakespeare bedeutsam, sondern auch das BBC-Fernsehen am Samstag. «Da gab es die frühen Hollywoodfilme, schwarzweiss, die habe ich mit meinen Schwestern angeschaut. Seitdem ist Edith Head mein Vorbild.» Die Frau, die Kostüme für Bette Davis, Audrey Hepburn, Ginger Rogers, Elizabeth Taylor, für Fred Astaire, Cary Grant entwarf. «Sie war eine Meisterin, absolut unglaublich!» Emmas Extraauge, das war schon früh aktiv.
Ein Text von Volker Hagedorn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 88, Januar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Biografien

Riccardo Minasi, Musikalische Leitung
Riccardo Minasi
Riccardo Minasi wurde in Rom geboren. 2022 wurde er zum Musikdirektor des Teatro Carlo Felice sowie zum Künstlerischen Leiter des Orchestra La Scintilla ernannt, mit dem er bisher Opern wie Don Giovanni und Die Entführung aus dem Serail, das Ballett Monteverdi sowie zahlreiche Konzertprogramme, das Album Mozart mit Juan Diego Flórez und eine CD mit Werken von Vivaldi und Verdi realisiert hat. Von 2012 bis 2015 war er Dirigent des von ihm mitbegründeten Ensembles Il pomo d’oro und von 2016 bis 2022 Chefdirigent des Mozarteumorchesters Salzburg. 2016 war er an vier mit dem Echo Klassik ausgezeichneten Alben beteiligt, darunter Haydn-Konzerte sowie Leonardo Vincis Catone in Utica. Als Sologeiger nahm er u.a. die Rosenkranz-Sonaten von Biber auf. Zuletzt wurden seine Aufnahmen von Joseph Haydns Die sieben letzten Worte Christi am Kreuz und C.P.E. Bachs Cellokonzerten mit Jean-Guihen Queyras bei Harmonia Mundi (beide mit dem Ensemble Resonanz) mit dem Diapason d'Or de l'Année ausgezeichnet. Er stand dem Orchestre Symphonique de Montréal als musikhistorischer Berater zur Seite und gab zusammen mit Maurizio Biondi die kritische Ausgabe von Bellinis Norma bei Bärenreiter heraus. Als Dirigent leitete er u.a. das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das Concertgebouw Orchester, die Staatskapelle Dresden sowie zahlreiche Opernorchester. Jüngst debütierte er mit einem Mozart-Abend bei den Berliner Philharmonikern. Als Solist und Konzertmeister trat er mit dem Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, der Accademia Bizantina, Il Giardino Armonico und Le Concert des Nations auf.

Christoph Koncz, Musikalische Leitung
Christoph Koncz
Christoph Koncz tritt weltweit als Dirigent, Geiger, Kammermusiker und Stimmführer der Wiener Philharmoniker auf. Weithin bekannt wurde er als Neunjähriger mit seiner Rolle als Wunderkind Kaspar Weiss im kanadischen Kinofilm The Red Violin, dessen Filmmusik mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Als jüngster Sohn einer österreichisch-ungarischen Musikerfamilie in Konstanz geboren, erhielt er im Alter von vier Jahren seinen ersten Violinunterricht. Bereits zwei Jahre später wurde er an die Wiener Musikuniversität aufgenommen. An derselben Universität begann er 2005 zusätzlich sein Dirigierstudium. Meisterkurse bei Daniel Barenboim und Daniel Harding ergänzten seine künstlerische Ausbildung. Seine Konzerttätigkeit als Violinist führte ihn in zahlreiche Länder Europas sowie in den Nahen Osten, nach Asien, Australien, Nord- und Südamerika. 2008 wurde er im Alter von nur 20 Jahren Stimmführer der 2. Violinen bei den Wiener Philharmonikern. Als gefragter Kammermusiker zählen Leonidas Kavakos, Joshua Bell, Vilde Frang, Renaud Capuçon, Antoine Tamestit, Clemens Hagen, Gautier Capuçon, Andreas Ottensamer und Rudolf Buchbinder zu seinen musikalischen Partnern. Auch als Dirigent hat sich Christoph Koncz bereits international etabliert. Auf sein Dirigierdebüt bei der Mozartwoche Salzburg 2013 folgten Auftritte in den bedeutendsten Konzertsälen des deutschsprachigen Raums, wie den Philharmonien in Berlin, Köln und München, dem Wiener Konzerthaus, dem KKL Luzern sowie bei den Salzburger Festspielen. Seit 2019 ist er Chefdirigent der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein und wurde zum Ersten Gastdirigenten von Les Musiciens du Louvre ernannt.

Christian Spuck, Choreografie und Inszenierung
Christian Spuck
Christian Spuck stammt aus Marburg und wurde an der John Cranko Schule in Stuttgart ausgebildet. Seine tänzerische Laufbahn begann er in Jan Lauwers’ Needcompany und Anne Teresa de Keersmaekers Ensemble «Rosas». 1995 wurde er Mitglied des Stuttgarter Balletts und war von 2001 bis 2012 Hauschoreograf der Compagnie. In Stuttgart kreierte er fünfzehn Uraufführungen, darunter die Handlungsballette Lulu. Eine Monstretragödie nach Frank Wedekind, Der Sandmann und Das Fräulein von S. nach E.T.A. Hoffmann. Darüber hinaus hat Christian Spuck mit zahlreichen namhaften Ballettcompagnien in Europa und den USA gearbeitet. Für das Königliche Ballett Flandern entstand 2006 The Return of Ulysses, beim Norwegischen Nationalballett Oslo wurde Woyzeck nach Georg Büchner uraufgeführt. Das Ballett Die Kinder beim Aalto Ballett Essen wurde für den «Prix Benois de la Danse» nominiert, das ebenfalls in Essen uraufgeführte Ballett Leonce und Lena nach Georg Büchner wurde von den Grands Ballets Canadiens de Montréal, dem Charlotte Ballet, USA, dem Tschechischen Nationalballett Prag und vom Stuttgarter Ballett übernommen. Die Uraufführung von Poppea//Poppea für Gauthier Dance am Theaterhaus Stuttgart wurde 2010 von der Zeitschrift «Dance Europe» zu den zehn erfolgreichsten Tanzproduktionen weltweit gewählt sowie mit dem deutschen Theaterpreis Der Faust 2011 und dem italienischen «Danza/Danza-Award» ausgezeichnet. Christian Spuck hat auch Opern inszeniert: Auf Glucks Orphée et Euridice an der Staatsoper Stuttgart folgten Verdis Falstaff am Staatstheater Wiesbaden sowie Berlioz’ La Damnation de Faust und Wagners Fliegender Holländer an der Deutschen Oper Berlin. Von 2012 bis 2023 war Christian Spuck Direktor des Balletts Zürich. Hier waren seine Choreografien Romeo und Julia, Leonce und Lena, Woyzeck, Der Sandmann, Messa da Requiem, Nussknacker und Mausekönig, Dornröschen und Monteverdi zu sehen. Das 2014 in Zürich uraufgeführte Ballett Anna Karenina nach Lew Tolstoi wurde in Oslo, am Moskauer Stanislawski-Theater, vom Koreanischen Nationalballett und vom Bayerischen Staatsballett ins Repertoire übernommen. 2018 hatte in Zürich Spucks Ballett Winterreise Premiere, für das er mit dem «Prix Benois de la Danse 2019» ausgezeichnet wurde. 2019 folgte beim Ballett Zürich Helmut Lachenmanns Das Mädchen mit den Schwefelhölzern (Auszeichnung als «Produktion des Jahres und Kompanie des Jahres für das Ballett Zürich durch die Zeitschrift tanz). Für das Moskauer Bolschoitheater kreierte er 2021 sein Ballett Orlando nach Virginia Woolf. Spucks Messa da Requiem wurde nicht nur zum Adelaide Festival nach Australien eingeladen, sondern auch vom Het Nationale Oper & Ballet Amsterdam und vom Finnischen Nationalballett übernommen. Seit Beginn der Saison 2023/24 ist Christian Spuck Intendant des Staatsballetts Berlin.

Rufus Didwiszus, Bühnenbild
Rufus Didwiszus
Rufus Didwiszus studierte Bühnen- und Kostümbild in Stuttgart bei Jürgen Rose und arbeitet seither als freier Bühnenbildner in Theater-, Opern- und Tanzproduktionen, u. a. mit Barrie Kosky (La Belle Hélène, Die Perlen der Cleopatra und Anatevka an der Komischen Oper Berlin; La fanciulla del West, Die Gezeichneten und Boris Godunow am Opernhaus Zürich; Orphée aux enfers, Salzburger Festspiele; Fürst Igor, Opéra de Paris; Der Rosenkavalier, Bayerische Staatsoper), Thomas Ostermeier (u. a. Shoppen &Ficken in der Baracke des Deutschen Theaters Berlin mit Einladung zum Berliner Theatertreffen und nach Avignon; Der blaue Vogel am Deutschen Theater, Feuergesicht am Schauspielhaus Hamburg, Der Name bei den Salzburger Festspielen und an der Berliner Schaubühne, The Girl on the Sofa beim Edinburgh International Festival und an der Schaubühne, Vor Sonnenaufgang an den Münchner Kammerspielen), Sasha Waltz, Tom Kühnel, Christian Stückl, Stefan Larsson, Tomas Alfredson und Christian Lollike. Seit 2004 entwirft und inszeniert Rufus Didwiszus mit Joanna Dudley eigene Musik-Theater-Performances, u. a. in den Sophiensaelen, an der Schaubühne und im Radialsystem in Berlin sowie im BOZAR in Brüssel. Mit seiner Band «Friedrichs» war er in Der weisse Wolf am Staatstheater Stuttgart zu sehen. Zudem war er als Gastdozent an der Akademie der Bildenden Künste München und an der Kunsthochschule Berlin-Weissensee tätig. Für Barrie Kosky entstanden zuletzt die Bühnenbilder zu Rimski-Korsakows Der goldene Hahn an der Komischen Oper Berlin, Das Rheingold am Royal Opera House London sowie Offenbachs Les Brigands an der Opéra National de Paris.

Emma Ryott, Kostüme
Emma Ryott
Emma Ryott stammt aus England und ist international als Kostüm- und Bühnenbildnerin tätig. Bereits seit 2003 arbeitet sie mit Christian Spuck in den Bereichen Ballett und Oper zusammen. Gemeinsame Ballettprojekte waren Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, Winterreise, Messa da Requiem, Anna Karenina und Romeo und Julia in Zürich, Lulu. Eine Monstretragödie und Das Fräulein von S. in Stuttgart, Woyzeck in Oslo und Zürich, Leonce und Lena in Montréal, Stuttgart, Zürich und Prag, Der Sandmann in Stuttgart und Zürich sowie The Return of Ulysses in Antwerpen. In der Oper arbeiteten sie bei Der fliegende Holländer und La Damnation de Faust an der Deutschen Oper Berlin, Falstaff in Wiesbaden und Orfeo ed Euridice in Stuttgart zusammen. Weitere Opernproduktionen waren Mathis der Maler am Theater an der Wien, Manon Lescaut an der English National Opera, Otello bei den Salzburger Festspielen, La Damnation de Faust und The Great Gatsby an der Semperoper Dresden, Marco Polo an der Oper Guanghzou, Das Rheingold und Die Walküre beim Longborough Festival sowie La bohème beim Copenhagen Opera Festival. Im Schauspiel entwarf Emma Ryott die Kostüme für The Heart of Robin Hood bei der Royal Shakespeare Company und Toronto (Auszeichnung mit dem Elliot Norton Award), für Tom Stoppards Rock’n Roll im Londoner West End und am Broadway sowie eine Tschechow-Trilogie (Regie: Jonathan Kent) am National Theatre in London. Für das weltweit vom ORF übertragene Neujahrskonzert 2020 der Wiener Philharmoniker gestaltete Emma Ryott die Kostüme für das Ballett. Weitere Ballettprojekte waren Cinderella beim Finnish National Ballet sowie Christian Spucks Orlando und Yuri Possokhovs Die Möwe am Moskauer Bolschoitheater.

Martin Gebhardt, Lichtgestaltung
Martin Gebhardt
Martin Gebhardt war Lichtgestalter und Beleuchtungsmeister bei John Neumeiers Hamburg Ballett. Ab 2002 arbeitete er mit Heinz Spoerli und dem Ballett Zürich zusammen. Ballettproduktionen der beiden Compagnien führten ihn an renommierte Theater in Europa, Asien und Amerika. Am Opernhaus Zürich schuf er das Lichtdesign für Inszenierungen von Jürgen Flimm, David Alden, Jan Philipp Gloger, Grischa Asagaroff, Matthias Hartmann, David Pountney, Moshe Leiser/Patrice Caurier, Damiano Michieletto und Achim Freyer. Bei den Salzburger Festspielen kreierte er die Lichtgestaltung für La bohème und eine Neufassung von Spoerlis Der Tod und das Mädchen. Seit der Spielzeit 2012/13 ist Martin Gebhardt Leiter des Beleuchtungswesens am Opernhaus Zürich. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn heute mit dem Choreografen Christian Spuck (u.a. Winterreise, Nussknacker und Mausekönig, Messa da Requiem, Anna Karenina, Woyzeck, Der Sandmann, Leonce und Lena, Das Mädchen mit den Schwefelhölzern). Er war ausserdem Lichtdesigner für die Choreografen Edward Clug (u.a. Strings, Le Sacre du printemps und Faust in Zürich), Alexei Ratmansky, Wayne McGregor, Marco Goecke, und Douglas Lee. Mit Christoph Marthaler und Anna Viebrock arbeitete er beim Händel-Abend Sale und Rossinis Il viaggio a Reims in Zürich sowie bei Lulu an der Hamburgischen Staatsoper zusammen und mit Jossi Wieler und Sergio Morabito an der Oper Genf für Les Huguenots. 2023 gestaltete er das Licht für Spucks Ballett Bovary beim Staatsballett Berlin und 2024 Rossinis Tancredi an den Bregenzer Festspielen. Ausserdem war er Lichtdesigner bei Atonement von Cathy Marston am Opernhaus Zürich.

Michael Küster, Dramaturgie
Michael Küster
Michael Küster stammt aus Wernigerode (Harz). Nach dem Studium der Germanistik, Kunst- und Sprechwissenschaft an der Universität Halle war er Moderator, Autor und Sprecher bei verschiedenen Rundfunkanstalten in Deutschland. Dort präsentierte er eine Vielzahl von Klassik-Programmen und Live-Übertragungen wichtiger Konzertereignisse, u. a. aus der Metropolitan Opera New York, der Semperoper Dresden und dem Leipziger Gewandhaus. Seit 2002 ist er Dramaturg am Opernhaus Zürich, u. a. für Regisseure wie Matthias Hartmann, David Alden, Robert Carsen, Moshe Leiser/ Patrice Caurier, Damiano Michieletto, David Pountney, Johannes Schaaf und Graham Vick. Als Dramaturg des Balletts Zürich arbeitete Michael Küster seit 2012 u. a. mit Cathy Marston, Marco Goecke, Marcos Morau, Edward Clug, Alexei Ratmansky, William Forsythe, Jiří Kylián und Hans van Manen, vor allem aber mit Christian Spuck zusammen (u. a. Romeo und Julia, Messa da Requiem, Winterreise, Dornröschen). An der Mailänder Scala war er Dramaturg für Matthias Hartmanns Operninszenierungen von Der Freischütz, Idomeneo und Pique Dame.

Claus Spahn, Dramaturgie
Claus Spahn
Claus Spahn ist seit 2012 Chefdramaturg am Opernhaus Zürich. In dieser Funktion ist er massgeblich an der Spielplangestaltung des Hauses beteiligt. Er ist als Produktionsdramaturg tätig und verantwortet die zentralen Publikationen des Opernhauses wie Programmbücher, das monatliche Magazin MAG, Podcasts und Werkeinführungen. Sein Interesse gilt vor allem der modernen und zeitgenössischen Musik, dem Opernrepertoire des Barock und der Entwicklung neuer musiktheatralischer Konzepte. Er hat am Opernhaus Zürich Musiktheaterprojekte von Wolfgang Rihm, Helmut Lachenmann, George Benjamin, Roman Haubenstock-Ramati und Uraufführungen von Heinz Holliger, Christian Jost und Stefan Wirth betreut Als Produktionsdramaturg hat er für die Regisseure Sebastian Baumgarten, Herbert Fritsch, Jan Philipp Gloger, Tatjana Gürbaca, Andreas Homoki, Barrie Kosky, Nadja Loschky, David Marton und Evgeni Titov gearbeitet. Eine enge künstlerische Partnerschaft verbindet ihn ausserdem mit dem Choreografen und ehemaligen Direktor des Balletts Zürich, Christian Spuck. Für Christian Spuck war er in Zürich stückentwickelnd an den Produktionen Anna Karenina, Nussknacker und Mausekönig und Monteverdi beteiligt und hat Libretti für die Ballette Orlando nach Virginia Woolf (Uraufführung 2021 am Moskauer Bolshoi-Ballett) und Bovary nach Gustave Flaubert (Uraufführung 2023 am Berliner Staatsballett) geschrieben. Ausserdem ist er Librettist der Kammeroper Der Traum von Dir des Schweizer Komponisten Xavier Dayer, die 2017 am Opernhaus Zürich uraufgeführt wurde.
Bevor er ans Opernhaus Zürich wechselte, war Claus Spahn 14 Jahre lang Feuilletonredakteur bei der deutschen Wochenzeitung DIE ZEIT und dort verantwortlich für das Fachressort Musik. Von 1990-1997 war er als freier Musikjournalist vor allem für die Süddeutsche Zeitung und den Bayerischen Rundfunk tätig. In seiner Funktion als Journalist hat er die Entwicklungen des internationalen Kultur-, Musik- und Opernbetriebs über Jahrzehnte hinweg beobachtet und kommentiert, war Radio-Moderator, Juror bei Internationalen Musikwettbewerben und Workshopleiter für kulturjournalistisches Schreiben. Claus Spahn ist in Deutschland geboren, hat in Freiburg im Breisgau klassische Gitarre studiert und eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München absolviert.

Lauren Fagan, Sopran
Lauren Fagan
Lauren Fagan studierte in London an der Guildhall School of Music and Drama. 2019 vertrat sie ihr Heimatland Australien beim Wettbewerb «BBC Cardiff Singer of the World» und war Mitglied des Jette Parker Young Artist Pro gramme. Sie gab Rollendebüts als Alcina bei den Händelfestspielen in Karlsruhe, als Violetta (La traviata) an der Opera Holland Park in London und als Mimì (La bohème) an der Opera North. Ausserdem sang sie Woglinde in Wagners Ring am Royal Opera House Covent Garden, Roxana (Król Roger) an der Accademia Nazionale di Santa Cecilia und Donna Elvira (Don Giovanni) beim NHK Symphony Orchestra unter Paavo Järvi. Sie debütierte an der Bayerischen Staatsoper und an der Opéra de Paris in 7 Deaths of Maria Callas von Marina Abramovic, als Magda (La rondine) an der National Opera in Australien sowie beim Glyndebourne Festival in The Wreckers von Ethel Smyth. An der State Opera of South Australia trat sie als Violetta auf, in Glasgow als Margarita Xirgu in Golijovs Ainadamar und beim Glyndebourne Festival als Helena in A Midsummer Night’s Dream. In Kanada debütierte sie in Händels Messiah mit dem Toronto Symphony Orchestra und als Gräfin Almaviva (Figaro) mit der Canadian Opera Company. Zu ihren ,Konzerterfolgen gehören Beethovens Ah! Perfido mit dem Sydney Symphony Orchestra unter Simone Young, Vier letzte Lieder von R. Strauss in Malmö, Agnès in George Benjamins Written on Skin in London und St. Petersburg sowie Beethovens 9. Sinfonie mit den Hamburger Sinfonikern und der Oslo Philharmonic. Am Opernhaus Zürich war sie bereits als Giulietta (Les Contes d’Hoffmann), in Monteverdi sowie als Gutrune in Wagners Götterdämmerung zu erleben.

Louise Kemény, Sopran
Louise Kemény
Louise Kemény stammt aus Grossbritannien und studierte am Königlichen Konservatorium von Schottland Gesang. Sie nahm an diversen Stipendiaten-Programmen teil, u.a. das Britten-Pears Young Artist Programme. Von 2018 bis 2020 war sie Ensemblemitglied am Theater Bonn und sang dort u.a. Romilda (Serse), Pamina (Die Zauberflöte), Gretel (Hänsel und Gretel), Sophie (Der Rosenkavalier), Susanna (Le nozze di Figaro) und Marzelline (Fidelio). Gastengagements führten sie an die Nationale Opera Amsterdam als Barbarina (Le nozze di Figaro), an die English Touring Opera als Teofane (Ottone), an die Scottish Opera als Jano (Jenůfa), zu den Karlsruher Händelfestspielen 2020 als Seleuce (Tolomeo)und zuletzt ans Theater Bonn in der Titelpartie von Händels Agrippina. Als Konzertsolistin war sie bisher u.a. in Mendelssohns Elias und Brahms’ Ein deutsches Requiem, beides mit dem Sinfonieorchester Basel, in Bachs Weihnachtsoratorium mit Concerto Köln, in Bachs Matthäuspassion mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment, in Rossinis Stabat Mater bei den Kasseler Musiktagen, in Beethovens Missa Solemnis in der King’s College Chapel in Cambridge und in Orffs Carmina Burana in der Cadogan Hall zu erleben. Daneben hat sie u.a. Strawinskys Les Noces mit dem Royal Scottish National Orchestra und ein Programm mit Werken von Schönberg, Ravel und Strawinsky in der Londoner Conway Hall aufgeführt. Ausserdem gab sie Liederabende beim Würzburger Mozartfest, beim Bath Festival und beim Oxford Liederfestival mit Malcolm Martineau.

Siena Licht Miller, Mezzosopran
Siena Licht Miller
Siena Licht Miller, deutsch-amerikanische Mezzosopranistin, studierte am Curtis Institute of Music und am Oberlin Conservatory of Music Gesang. Sie vervollständigte ihre Ausbildung mit Kursen an der Opera Philadelphia, der Santa Fe Opera, dem Opera Theatre of St. Louis und beim Aspen Music Festival. Sie ist Stipendiatin der Bagby Foundation, Preisträgerin der Metropolitan Opera National Council Auditions, der Marilyn Horne Rubin Foundation und der Gerda Lissner Foundation. Höhepunkte ihrer bisherigen Karriere waren die Rollendebüts als Hermia in A Midsummer Night’s Dream, Zweite Dame in Die Zauberflöte und eine der zwei Solopartien in der Uraufführung von Denis and Katya von Philip Venables an der Opera Philadelphia. Am Aspen Opera Center sang sie die Titelrolle in Ravels L’Enfant et les sortilèges unter der Leitung von Robert Spano. Regelmässig widmet sie sich zudem dem Liedgesang. So sang sie bei der Reihe The Song Continues in der Carnegie Hall zur Feier ihrer Mentorin Marilyn Horne und ging mit einem Rezital zusammen mit dem Pianisten Kevin Murphy auf Tournee durch die USA. In der Spielzeit 2020/21 war sie Mitglied des Internationalen Opernstudios in Zürich und sang hier u. a. in Maria Stuarda, Simon Boccanegra, Viva la mamma, Salome, Odyssee, im Ballett Monteverdi, in L’italiana in Algeri sowie Flosshilde in Das Rheingold. Seit der Spielzeit 2022/23 gehört sie zum Ensemble des Opernhauses Zürich und war hier jüngst in Barkouf, Salome, Anna Karenina, Lakmé, La rondine, Die Walküre, Götterdämmerung, Andrea Chénier und Ariadne auf Naxos zu erleben. Ausserdem sang sie am Theater Winterthur die Titelpartie in Händels Serse.

Aryeh Nussbaum Cohen, Countertenor
Aryeh Nussbaum Cohen
Aryeh Nussbaum Cohen stammt aus New York und studierte an der Princeton University. 2017 gewann er die Metropolitan Opera National Council Auditions. Ausserdem gewann er den Houston Grand Opera Eleanor McCollum Wettbewerb, den William Matheus Sullivan Award und 2019 den dritten Preis bei Placido Domingos Operalia-Wettbewerb. In der Spielzeit 2017/18 war er Mitglied im Opernstudio der Houston Grand Opera, wo er in Giulio Cesare und in Elektra zu hören war. In der Spielzeit 2018/19 war er Teil des Adler Fellowship der San Francisco Opera und gab dort sein Hausdebüt als Medoro (Orlando) unter Christopher Moulds. Ausserdem sang er David (Saul) in der Regie von Barrie Kosky) an der Houston Grand Opera, Ottone (L’incoronazione di Poppea) an der Cincinnati Opera und Werke von Händel in einem Ballett von Yuri Possakhov mit dem San Francisco Ballet. In der Spielzeit 2020/21 gab er sein Rollendebüt als Oberon (A Midsummer Night’s Dream) beim Adelaide Festival in Australien. Auf der Konzertbühne war er mit dem Philharmonia Baroque Orchestra und der San Francisco Symphony zu erleben. Mit den American Bach Soloists spielte er sein erstes Soloalbum mit Werken von Gluck, Händel und Vivaldi ein, 2019 gewann die Einspielung von Kenneth Fuchs’ Poems of Life mit dem London Symphony Orchestra einen Grammy. In dieser Saison debütiert er an der Metropolitan Opera als Rosenkrantz in Brett Deans Hamlet. Ausserdem gibt er Rollendebüts als Händels Giulio Cesare mit dem Moscow Chamber Orchestra und als Prinz Go-Go (Le Grand Macabre) im Amsterdamer Concertgebouw.

Edgaras Montvidas, Tenor
Edgaras Montvidas
Edgaras Montvidas wurde in Litauen geboren, studierte an der Musik- und Theaterakademie Vilnius und sammelte erste Bühnenerfahrungen an der Litauischen Nationaloper. Nach seinem Studium war er Mitglied des Royal Opera House Covent Garden Young Artists Programme und sang dort u. a. Alfredo Germont (La traviata) und Fenton (Falstaff). Gastengagements führten ihn in jüngerer Zeit u. a. in der Titelrolle von Werther an die Opéra Nationale de Lorraine in Nancy und nach Bergen, als Anatol in Barbers Vanessa zum Glyndebourne Festival, als Alfred (Die Fledermaus) an die Bayerische Staatsoper, als Don Ottavio (Don Giovanni) und als Sir Edgardo di Ravenswood (Lucia di Lammermoor) an die Semperoper Dresden, in der Titelrolle von Faust, als Lensky (Jewgeni Onegin), Alfredo (La traviata) und Pinkerton (Madama Butterfly) nach Vilnius, als Conrad in Saint-Saëns Le Timbre d’argent an die Opéra Comique in Paris und als Pastore in einer konzertanten Aufführung von Szymanowskis Re Ruggero zur Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom unter der Leitung von Antonio Pappano. In der Spielzeit 2019/20 war er als Pinkerton in Nancy, als Boris Grigorjewitsch (Katja Kabanova) an der Staatsoper Hamburg und in der Titelrolle der Uraufführung Egmont von Christian Jost am Theater an der Wien zu erleben. Auch auf der Konzertbühne ist Edgaras Montvidas zu Hause; er konzertierte u.a. als Fischer (Le Rossignol) mit den Berliner Philharmonikern unter der musikalischen Leitung von Pierre Boulez, mit dem Boston Symphony Orchestra unter Charles Dutoit (Król Roger und L’Enfant et les sortilèges) sowie für Radio France mit Benjamin Godards Dante und Éduard Lalos La Jacquerie. Jüngst sang er zudem Faust an der Vilnius City Opera, Pinkerton und Alfredo an der Litauischen Nationaloper, Tito (La clemenza di Tito) am ROH London und Lensky an der Norske Opera Oslo. Am Opernhaus Zürich debütierte er 2020 als Grigori Otrepjew/Prätendent in Boris Godunov.

Anthony Gregory, Tenor
Anthony Gregory
Anthony Gregory, Tenor, stammt aus Grossbritannien. Er studierte am Royal College of Music in London und war anschliessend Mitglied des renommierten National Opera Studio sowie 2010 des Jewood Young Artist Program beim Glyndebourne Festival. Er ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe, u.a. des Ian Feming Award und des Lies Askonas Stipendiums. In jüngerer Zeit war er in der Titelrolle in Bernsteins Candide an der Oper Bergen zu erleben, als Flute (A Midsummer Night’s Dream) beim Glyndebourne Festival, als Don Ottavio (Don Giovanni) an der Norske Opera in Oslo, als Oronte (Alcina) am Teatro Real Madrid und beim Festival d’Aix-en-Provence, als Odoardo (Ariodante) mit Les Arts Florissants auf einer Tournee in Spanien, in der Titelrolle von Rameaus Dardanus, als Florizel in der Uraufführung von Ryan Wigglesworths Winter’s Tale und als Cégeste (Glass’ Orphée) an der English National Opera, als 2. Pastore (L’Orfeo) am ROH London sowie als Vasco in der Uraufführung von Anthropocenevon Stuart MacRae an der Scottish Opera. Beim Verbier Festival gastierte er als Agenore (Il re pastore) und in Beethovens Chorfantasie. Auf der Konzertbühne sang er 2022 Acis in Acis and Galatea beim London Händel Festival, in einem Konzert am Barbican Center unter Sir Mark Elder mit dem Britten Sinfonia sowie in der Royal Albert Hall die Tenorpartie in Carmina Burana mit dem London Philharmonic Orchestra. In der Spielzeit 2022/23 gastierte er als Colonel Fairfax in Sullivans The Yeomen oft he Guard an der ENO in London, als Flute am Théâtre des Arts in Rouen sowie als Pane in Cavallis La Calisto an der Bayerischen Staatsoper.

Brent Michael Smith, Bass
Brent Michael Smith
Brent Michael Smith stammt aus den USA. Er studierte Gesang an der Academy of Vocal Arts in Philadelphia und der University of Northern Iowa sowie Klavier am Hope College. 2021 gewann er den 3. Preis beim Concorso Lirico Internazionale di Portofino, war Finalist beim Queen Sonja International Music Competition und gewann das Förderstipendium der Zachary L. Loren Society, 2020 war er Halbfinalist bei den Metropolitan Opera Council Auditions, 2018 war er Preisträger des Opera Index Wettbewerbs und der Opera Birmingham International Competition, ausserdem gewann er Preise bei der Giargiari Bel Canto Competition. In der Spielzeit 2016/17 sang er am Michigan Opera Theatre Zuniga (Carmen), den British Major (Silent Night von Kevin Puts), Friedrich Bhaer (Little Women) und Ashby (La fanciulla del West). In der gleichen Spielzeit debütierte er an der Toledo Opera als Antonio (Le nozze di Figaro) und beim Glimmerglass Festival als Ariodante (Xerxes). An der Santa Fe Opera war er als Lakai (Ariadne auf Naxos) zu erleben. An der Opera Philadelphia sang er 2019 Celio (Die Liebe zu den drei Orangen) und Peter Quince (A Midsummer Night’s Dream). Nach einer Spielzeit im Internationalen Opernstudio gehört er seit 2020/21 zum Ensemble des Opernhauses, wo er bisher u.a. in Boris Godunow, Simon Boccanegra, I Capuleti e i Montecchi, im Ballett Monteverdi, als Graf Lamoral (Arabella), als Raimondo Bidebent (Lucia di Lammermoor), als Pistola (Falstaff), Angelotti (Tosca), Gualtiero Raleigh (Roberto Devereux), Gremin (Jeweni Onegin), Frère Laurent (Roméo et Juliette), Fafner (Das Rheingold) und Samuel (Un ballo in maschera) zu hören war.

Alexander Fritze, Bass
Alexander Fritze
Alexander Fritze studierte Schlagwerk und Gesang an der Hochschule für Musik Saarbrücken. Er war in zahlreichen Hochschulproduktionen, in einer Aufführung von Bachs Matthäuspassion (Jesus) und bei diversen Liederabenden als Sänger auf der Bühne zu erleben. Sein professionelles Debüt gab er 2017 in der Rolle des 2. Geharnischten in einer Produktion von Die Zauberflöte an der Longborough Festival Opera in Gloucestershire. Im selben Jahr wechselte er in die Klasse von Prof. Rudolf Piernay an der Guildhall School of Music and Drama in London. Zudem besuchte er Meisterkurse bei Prof. Edith Wiens (Juilliard School New York) und Elizabeth McDonald (University of Toronto). Seit der Spielzeit 2021/22 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios Zürich und war hier bisher in Salome, Die Odyssee, Dialogues des Carmélites und Macbeth zu erleben.






























