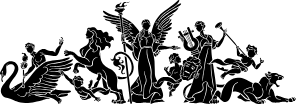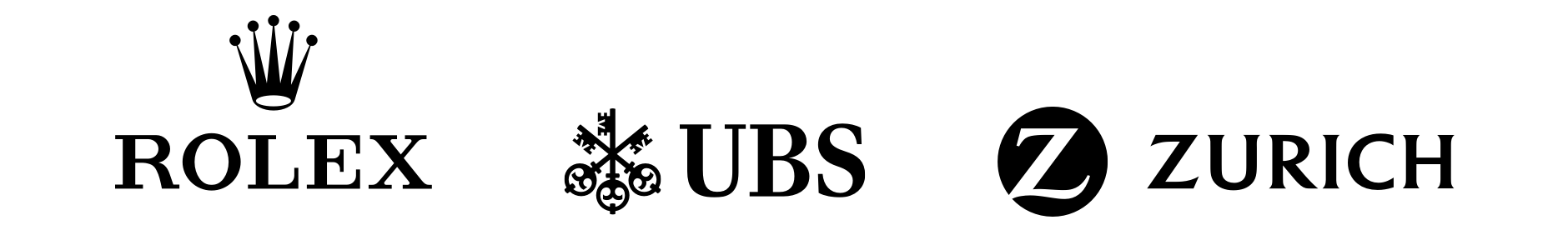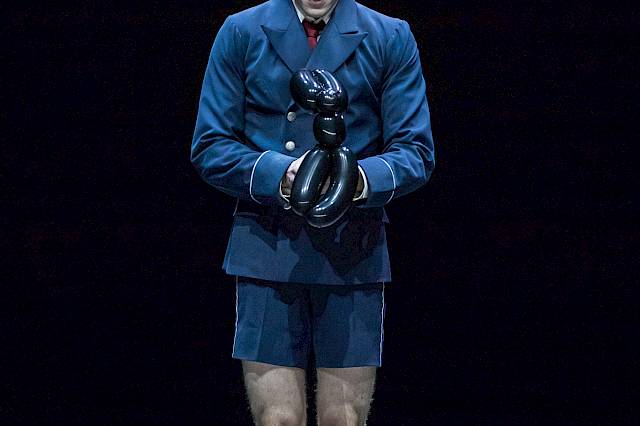Goethes «Faust» gehört zum Kernbestand der abendländischen Dramenliteratur. Aber taugt das sprachgewaltige Werk auch zum Ballett? Der slowenische Choreograf Edward Clug bringt es mit dem Ballett Zürich auf die Bühne. Er ist nicht der Einzige, der den «Faust»-Stoff zum Thema im Tanz gemacht hat, wie ein Blick in die Ballettgeschichte zeigt.
Im Staub der Archive schlummert bekanntlich manches, was niemand sich träumen lässt. Das liegt in der Natur der Sache, gilt aber für den Tanz – einmal mehr, schon wieder, noch immer – in ganz besonderer Weise. Wenn sich jetzt Edward Clug, Chef des Slowenischen Nationalballetts, mit dem Ballett Zürich an Goethes Faust, der Tragödie erster Teil, wagt, mag man das für irrwitzig, vermessen, leicht grössenwahnsinnig halten. Aber eine Sichtung der historischen Ablage zeigt: Clug bleibt schlicht traditionstreu.
Dabei ist der dramaturgisch verflixte Faust aufs Erste gesehen alles andere als ein erfolgversprechender Tanzkandidat. Wieso also ausgerechnet dieses Drama, das Kernsubstanzen der europäischen Geistes-, Sozial- und Zivilisationsgeschichte (samt allerlei Derivaten) personalisiert und im Dreischritt von Faust zu Mephisto zu Gretchen über die Abgründe der abendländischen Philosophie irrlichtert? Faust, der religiöse Demut und hoffärtigen Erkenntnishunger gegen- und ineinander schiebt, der am Beispiel eines Mädchens, eines Mannes die Mechanismen sexueller und seelischer Verführung erkundet? Wie soll sich das alles schlüssig an die Umrisse der Ballettbühne schmiegen?
Die Theoretiker des Fachs haben vor, während und nach der Goethe-Zeit dazu eine recht klare Auffassung vertreten: Alles, was auch nur ein Quäntchen Metaphysik, Abstraktion, Vergeistigtes enthält, kommt als Sujet nicht in Frage. Die Körperkunst des Tanzes reagiert geradezu allergisch auf gedankliche Gravitationsfelder, sie scheitert an allem, was sich nicht sofort und ohne Umschweife ins Herz des Zuschauers bohrt. Gefühligkeit galt dem aufgeklärten Diskurs des 18. Jahrhunderts als erkenntnisleitende Maxime, als empathische und läuternde Mission der moralischen Anstalt namens Theater. Heutzutage aber lässt sich hinter den hehren Worten ein Phänomen ausmachen, dem die Gegenwart in geradezu exzessiver Manier frönt. Rasch «Gefühligkeit» durch «Emotionalisierung» ersetzt – und schon sind wir im 21. Jahrhundert gelandet, mitten im reibungslos funktionierenden Räderwerk des Affekt-Kults, der sich bis in die kleinsten Kapillaren der Gesellschaft, in Nachrichtenkanäle und Social Media-Zonen verbreitet hat.
So bewahrheitet sich eben die mephistophelische Devise: «Grau, teurer Freund, ist alle Theorie.» Was auf den Faust gemünzt bedeutet: Mögen die Daumen der Tanzgelehrten sich auch entschieden gen Erdboden senken, wenn die Rede auf seine Ballett-Tauglichkeit kommt – die Praktiker schert das keinen Deut, und zwar seit zweihundert Jahren. Noch erstaunlicher ist die Tatsache, dass nahezu alle Choreografen, die sich – auf Goethes Spuren – den Faust-Mythos anverwandelt haben, an anderer Stelle Epochales leisteten. Zwar ist keiner aus der illustren Schar für seine Faust-Inszenierung bejubelt worden, aber als Gründerväter der Romantik und Neoromantik, als Neuerer oder Wahrer der akademischen Linie haben sie Tanzgeschichte geschrieben.
Den Anfang macht Jean Coralli, Ballettmeister des Théâtre de La Porte Saint-Martin, wo im Oktober 1828 die erste französische Fassung über die Bühne geht, die auf Gérard de Nervals kurz zuvor veröffentlichter Übersetzung des Goethe-Originals beruht. Mehrere Literaten haben das Drama für sein Debüt bearbeitet, federführend Charles Nodier, der später als Bibliothekar in die Dienste der Opéra eintreten und seinen Namen in die Annalen des Tanzes einschreiben wird: als Autor der Vorlage von La Sylphide, einer tragenden Säule des Ballett-Repertoires. 1828 verantwortet Jean Coralli die Mise en-scène, verziert sie aber nur mit randständigen Tanzornamenten. Deren Ausführung vertraut er jedoch einem ausgesprochen renommierten Ballerino an: Joseph Mazilier, der eine gewisse Mademoiselle Florentine auf der Bühne hofiert. Dennoch wird der Abend ein maues Ereignis, weil «statt einer schrecklichen Tragödie, statt eines interessanten Dramas oder einer philosophischen Komödie nur ein Zauberstück mit viel Gepolter» zu sehen ist, wie ein Kritiker notiert.
Das tut der Tatsache keinen Abbruch, dass auch Nodiers Mitstreiter Berühmtheit erlangen, und zwar ebenfalls in Diensten der Opéra. Dort übernimmt Joseph Mazilier 1832 zur Premiere von La Sylphide nicht nur die männliche Hauptrolle, sondern er setzt – angefangen mit Le Diable Amoureux (1840) – mehrfach getanzte Mephisto-Fabeln in Szene. Jean Coralli wiederum wechselt 1830 als leitender Maître de ballet ebenfalls an die Oper und ist unter anderem für die Ausgestaltung des zweiten grossen Romantik-Knüllers mitverantwortlich – für Giselle, das er 1842 gemeinsam mit einem Nachwuchstalent namens Jules Perrot aus der Tanztaufe hebt. Perrot seinerseits…
Dazu gleich mehr, festzuhalten bleibt vorerst: Der Faust ist allem Anschein nach kein ausgemacht tanzdienliches Sujet, aber er liefert Motive, die das Romantische Ballett à la Giselle infiltrieren. Die menschliche Zerrissenheit zwischen Geist und Fleisch, Kultur und Natur, Tugend und Sündhaftigkeit, Himmel und Hölle, Erkenntnisfieber und frommer Genügsamkeit – diese faustischen Gegensätzlichkeiten lösen auch das romantische Kammerflimmern aus, das die Tanzbühne ab 1831 erfasst, nachdem Giacomo Meyerbeers Oper Robert Le Diable (!) zur Mitternachtsstunde tanzende Nonnen aus den Gräbern fahren lässt – Vorfahrinnen jener Elementarwesen, die von La Sylphide bis Schwanensee durch die Tanzkunst geistern. Mit akademischen Studierstuben, Kathederexistenzen und skeptischer Klügelei ist im Ballett kein Staat zu machen, wohl aber mit Liebesfantasien (Faust und Gretchen), weinseligen Festivitäten (Auerbachs Keller), illusionistischem Hokuspokus (Explosion dortselbst), hexenhaften Maskeraden (Walpurgisnacht), Duellen im Morgengrauen (Faust und Gretchens Bruder Valentin) sowie einer Frau, die sich selbst um der Liebe willen opfert und darüber dem Wahnsinn anheim fällt (Gretchen – alias Giselle). Episoden aus diesem Formenkreis erzählt fast jedes französische Tanz-Opus der postnapoleonischen Ära. Genau wie Schuld, Unschuld, Verrat eine Trias bilden, die das vormoderne Ballettschaffen dominiert.
Faust also hat Konjunktur bei den Choreografen des 19. Jahrhunderts, ja ein bedeutender Vertreter des Fachs ist gar der Meinung, dass diese urdeutsche Geschichte und ihre Charaktere nirgendwo besser aufgehoben sind als im Tanz. So schreibt der Däne August Bournonville im Rückblick auf seine eigene, 1832 am Königlichen Theater in Kopenhagen herausgebrachte Fassung, dass Gretchens «Versuchung und Verführung, ihr Leiden und ihre Rettung sich meiner Ansicht nach besser für eine feine, plastische Bearbeitung eignen als für Deklamation und Gesang.» Auch «Fausts Tiraden» nähmen sich auf dem Papier erheblich besser aus denn aus dem Mund eines Schauspielers, wo sie nur noch «verächtlich und ermüdend» wirkten. Bournonville, der selbst zunächst die Titelpartie übernahm, in späteren Jahren jedoch als Terror-Mephisto sogar dem Philosophen Sören Kierkegaard Angst und Schrecken einjagte – Bournonville also nahm zwar für sich in Anspruch, eine ideale Umsetzung vorgelegt zu haben. Doch viel öfter gespielt und nachgespielt wurde die Version, die Jean Corallis junger Kollege Jules Perrot 1848 für die Mailänder Scala choreografierte. Perrot, der mit Giselle und Ondine in den frühen 1840er-Jahren den Durchbruch schaffte, studierte seinen Faust erst in Wien und 1854 auch in St. Petersburg ein, das sich langsam aufschwang, Paris den Rang der Welthauptstadt des Tanzes streitig zu machen. Als Faust trat dabei ein Mann aus der Kulisse, der selbst zum Meisterwerk-Macher des Zarenreiches schlechthin werden sollte: Marius Petipa, Genius des neoromantischen Balletts.
Die Genealogie der Faust-Bearbeiter lässt sich unschwer fortschreiben, über die Jahrhundertwende hinweg, zu eminenten und exzellenten Choreografen, die ihre Kunst unermüdlich vorantrieben. So Mikhail Fokine, Frederick Ashton, Roland Petit, Maurice Béjart – mit einem wesentlichen Unterschied zu früheren Adaptionen: Neuere Varianten beziehen sich fast ausnahmslos auf Franz Liszts Mephisto-Walzer, die ihrerseits Nikolaus Lenaus biedermeierlich verinnerlichten Faust musikalisch paraphrasieren – gewissermassen das Gegenmodell zu Goethes grandios gelangweiltem Narzissten und Weltenfahrer. Weitere Bearbeitungen stammen von George Balanchine, der den Faust-Mythos gleich mehrfach verpackte, zuletzt 1975 mit Walpurgisnacht. Den grössten Skandal machte Werner Egks 1948 von Marcel Luipart einigermassen freizügig gestalteter Abraxas, der das Tanzpoem Der Doktor Faust aus der Feder Heinrich Heines ins Bühnenportal der Bayerischen Staatsoper einpasste – sehr zum Verdruss der katholischen Kulturelite des Freistaats. Der vorerst letzte Versuch eines namhaften Choreografen, dem komplizierten Faust-Anspruch gerecht zu werden, nimmt Franz Liszts Faust-Sinfonie als Sprungbrett. Jean-Christophe Maillot stemmte 2007 eine klassische Dreiecks-Liaison auf die Unterwasserbühne des Grimaldi Forums Monaco: Mephisto als ewiger Erzengel des Bösen, Faust als Sterblicher mit Ambitionen auf göttliche Horizonte, schliesslich Gretchen als Inkarnation des geflügelten Worts – «Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.»
Wieviel Faust also verträgt der Tanz? Rein empirisch betrachtet: eine ganze Menge. Das gilt heute vielleicht sogar mehr denn je. Längst stösst unser positivistisches Weltbild an Grenzen, ist das Primat des Materiellen erschöpft, die Attraktion des Konsums verblasst. Zumindest in den Gesellschaften des Westens. Mephisto hat sich als Zerstörer in unserem Inneren eingenistet. Die Zerrissenheit, ja Spaltung, die Faust an sich beobachtet – «Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust» −, sie ist zum Charakteristikum des modernen Menschen geworden. Das Streben nach Wissen um jeden Preis geht Hand in Hand mit der Erkenntnis, dass der Optimierungs- und Machbarkeitswahn immer mehr Risikoschwellen niederwalzt. Was die Frage provoziert: Wie hoch ist er wirklich, der Preis unserer Allmachtsfantasien? Und wie gehen wir um mit dem Gegenprinzip, mit der Sehn-sucht nach Ganzheit, nach der Einheit von physischem und metaphysischem Erleben?
Die Tanz-Theoretiker des 18., 19., und frühen 20. Jahrhunderts bestritten energisch, dass derlei knifflige Überlegungen in Terpsichores Reich bebildert werden können. Wir aber haben erfahren, dass grosse Kunst mehr ist als die schiere Addition sinnlicher und sinnstiftender Elemente, dass ihre wahre Substanz jenseits dessen liegt, was unser Verstand erfasst. Warum sollte das nicht auch für die Tanzkunst gelten? Faust ist in dieser Hinsicht – allererste Wahl!
Text von Dorion Weickmann.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 58, April 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.